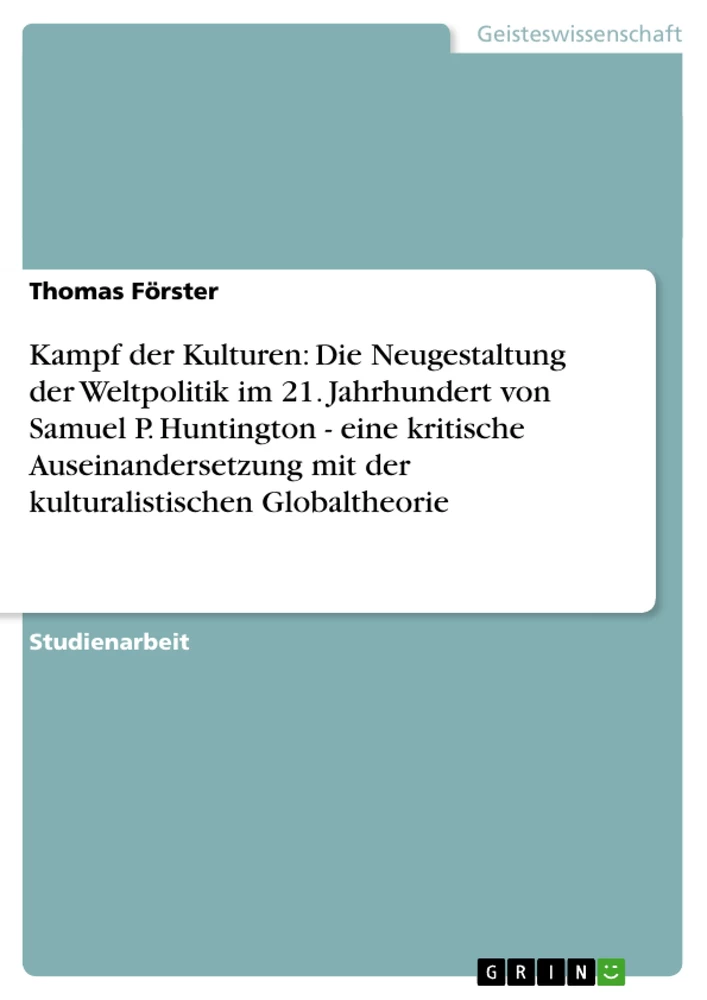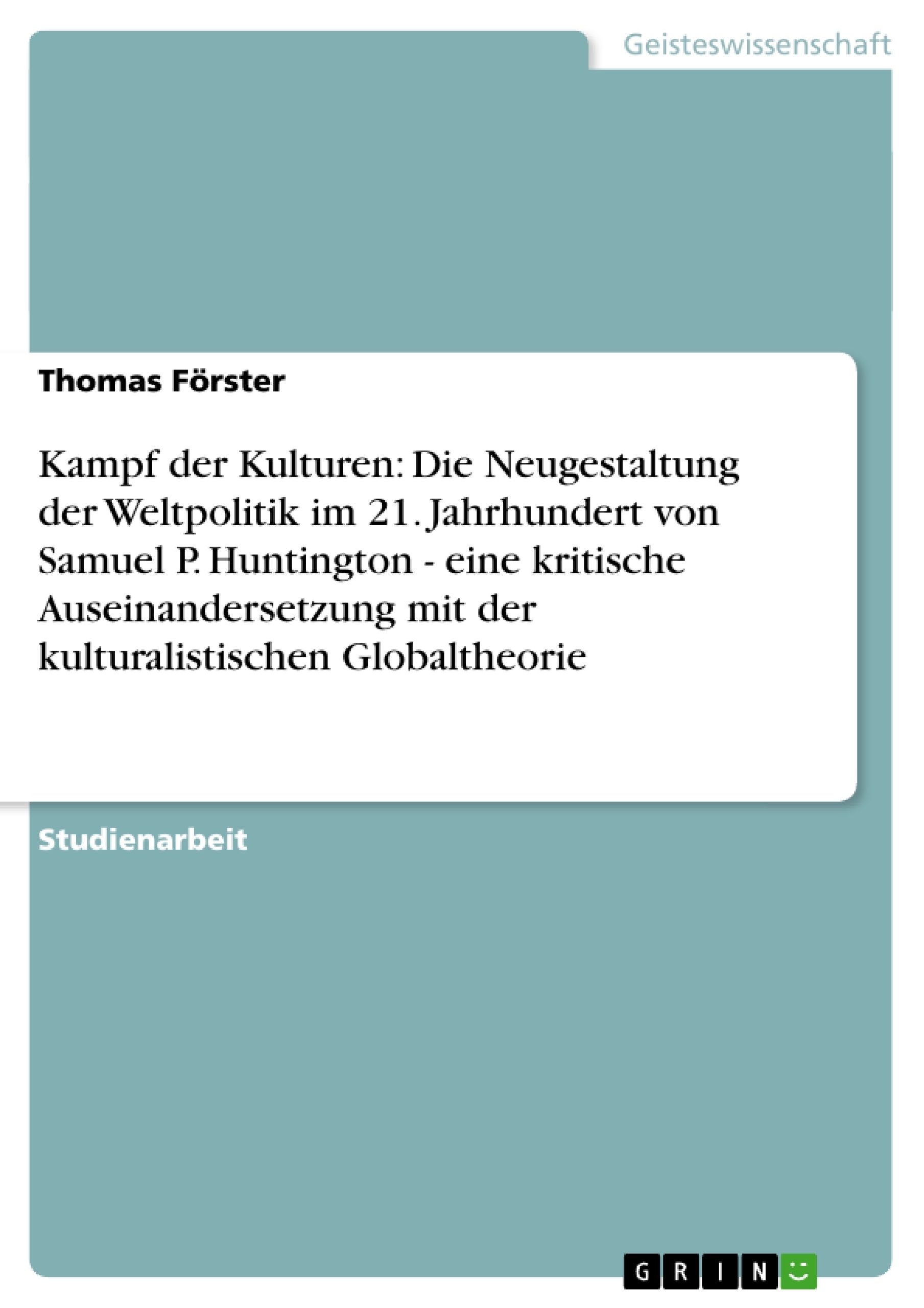Diese Arbeit hat zum Ziel die Theorie von Samuel P. Huntington (* 18. April 1927, New York) vom „Kampf der Kulturen“ zu kritisieren. Diese Kritik erfüllt nicht denAnspruch der Vollständigkeit, soll aber einen Versuch darstellen, die wichtigstenKritikpunkte der Huntington´schen Theorie festzuhalten, sie zu beschreiben und zu erklären. Ich werde auf mikroskopische Gesichtpunkte seiner Theorie ebensoeingehen wie auf makroskopische. Zudem versuche ich, das empirische Material zu analysieren und seine Argumentationslogik zu entschlüsseln. Außerdem werde ich mich mit seiner Popularität und der damit verbundenen Gefahr des Missbrauchsseiner Theorie zuwenden und darüber hinaus kurz auf den 11. September 2001eingehen und versuchen den Terroranschlag mit Huntington in Verbindung zubringen. Zunächst möchte ich allerdings die wichtigsten Thesen Huntingtonsschildern. Im Anschluss daran werden die einzelnen Punkte in der Kritik wiederaufgegriffen und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Huntington und der „Clash of Civilizations“
- Huntingtons weltpolitische Bausteine
- Die Verschiebung des weltpolitische Gleichgewichts
- Die Kulturkreise der Provokateure
- „Kampf der Kulturen“
- Huntingtons Fazit
- Kritik
- Mikroskopische Ebene: Bruchlinienkonflikte
- Makroskopische Ebene: Kernstaatenkonflikte
- Kulturkreise und Zivilisation
- Kritik am „Kampf der Kulturen“
- „Die blutigen Grenzen des Islam“?
- Die „konfuzianisch-islamische Schiene“?
- „Kultureller“ oder „ethnischer Faktor“?
- Eine Relativierung des Jugoslawienkonflikts – empirische Belege
- Huntington und der „kritische Rationalismus“: Bieten wenige Grundannahmen große Erklärungen?
- Erfolg und Missbrauch Huntingon´scher Theorie
- Exkurs: Huntington und der 11. September 2001
- Kritik an Huntingtons Schlussplädoyer
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit nimmt sich die Theorie von Samuel P. Huntington vom „Kampf der Kulturen“ zum Ziel, um eine kritische Analyse zu liefern. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der zentralen Kritikpunkte der Huntington'schen Theorie, sowohl auf der mikro- als auch auf der makroskopischen Ebene.
- Die Analyse der wichtigsten Argumente und Thesen von Huntington
- Die kritische Betrachtung der Huntington'schen Theorie im Kontext des realen Weltgeschehens
- Die Untersuchung der Popularität der Theorie und des damit verbundenen Risikos ihres Missbrauchs
- Die Einordnung der Huntington'schen Theorie im Kontext des 11. Septembers 2001
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die zentrale Zielsetzung der Arbeit vor, nämlich die kritische Auseinandersetzung mit der „Kampf der Kulturen“-Theorie von Samuel P. Huntington.
- Kapitel 2 stellt die Huntington'sche Theorie vom „Clash of Civilizations“ vor, indem es die wichtigsten Bausteine der Theorie, die Verschiebung des weltpolitischen Gleichgewichts nach dem Kalten Krieg und die Identifizierung der relevanten Kulturkreise erläutert.
- Kapitel 3 widmet sich der Kritik an der „Kampf der Kulturen“-Theorie. Es wird die Theorie auf mikroskopischer und makroskopischer Ebene untersucht, wobei die empirischen Beweise analysiert werden.
- Der Fokus von Kapitel 3 liegt insbesondere auf der Frage, ob die Theorie des „Kampf der Kulturen“ die Komplexität realer Konflikte ausreichend erklärt. Dabei werden Kritikpunkte an der Theorie in Bezug auf die Rolle des Islams und die Anwendung der Theorie auf den Jugoslawienkonflikt diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen und Begriffen wie „Kampf der Kulturen“, „Clash of Civilizations“, „Kulturkreise“, „Weltpolitik“, „Kulturelle Konflikte“, „Kritischer Rationalismus“, „Terrorismus“, „11. September 2001“ und „Samuel P. Huntington“. Im Fokus stehen die Analyse der Theorie, die kritische Betrachtung der empirischen Belege sowie die Analyse der Popularität und der damit verbundenen Gefahren der „Kampf der Kulturen“-Theorie.
- Quote paper
- Thomas Förster (Author), 2003, Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert von Samuel P. Huntington - eine kritische Auseinandersetzung mit der kulturalistischen Globaltheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16026