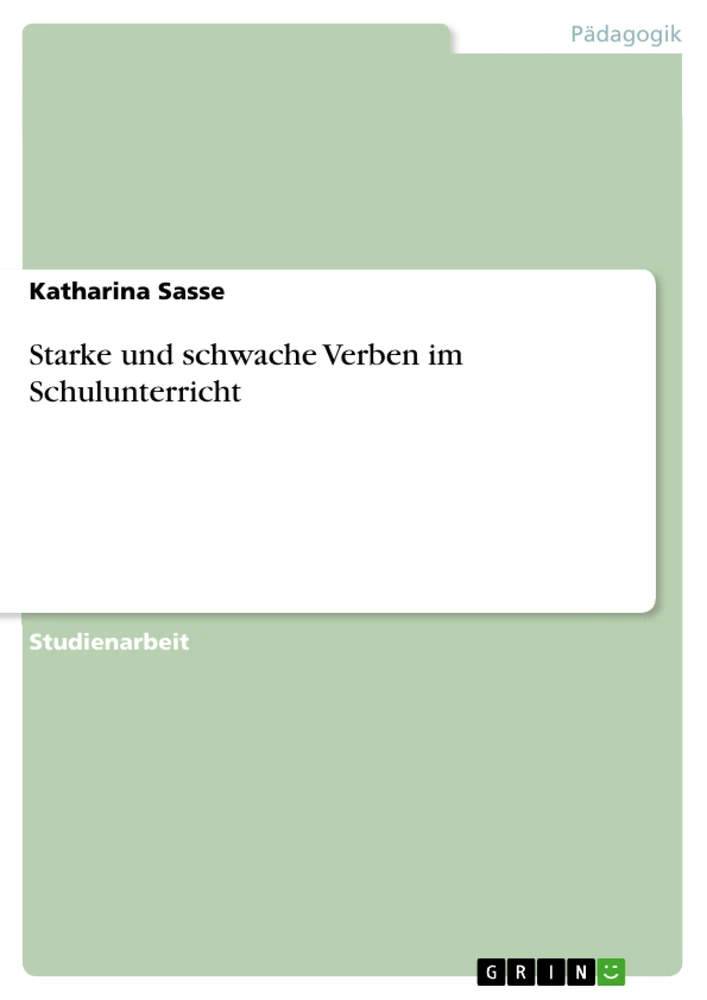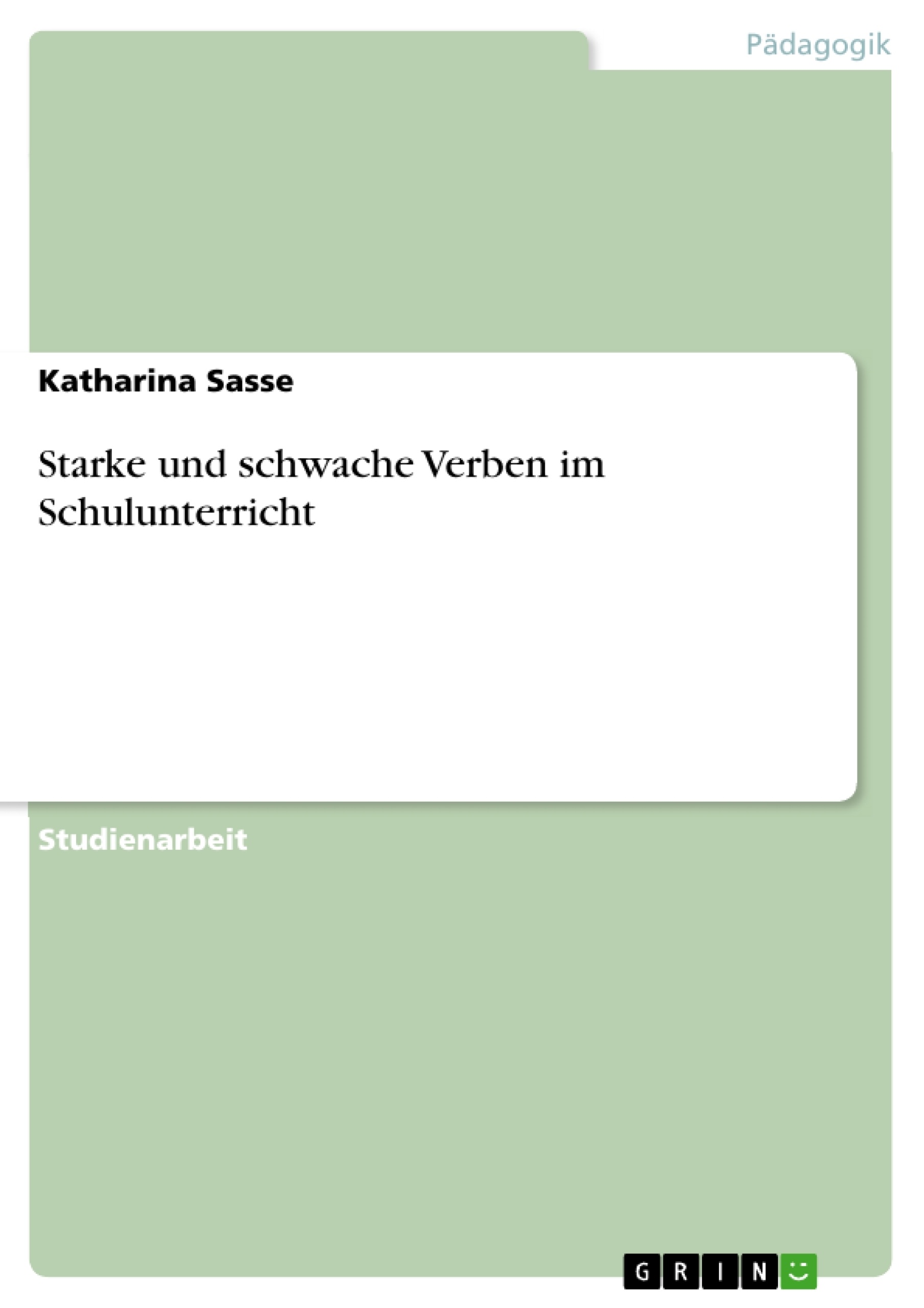Hinsichtlich der Konjugation gibt es im Deutschen wie auch in allen anderen germanischen Sprachen zwei verschiedene Verbklassen, die starken Verben und die schwachen Verben.
Im Laufe der Zeit geht die Zahl der starken Verben leicht zurück (Neubildungen von starken Verben gibt es nur in Ausnahmefällen) und die der schwachen Verben steigt an. Das liegt daran, dass alle Verben, die im Deutschen hinzukommen zukünftig schwach konjugiert werden sollen. Das Mittelhochdeutsche besaß über 300 starke Verben. Heute gibt es nur noch etwa 250 starke Verben im deutschen Wortschatz.
Dabei sind die Verben, die am häufigsten gebraucht werden meist starke Verben. Die seltener vorkommenden Verben sind meist die schwachen Verben.
Diese Arbeit soll starke und schwache Verben thematisieren. Insbesondere die Behandlung starker und schwacher Verben im Schulunterricht (in der Sekundarstufe 1) soll Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sein.
Mein spezifisches Interesse für dieses Thema ergab sich aus der Überlegung, welche grammatischen Themen im Schulunterricht häufiger behandelt werden und welche seltener oder gar nicht. Es gibt eine Reihe von grammatischen Themen, die regelmäßig im Schulunterricht behandelt und von Schuljahr zu Schuljahr ständig wiederholt werden. Solche Themen sind zum Beispiel „die Satzglieder“ oder „dass mit s oder Doppel-s“ (siehe Kapitel 4).
Ich beabsichtige nicht mit dieser Arbeit ein Thema zu behandeln, dass schon zum regelmäßigen Bestandteil des Grammatikunterrichts gehört. „Starke und schwache Verben“, so hatte ich den Anschein, gehören eher zu den weniger behandelten Themen im deutschen Grammatikunterricht, auch wenn dieses Thema für den Erwerb einer Fremdsprache unabkömmlich ist. Dies werde ich insbesondere in Kapitel 4 thematisieren.
Vorab werde ich kurz den Begriff Verb allgemein erläutern. Außerdem beschreibe ich kurz das System der verschiedenen Kategorien, nach denen ein Verb klassifiziert werden kann.
Später gehe ich dann besonders auf starke und schwache Verben, deren Bedeutung und Funktion ein (Kapitel 3). Auch die Darstellung starker und schwacher Verben in Lehrbüchern ist Teil des Kapitels 3.
Eine Unterrichtseinheit zum Thema in Kapitel 5 soll zeigen, dass sich auch zu grammatischen Themen abwechslungsreiche Unterrichtsstunden gestalten lassen. Ein wichtiges Ziel, das in diesem Unterrichtsentwurf erreicht werden soll ist, dass die Unterrichtsstunde so gestaltet wird, dass sich Schüler bei diesem Thema nicht langweilen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Verb allgemein
- Starke und schwache Verben
- Was sind starke und schwache Verben?
- Starke und schwache Verben in Lehrbüchern
- Ablautklassen
- Die sieben Ablautklassen
- Probleme bei der Konjugation
- Starke und schwache Verben und ihre Behandlung im Schulunterricht
- Unterrichtsstunde zu starken und schwachen Verben
- Hauptintentionen
- Methodische Überlegung
- Ziele /Kompetenzen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die starken und schwachen Verben im Deutschen, insbesondere deren Behandlung im Schulunterricht der Sekundarstufe 1. Das Ziel ist es, die Bedeutung dieses Themas im Spracherwerb aufzuzeigen und zu belegen, dass auch zu diesem grammatischen Bereich abwechslungsreiche und motivierende Unterrichtsstunden gestaltet werden können. Die Arbeit beleuchtet die Häufigkeit der Behandlung dieses Themas im Vergleich zu anderen grammatischen Inhalten.
- Klassifizierung von Verben (stark, schwach)
- Darstellung in Schulbüchern
- Konjugationsprobleme
- Didaktische Ansätze im Unterricht
- Gestaltung einer motivierenden Unterrichtsstunde
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der starken und schwachen Verben ein und erläutert den Hintergrund der Arbeit. Es wird der Rückgang der starken Verben und der Anstieg der schwachen Verben im Laufe der Zeit beschrieben. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Behandlung dieses Themas im Schulunterricht der Sekundarstufe 1, da es im Vergleich zu anderen grammatischen Themen weniger häufig behandelt wird, trotz seiner Bedeutung für den Spracherwerb.
2. Das Verb allgemein: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Verb“ allgemein und beschreibt verschiedene Kategorien der Verb-Klassifizierung. Es werden Tätigkeits-, Vorgangs- und Zustandsverben erläutert, wobei die fließenden Grenzen zwischen diesen Kategorien hervorgehoben werden. Die Kritik an der traditionellen Klassifizierung wird erwähnt, und der Infinitiv als Grundform des Verbs wird definiert. Zusätzlich werden ein-, zwei- und dreiwertige Verben sowie Vollverben, Hilfsverben und Modalverben vorgestellt, wobei die Bedeutung der verschiedenen Verbformen für den Satzbau betont wird.
3. Starke und schwache Verben: Kapitel 3 befasst sich eingehend mit starken und schwachen Verben. Es werden Definitionen und Beispiele gegeben und die Darstellung dieser Verbklassen in Schulbüchern analysiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Ablautklassen und den damit verbundenen Problemen bei der Konjugation. Dieses Kapitel bildet das Herzstück der Arbeit und legt die Grundlage für die didaktischen Überlegungen im späteren Verlauf.
4. Starke und schwache Verben und ihre Behandlung im Schulunterricht: Dieses Kapitel analysiert, wie das Thema "Starke und schwache Verben" im Schulunterricht behandelt wird (oder nicht behandelt wird). Es wird ein Vergleich mit anderen grammatischen Themen angestellt, die regelmäßig wiederholt werden, und es wird die These aufgestellt, dass starke und schwache Verben ein unterrepräsentiertes Thema im Grammatikunterricht darstellen, obwohl es für den Spracherwerb essentiell ist.
5. Unterrichtsstunde zu starken und schwachen Verben: Dieses Kapitel präsentiert einen konkreten Unterrichtsentwurf zum Thema starke und schwache Verben. Es werden die Hauptintentionen, methodische Überlegungen und die angestrebten Kompetenzen der Schüler detailliert beschrieben. Der Entwurf zielt darauf ab, eine abwechslungsreiche und motivierende Unterrichtsstunde zu gestalten, die die Schüler aktiv mit einbezieht und Langeweile vermeidet.
Schlüsselwörter
Starke Verben, schwache Verben, Verbkonjugation, Ablautklassen, Grammatikunterricht, Sekundarstufe 1, Spracherwerb, Didaktik, Unterrichtsgestaltung, methodische Überlegungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Starke und Schwache Verben im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die starken und schwachen Verben im Deutschen, insbesondere deren Behandlung im Schulunterricht der Sekundarstufe 1. Sie beleuchtet die Bedeutung dieses Themas für den Spracherwerb und zeigt Möglichkeiten auf, abwechslungsreiche und motivierende Unterrichtsstunden zu diesem Thema zu gestalten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Häufigkeit der Behandlung dieses Themas mit anderen grammatischen Inhalten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine allgemeine Einführung in das Thema, eine detaillierte Betrachtung der starken und schwachen Verben inklusive ihrer Ablautklassen und Konjugationsprobleme, eine Analyse der Behandlung dieses Themas in Schulbüchern und im Unterricht der Sekundarstufe 1, sowie einen konkreten Unterrichtsentwurf für eine motivierende Unterrichtsstunde zu starken und schwachen Verben. Zusätzlich wird der Begriff "Verb" allgemein definiert und verschiedene Verb Kategorien werden erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung (Einführung in die Thematik und Beschreibung des Rückgangs starker Verben); 2. Das Verb allgemein (Definition und Kategorisierung von Verben); 3. Starke und schwache Verben (Definitionen, Beispiele, Analyse der Darstellung in Schulbüchern, Ablautklassen und Konjugationsprobleme); 4. Starke und schwache Verben und ihre Behandlung im Schulunterricht (Analyse der Behandlung im Unterricht und Vergleich mit anderen grammatischen Themen); 5. Unterrichtsstunde zu starken und schwachen Verben (konkreter Unterrichtsentwurf mit Hauptintentionen, methodischen Überlegungen und angestrebten Kompetenzen); und Schluss.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung der starken und schwachen Verben im Spracherwerb aufzuzeigen und zu demonstrieren, dass auch zu diesem grammatischen Bereich abwechslungsreiche und motivierende Unterrichtsstunden gestaltet werden können. Die Arbeit soll belegen, dass dieses Thema trotz seiner Bedeutung im Grammatikunterricht unterrepräsentiert ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Starke Verben, schwache Verben, Verbkonjugation, Ablautklassen, Grammatikunterricht, Sekundarstufe 1, Spracherwerb, Didaktik, Unterrichtsgestaltung, methodische Überlegungen.
Wie wird das Thema "Starke und schwache Verben" im Schulunterricht behandelt (laut der Arbeit)?
Die Arbeit analysiert die Behandlung (oder Nicht-Behandlung) des Themas "Starke und schwache Verben" im Schulunterricht und vergleicht dies mit anderen regelmäßig wiederholten grammatischen Themen. Es wird die These aufgestellt, dass starke und schwache Verben ein unterrepräsentiertes Thema darstellen, obwohl sie für den Spracherwerb essentiell sind.
Welche didaktischen Ansätze werden in der Arbeit vorgeschlagen?
Die Arbeit präsentiert einen konkreten Unterrichtsentwurf für eine motivierende Unterrichtsstunde zu starken und schwachen Verben. Dieser Entwurf beinhaltet detaillierte Beschreibungen der Hauptintentionen, methodischen Überlegungen und der angestrebten Kompetenzen der Schüler. Der Fokus liegt auf einer aktiven Einbeziehung der Schüler und der Vermeidung von Langeweile.
Welche Probleme bei der Konjugation von starken und schwachen Verben werden angesprochen?
Die Arbeit befasst sich mit den Problemen bei der Konjugation von starken Verben, die insbesondere mit den Ablautklassen zusammenhängen. Diese Probleme werden im Kontext der Darstellung in Schulbüchern und der didaktischen Herausforderungen im Unterricht beleuchtet.
- Quote paper
- Katharina Sasse (Author), 2008, Starke und schwache Verben im Schulunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160223