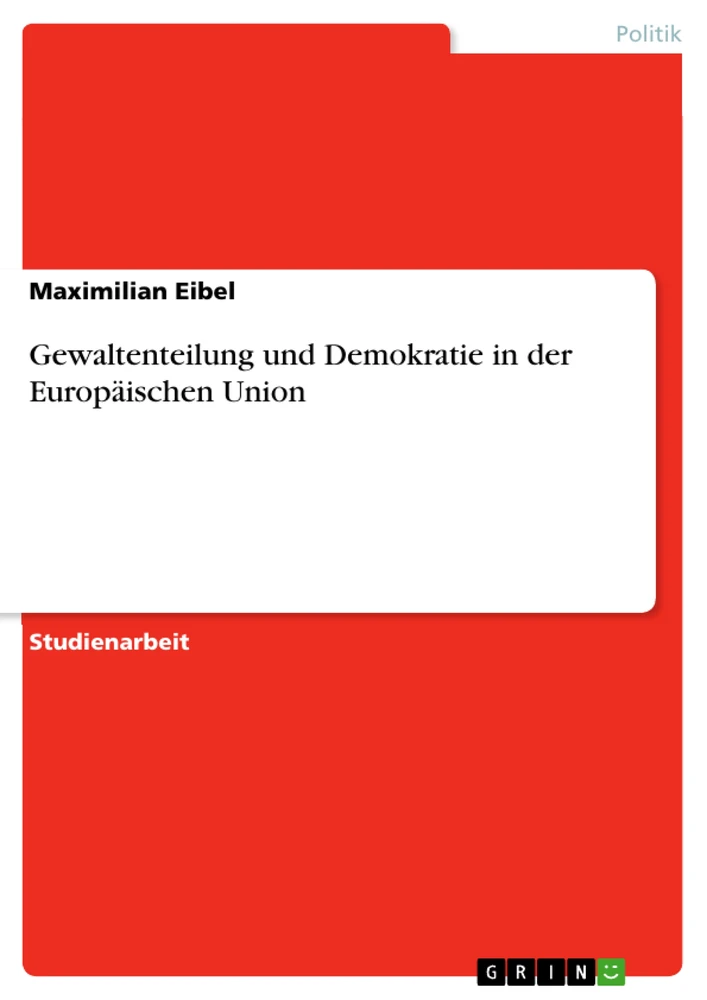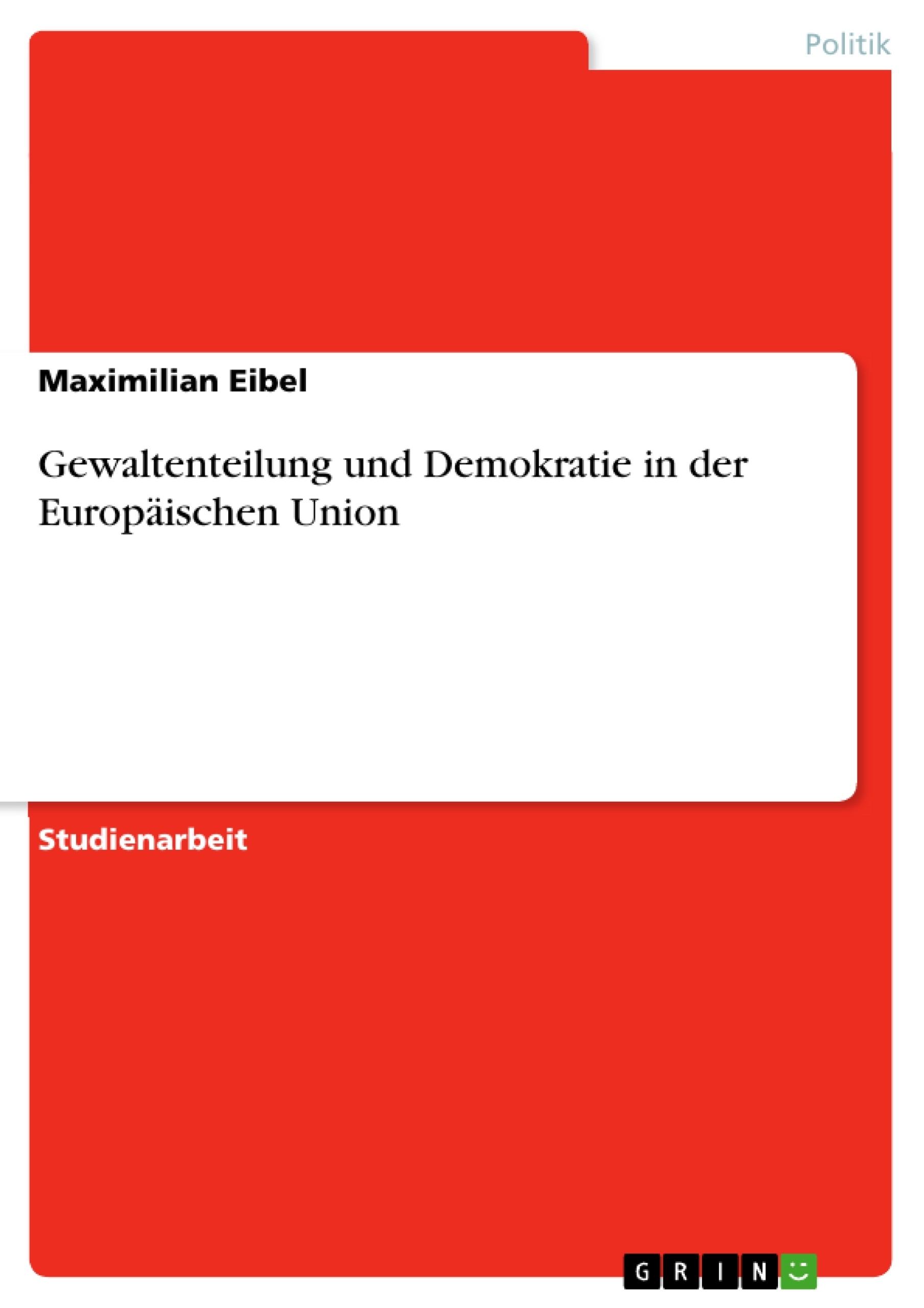Die einstige Wirtschaftsgemeinschaft ist zu einem komplizierten Mehrebenensystem herangewachsen, das mittlerweile staatsgleiche Funktionen ausübt ohne sich als Staat konstituiert zu haben.
Dies lässt nun die Frage aufkommen, was die EU überhaupt ist und inwiefern sie für ihren Eingriff in das Leben der Bürger Europas demokratisch legitimiert wurde, denn „Politische Herrschaftsgewalt als besondere Form der Herrschaft von Menschen über Menschen ist nicht einfach vorgegeben und hinzunehmen, sondern bedarf einer sie rechtfertigenden Herleitung“ (Höreth, Marcus 1999: 16).
Anstoß sich mit dem Thema Demokratie innerhalb der EU auseinanderzusetzen, gab mir der Aufsatz „Zur Ideengeschichte der Gewaltenteilung und der Funktionsweise der Justiz“ von Ingeborg Maus. Hierin hat Maus die Verwirklichung der Demokratie in Europa – im Speziellen das Prinzip der Volkssouveränität – bemängelt und sich mit der Gewaltenteilung auf der europäischen Ebene auseinandergesetzt, die ihrer Ansicht nach nichts mit dem Idealbild von Kant, Locke und Rousseau zu tun hat, sondern eher der Souveränitätsteilung nach Montesquieu entspricht. Des Weiteren geht sie auf das Problem der fortschreitenden Zentralisierung und vor allem auf die ungeregelten Kompetenzen innerhalb der EU ein, die auch durch den Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE) nicht geklärt werden. Hier zieht Maus sogar direkte Parallelen zu anderen totalitären Systemen die genau durch „jene ungeregelte Konkurrenz der Apparate“ (Maus, Ingeborg 2005: 259) sich den Weg bereiteten.
Die hierin angesprochenen Probleme, die Europa hat, sollen zum Teil aufgegriffen und analysiert werden, um dann einen Ausblick geben zu können, was für ein Gebilde Europa ist, wie das Demokratiedefizit aussieht und ob durch die vertiefende Integration durch den VVE (mittlerweile Vertrag von Lissabon) die Gefahr besteht, dass sich ein „System ungeregelter Konkurrenz von Machtapparaten“ (ebd.) etabliert.
Aufgrund des Umfangs der Arbeit werde ich keinen näheren Bezug auf die sich verändernde Rechtssetzung und Rechtsanwendung der Justiz nehmen, auf dem ein weiterer Schwerpunkt des Aufsatzes von Maus liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewaltenteilung – Theorie und Wirklichkeit
- Ideen nach Maus
- Gewaltenteilung in der EU
- Organe der EU
- Umsetzung in Europa
- Demokratisches Europa?
- Demokratiedefizit und Legitimationsdilemma
- Europäischer „Demos“ oder Einheit in Vielfalt?
- Was für ein Gebilde ist die Europäische Union?
- Staat, Staatenbund oder Bundesstaat?
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage nach der Demokratie innerhalb der Europäischen Union. Die Autorin analysiert die Gewaltenteilung und ihre Umsetzung in der EU im Kontext der historischen Theorie der Gewaltenteilung. Ziel des Textes ist es, die Herausforderungen der Demokratie innerhalb des komplexen Mehr-Ebenen-Systems der EU zu beleuchten und einen Ausblick auf die Zukunft des europäischen Integrationsprozesses zu geben.
- Gewaltenteilung und ihre Umsetzung in der EU
- Demokratiedefizit und Legitimationsdilemma in der EU
- Der europäische Integrationsprozess und seine Auswirkungen auf die Staatsform der EU
- Die Rolle des Europäischen Parlaments und seine Bedeutung für die demokratische Legitimation
- Die Frage nach der Souveränität und der Funktionsweise der europäischen Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Demokratie innerhalb der EU ein und stellt die Entwicklung der EU als Integrationsprozess dar. Sie thematisiert die Frage nach der demokratischen Legitimation der EU angesichts ihrer komplexen Struktur und ihrer fortschreitenden Kompetenzerweiterung.
Der zweite Teil beleuchtet die Gewaltenteilung in Theorie und Praxis. Die Autorin bezieht sich auf Ingeborg Maus und deren Analyse der Gewaltenteilung im Kontext der EU. Sie erläutert die Unterschiede zwischen Montesquieus Modell der Gewaltenteilung und dem demokratischen Gewaltenteilungssystem, das Maus fordert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Volkssouveränität und der Gesetzgebungsbefugnis des Parlaments.
Das dritte Kapitel analysiert das Demokratiedefizit in der EU und das damit verbundene Legitimationsdilemma. Es werden die Herausforderungen der Demokratie in einem Mehr-Ebenen-System diskutiert und die Rolle des Europäischen Parlaments für die demokratische Legitimation der EU beleuchtet.
Im vierten Kapitel wird die Frage nach der Staatsform der EU behandelt. Der Text untersucht, ob die EU als Staat, Staatenbund oder Bundesstaat betrachtet werden kann und welche Auswirkungen dies auf die demokratische Legitimation der EU hat.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Europäische Union, Gewaltenteilung, Demokratie, Demokratiedefizit, Legitimationsdilemma, Integrationsprozess, Volkssouveränität, Staat, Staatenbund, Bundesstaat, Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union, Vertrag von Lissabon.
- Quote paper
- Maximilian Eibel (Author), 2009, Gewaltenteilung und Demokratie in der Europäischen Union , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160195