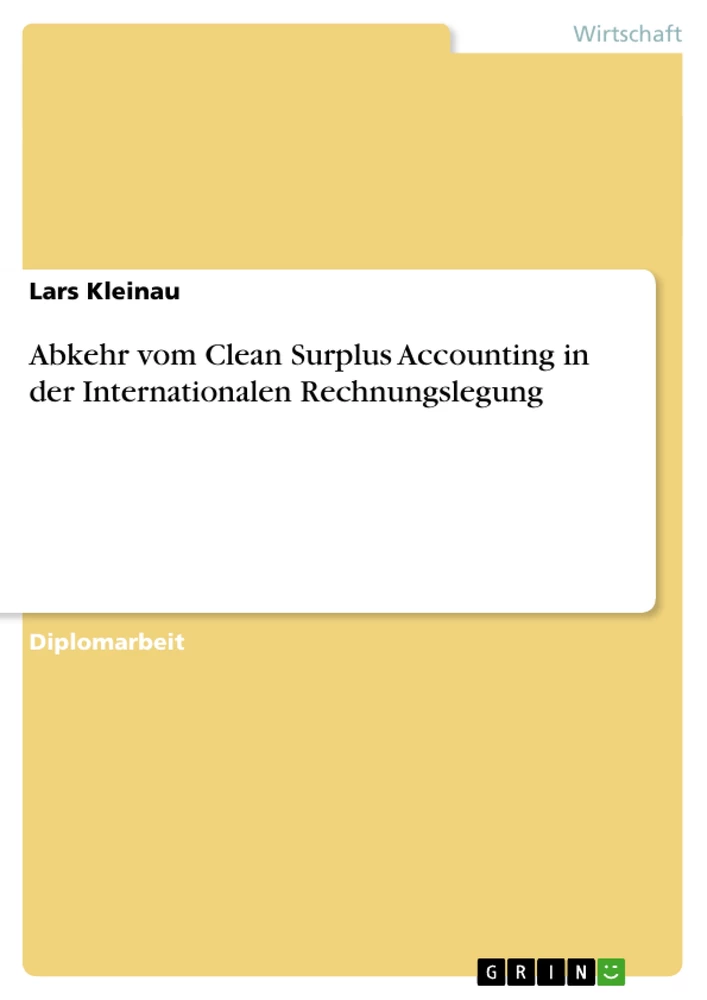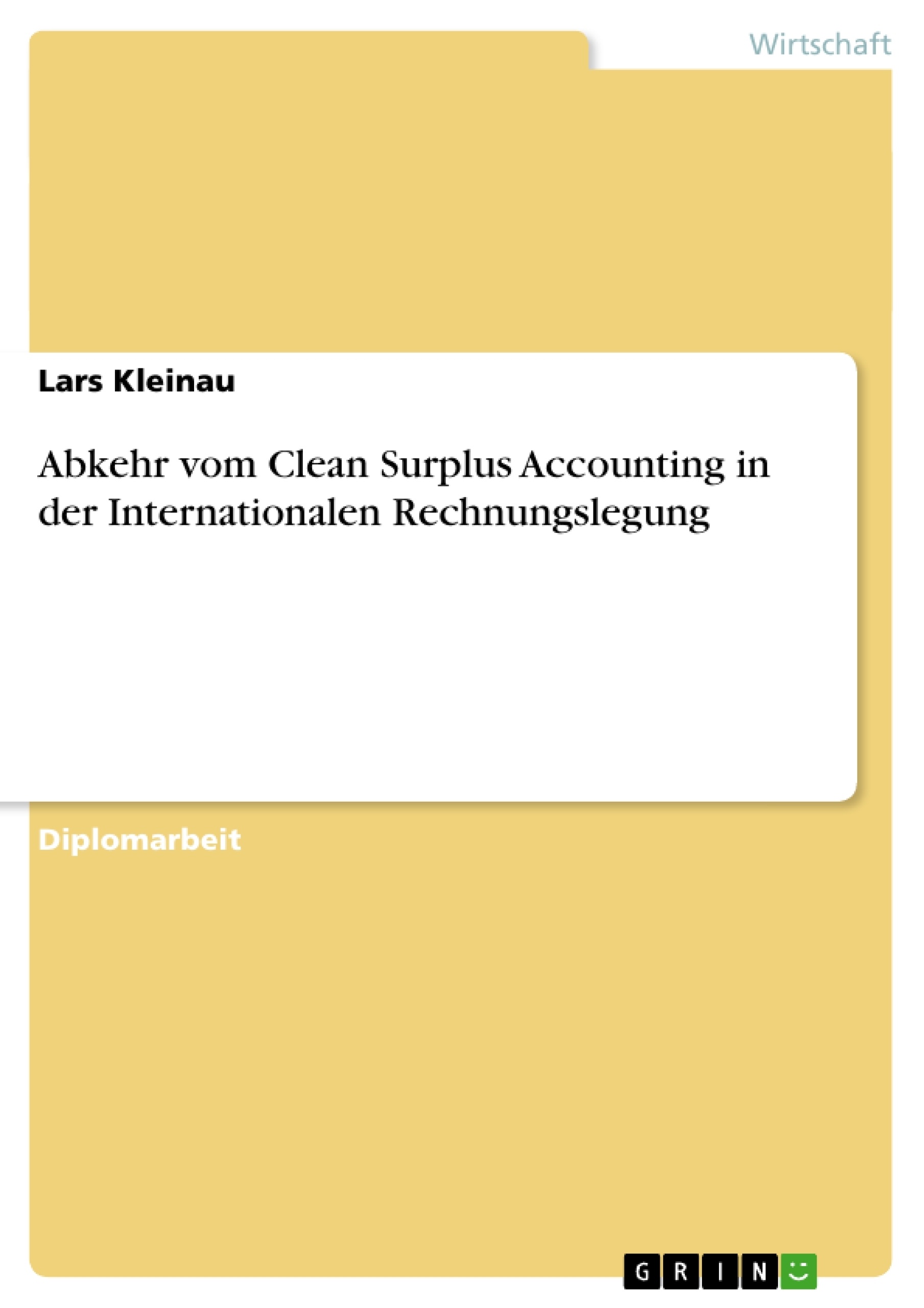„‚Auf der Suche nach dem richtigen Gewinn’ ist festzustellen, dass es den Gewinn nicht gibt.“ Die Erfolgsgröße hängt stets vom betrachteten Bilanzzweck ab und unterscheidet sich
in den Rechnungslegungsnormen, beispielsweise zwischen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Laut § 275 HGB wird das Ergebnis der GuV als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und stellt den Gewinn im Handelsrecht dar, der aus der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen einer Periode resultiert. Nimmt dieser positive Werte an, so führt er zur Erhöhung des Eigenkapitals, im Fall von Verlusten wird das Eigenkapital aufgezerrt. Aufgrund der Buchungssystematik stimmt das GuV-Ergebnis, der sog. Periodengewinn, mit der Eigenkapitaländerung laut Bilanz am Ende einer Periode überein. Trifft dieser Zusammenhang zu, so ist das Kongruenzprinzip, im Englischen clean surplus condition, erfüllt. Dieses Prinzip besagt, dass die Summe der Periodengewinne dem Totalgewinn eines Unternehmens entspricht. Im Handelsrecht das Kongruenzprinzip bis auf eine Ausnahme nahezu beachtet.
In der internationalen Rechnungslegung resultiert die Eigenkapitaländerung einer Periode nicht allein aus dem Ergebnis der GuV, da nicht alle Aufwendungen und Erträge direkt in der
GuV Berücksichtigung finden. Daher ist der Zusammenhang zwischen Gewinnermittlung laut GuV und der Eigenkapitalveränderung durchbrochen und das Kongruenzprinzip nicht mehr
erfüllt. In der Praxis zeigt sich dieses am Sachverhalt Währungsumrechnungsdifferenzen - sowohl bei positiven als auch bei negativen - am deutlichsten. Diese werden erfolgsneutral im
Eigenkapital „versteckt“ und nicht in der Erfolgsrechnung berücksichtigt. Dies ist nur einer von mehreren Sachverhalten, welcher zu Kongruenzverstößen führt. Folge derer ist die verzerrte Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Dies muss keinesfalls so sein, denn einige Sachverhaltsdarstellungen können wahlweise, andere wiederum müssen erfolgsneutral erfasst werden. Daher liegt es am Abschlussersteller den „richtigen“ Gewinn auszuweisen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Abkehr vom clean surplus accounting anhand verschiedener Kongruenzdurchbrechungen mittels ausgewählter Kriterien aufzuzeigen und kritisch zu diskutieren. Fragen, warum eine Kongruenzdurchbrechung so bedeutend ist sowie welche Auswirkungen Kongruenzdurchbrechungen haben, werden in dieser Arbeit erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Das Kongruenzprinzip (clean surplus concept)
- Der Verstoß gegen das Kongruenzprinzip (dirty surplus concept)
- Gesamterfolg (comprehensive income) und Sonstiger Gesamterfolg (other comprehensive income)
- Kritische Diskussion der Kongruenzdurchbrechungen anhand ausgewählter Sachverhalte
- Erläuterung der Vorgehensweise
- Kritische Darstellung der Sachverhaltsgestaltungen
- Neubewertung von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen
- Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen
- Währungsumrechnungsdifferenzen
- Sukzessiver Anteilserwerb
- Änderung des Zeitwerts von Finanzinstrumenten
- Änderung des Zeitwerts von zur Veräußerung verfügbaren Vermögenswerten
- Sicherungsinstrumente – erfolgsneutrale Erfassung der Wertänderungen
- Korrekturen grundlegender Fehler und rückwirkende Änderungen von Ansatz- und Bewertungsmethoden
- Latente Steuern
- Erfassung von Anpassungsbeiträgen bei der Umstellung auf die IASB-Rechnungslegung
- Zwischenfazit
- Gesamtbeurteilung der Sachverhaltsgestaltungen
- Bilanzpolitik durch geeignete Wahl der Sachverhaltsgestaltungen
- Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen
- Empirische Studien
- Erläuterung der ausgewählten Studien
- Beobachtung einzelner Sachverhalte und Bedeutung des OCI
- Messung des Grades der Abweichung vom clean surplus accounting
- Fazit und Ausblick
- Das Kongruenzprinzip und seine Bedeutung
- Die Kritik an den Kongruenzdurchbrechungen
- Die Auswirkungen der Kongruenzdurchbrechungen auf die Bilanzpolitik
- Die empirische Forschung zum Clean Surplus Accounting
- Die Bedeutung des Other Comprehensive Income (OCI)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Abkehr vom Clean Surplus Accounting in der Internationalen Rechnungslegung. Sie analysiert die Gründe für die Abkehr vom Kongruenzprinzip und die Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung und Investitionsentscheidungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung führt in die Thematik der Abkehr vom Clean Surplus Accounting ein und erläutert die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen des Clean Surplus Accounting und der Kongruenzdurchbrechungen. Es werden die verschiedenen Konzepte des Gesamterfolgs und des Sonstigen Gesamterfolgs diskutiert.
Kapitel 3 analysiert kritisch die einzelnen Sachverhaltsgestaltungen, die zu einer Abkehr vom Clean Surplus Accounting führen. Dazu gehören unter anderem die Neubewertung von Sachanlagevermögen, die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen und die Änderung des Zeitwerts von Finanzinstrumenten.
Kapitel 4 befasst sich mit empirischen Studien zum Thema Clean Surplus Accounting. Es werden verschiedene Studien vorgestellt, die den Grad der Abweichung vom Clean Surplus Accounting untersuchen und die Bedeutung des OCI für die Investitionsentscheidungen beleuchten.
Schlüsselwörter
Clean Surplus Accounting, Kongruenzprinzip, Dirty Surplus Concept, Gesamterfolg, Comprehensive Income, Other Comprehensive Income (OCI), Bilanzpolitik, Investitionsentscheidungen, Empirische Studien, IASB, IFRS.
- Quote paper
- Lars Kleinau (Author), 2010, Abkehr vom Clean Surplus Accounting in der Internationalen Rechnungslegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159786