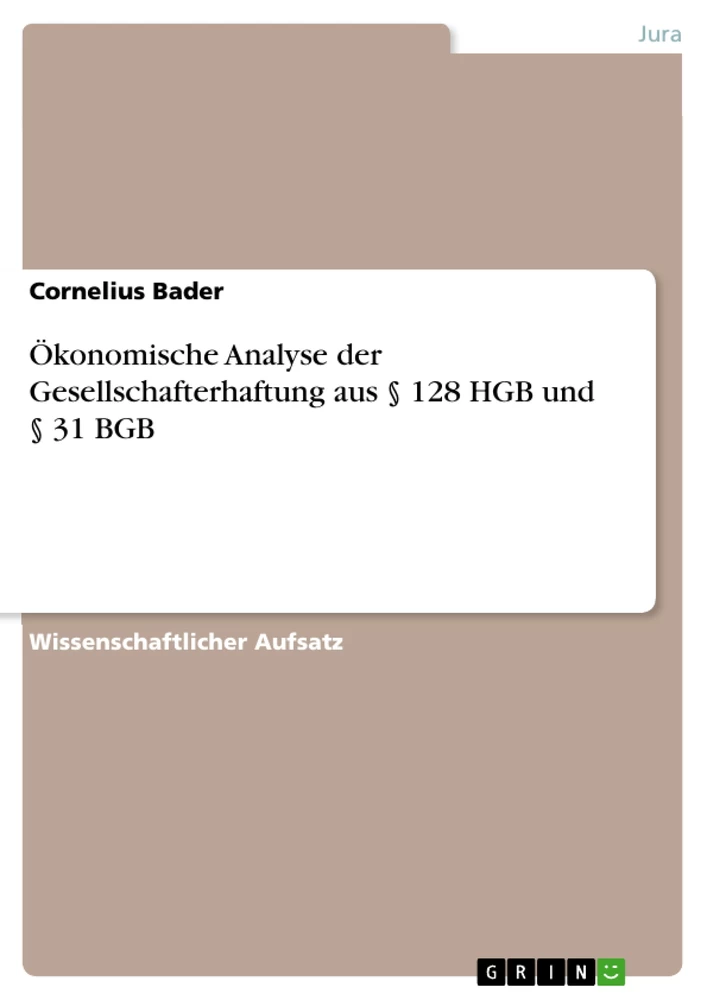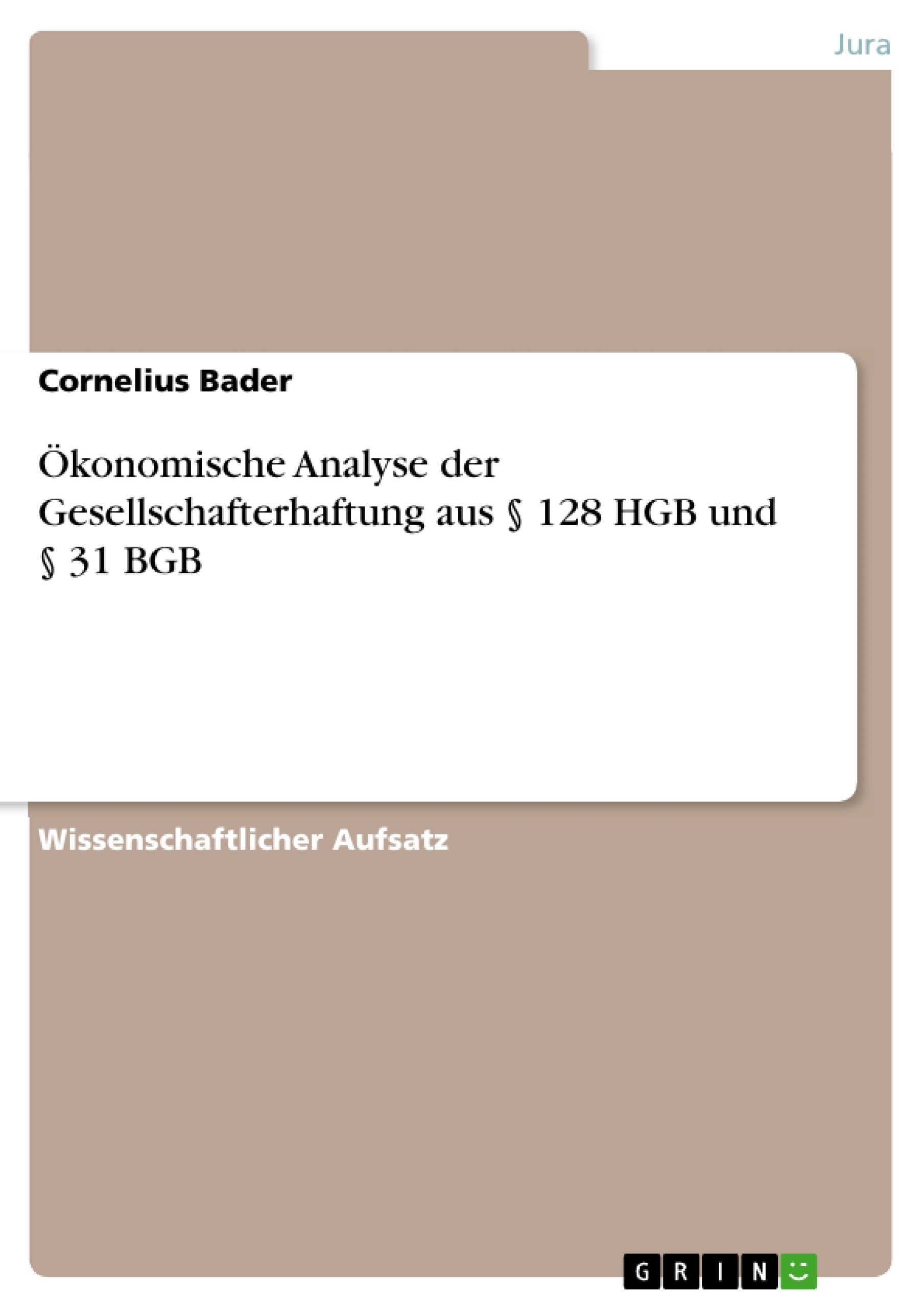Spätestens mit dem Grundsatzurteil BGHZ 146, 341, hat die personengesellschaftsrechtliche Haftungsverfassung endgültig vom Gedanken der Doppelverpflichtungslehre Abschied genommen und wird nunmehr auch im Recht der GbR einheitlich vom akzessorischen Modell des § 128 HGB geprägt. Die anschließende Diskussion, ob nun aus einer Kombination der Analogien zu § 31 BGB und § 128 HGB die unbeschränkte persönliche Gesellschafterhaftung für ein Delikt des Mitgesellschafters abzuleiten sei, hat dagegen bis heute zu keiner einheitlichen Linie gefunden und sich zu einem Streitklassiker des Gesellschaftsrechts entwickelt. Der nachfolgende Diskussionsbeitrag soll die teleologischen Gesichtspunkte des Problems vertiefen und dabei untersuchen, welchen Beitrag die effizienzorientierte Betrachtungsweise der ökonomischen Analyse des Rechts leisten kann.
Inhaltsübersicht
A. Problemstellung und Meinungsstand
B. Stellungnahme
C. Ökonomische Analyse des Problems
I. Allgemeines Ziel der Deliktshaftung und Einordnung der Haftung aus §§ 31 BGB, 128 HGB analog
II. Verschuldensunabhängige Deliktshaftung
1. Die deliktische Gefährdungshaftung
2. Haftung für das Geschäftsrisiko?
III. Verschuldensabhängige Deliktshaftung
1. Ziel der deliktischen Verschuldenshaftung
2. Analyse der konkurrierenden Haftungsmodelle vor diesem Hintergrund
D. Zusammenfassung
A. Problemstellung und Meinungsstand
Ganze 37 Jahre trennen die beiden einschlägigen Grundsatzurteile BGHZ 45, 311 (NJW 1966, 1807), und BGHZ 154, 88[1] (NJW 2003, 1445), deren Widersprüchlichkeit gleichzeitig die zwischenzeitliche Abwendung der Rechtsprechung von der Doppelverpflichtungslehre markiert. Hatte der BGH zunächst die deliktische Haftung des GbR-Mitgesellschafters abgelehnt, stellte er Anfang 2003 die gegenteilige Auffassung auf den Boden des neuen akzessorischen Haftungsmodells: Wenn aus der deliktischen Haftung des handelnden Gesellschafters analog § 31 BGB (auch) eine Verbindlichkeit der Gesellschaft werde, so führe die unbeschränkte persönliche Haftung aller Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft analog § 128 HGB zur gesamtschuldnerischen Haftung aller Mitgesellschafter. Nichts anderes ergebe sich aus teleologischen Überlegungen: Zum einen hätten die Mitgesellschafter Einfluss auf Auswahl und Tätigkeit des deliktisch Handelnden, zum anderen sei auch die Schutzwürdigkeit des deliktisch Geschädigten zu bejahen, welcher seinerseits keinen Einfluss auf die Auswahl seines Gläubigers habe.
Obwohl sich zum selben Zeitpunkt auch die ganz überwiegende Zahl der Literaturstimmen von der Doppelverpflichtungstheorie gelöst hatte, traf die Argumentationslinie des BGH auf ein geteiltes Echo. Die letztlich von Ulmer[2] begründete und als herrschend geltende Meinung[3] stimmt der Rechtsprechung zu. So interpretiert Karsten Schmidt[4] das Urteil nicht nur als Bruch mit der Rechtsprechung aus dem Jahr 1966 sondern gleichzeitig als Fortführung des in RGZ 10, 301, und 15, 121, dargelegten Haftungsregimes, das eine ebenso strenge Mitgesellschafterhaftung für den Fall von Patent- und Markenrechtsverletzungen vorsah. Scharf angegriffen („Schauermär“) wird er dabei von Flume[5], der seine ablehnende Haltung an einem Umkehrschluss zu § 831 BGB festmacht: Die persönliche Haftung für ein fremdes Delikt dürfe keine Person treffen, die mit ihrem eigenen Verschulden gar nicht am deliktischen Schaden beteiligt war. Auch Canaris[6] warnt davor, über Analogien zu §§ 31 BGB, 128 HGB die in §§ 278, 831 BGB getroffene gesetzgeberische Grundentscheidung zu konterkarieren. Altmeppen[7] schließlich beschränkt ebenso wie Schäfer[8] den Kreis der Haftenden auf den Handelnden und die Gesellschaft und führt die von der herrschenden Meinung vorgebrachte Idee der Analogien-Aneinanderreihung auf historisch bedingte Mängel bei der Abstimmung zwischen § 31 BGB und § 128 HGB zurück.[9] Gegen die von der Rechtsprechung vorgebrachten Wertungsargumente spreche zudem die „Grundüberzeugung (…), dass niemand persönlich für ein fremdes Delikt einstehen muss, weil dies dem Wesen der deliktischen Haftung krass widerspricht“[10].
B. Stellungnahme
Geben in ähnlich gelagerten Streitfällen, in denen sich Analogie und Umkehrschluss gegenüberstehen, die übrigen der juristischen Methodik zur Verfügung stehenden Auslegungsarten häufig den Ausschlag in die eine oder andere Richtung, so vermochten es in der dargestellten Problematik bisher weder Rechtsprechung noch Schrifttum, ein zwingendes Argument in die Waagschale zu werfen, dass dem Gewicht der zitierten Stimmen gerecht geworden wäre.
Zwar ließe sich zunächst an eine klassische Überlegenheit des von der Rechtsprechung ins Feld geführten, systematisch einleuchtenden und mit Wertungsgesichtspunkten unterstützten Wortlautargumentes gegenüber der vornehmlich historisch und teleologisch orientierten Auslegung der Gegenansicht denken.[11] Allerdings darf die Macht der Gewohnheit, mit der mittlerweile für fast alle Personengesellschaften § 31 BGB entsprechend angewandt wird, nicht den Blick darauf verstellen, dass das Haftungsmodell des BGH eben nicht unmittelbar auf dem Gesetzeswortlaut, sondern auf einer Analogiebildung beruht. Zurecht weist Canaris darauf hin, dass es der Mindermeinung nicht um eine teleologische Reduktion geht, sondern um die Eindämmung dieser Analogie, und entsprechend die Begründungslast bei der herrschenden Ansicht liegt.[12] Folglich ist auch das historisch begründete Argument der Mindermeinung an dieser Stelle nicht so unterlegen wie es auf den ersten Blick erscheint. Was der herrschenden Meinung freilich bleibt, ist der Gegeneinwand, dass an Gesetzessystematik und jüngsten dogmatischen Revolutionen im Personengesellschaftsrecht gerade auch für diesen Fall die Abkoppelung der aktuellen Rechtsentwicklung von den Vorstellungen des Gesetzgebers des 19. Jahrhunderts abzulesen sei. Letztlich suchen beide Seiten ihre stärksten Argumente im Schutzzweck, auf teleologischer Ebene und in Wertungen zu verankern – mit dem Ergebnis, dass sich beide Seiten auf jeweils ganz herrschende Rechtsprinzipien, den Gedanken der akzessorischen Gesellschafterhaftung einerseits und das Dogma der unzulässigen Haftung für fremdes Verschulden andererseits, zurückziehen können.
[...]
* LL.M. (Vanderbilt), Rechtsanwalt in Frankfurt am Main.
[1] Bestätigt in BGH WM 2007, 1530, 1532.
[2] Ulmer, ZIP 2001, 585, 597.
[3] Grunewald, Gesellschaftsrecht, 7. Aufl. (2008), Kap. 1.A., Rn. 115; Ulmer, ZIP 2003, 1113, 1114f.; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. (2002), S. 1804; Scholz, NZG 2002, 153, 162; differenzierend Klerx, NJW 2004, 1907.
[4] K. Schmidt, NJW 2003, 1897, 1900.
[5] Flume, DB 2003, 1775.
[6] Canaris, ZGR 2004, 69, 109ff.
[7] Altmeppen, NJW 1996, 1017, 1019ff. und 2003, 1553.
[8] Schäfer, NJW 2003, 1225, 1227ff.
[9] Altmeppen, NJW 2003, 1553, 1556.
[10] Altmeppen, NJW 2003, 1553, 1557.
[11] Worauf offenbar Canaris (ZGR 2004, 69, 114) Bezug nimmt, wenn er vor dem „Sog der einfachen Rechtskonstruktion“ warnt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text behandelt die Frage der deliktischen Haftung von GbR-Mitgesellschaftern, insbesondere im Kontext von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) und unterschiedlichen Meinungen in der juristischen Literatur.
Was ist das Hauptproblem, das diskutiert wird?
Das Hauptproblem ist die Frage, ob und inwieweit Mitgesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) für deliktische Handlungen eines anderen Gesellschafters haften, insbesondere ob eine persönliche Haftung der Mitgesellschafter für fremdes Verschulden vorliegt.
Welche unterschiedlichen Meinungen werden in Bezug auf die Haftung von GbR-Mitgesellschaftern dargestellt?
Es werden zwei Hauptmeinungen dargestellt: Die herrschende Meinung, die sich auf die Rechtsprechung des BGH stützt und eine Mitgesellschafterhaftung bejaht, und eine Mindermeinung, die eine solche Haftung ablehnt. Die herrschende Meinung argumentiert mit Analogien zu §§ 31 BGB und 128 HGB und dem Schutz des Geschädigten, während die Mindermeinung auf das Dogma der unzulässigen Haftung für fremdes Verschulden und die Wertung des § 831 BGB verweist.
Was sind die Kernargumente der herrschenden Meinung?
Die herrschende Meinung argumentiert, dass die Mitgesellschafter Einfluss auf die Auswahl und Tätigkeit des handelnden Gesellschafters haben und dass der Geschädigte schutzwürdig ist, da er keinen Einfluss auf die Auswahl seines Gläubigers hat. Sie stützt sich auf Analogien zu §§ 31 BGB und 128 HGB und sieht darin eine Fortführung einer strengen Mitgesellschafterhaftung, wie sie bereits in früheren Entscheidungen des Reichsgerichts (RGZ) zum Ausdruck kam.
Was sind die Kernargumente der Mindermeinung?
Die Mindermeinung argumentiert, dass eine persönliche Haftung für fremdes Delikt gegen das Wesen der deliktischen Haftung verstößt und dass die Analogien zu §§ 31 BGB und 128 HGB die in §§ 278, 831 BGB getroffene gesetzgeberische Grundentscheidung konterkarieren. Sie betont, dass niemand persönlich für ein fremdes Delikt einstehen muss, wenn er nicht selbst am deliktischen Schaden beteiligt war.
Welche Rolle spielen die Paragraphen 31 BGB und 128 HGB in der Diskussion?
§ 31 BGB (Haftung für Organe) und § 128 HGB (Haftung der Gesellschafter) werden analog angewendet, um die Haftung der Mitgesellschafter zu begründen. Die herrschende Meinung sieht darin eine Möglichkeit, die Verbindlichkeit der Gesellschaft auch auf die einzelnen Gesellschafter auszudehnen, während die Mindermeinung diese Analogien kritisiert.
Welche methodischen Probleme werden bei der Auslegung des Gesetzes angesprochen?
Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl Analogie als auch Umkehrschluss in der Argumentation verwendet werden und dass es schwierig ist, ein zwingendes Argument zu finden, das dem Gewicht der unterschiedlichen Meinungen gerecht wird. Beide Seiten berufen sich auf Rechtsprinzipien, nämlich die akzessorische Gesellschafterhaftung und das Dogma der unzulässigen Haftung für fremdes Verschulden.
Welche Autoren werden im Text zitiert und welche Positionen vertreten sie?
Es werden verschiedene Autoren zitiert: Ulmer (befürwortet die Rechtsprechung des BGH), Karsten Schmidt (interpretiert das Urteil als Fortführung einer strengen Mitgesellschafterhaftung), Flume (kritisiert die Rechtsprechung scharf), Canaris (warnt vor der Konterkarierung gesetzgeberischer Grundentscheidungen), Altmeppen und Schäfer (beschränken den Kreis der Haftenden auf den Handelnden und die Gesellschaft).
Welche Schlussfolgerung wird im Text gezogen?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass es schwierig ist, ein eindeutiges Argument für eine der beiden Meinungen zu finden, da beide Seiten auf etablierte Rechtsprinzipien und Wertungen zurückgreifen können. Die Analyse deutet an, dass eine klare Antwort auf die Frage der Mitgesellschafterhaftung weiterhin umstritten ist.
- Quote paper
- Cornelius Bader (Author), 2010, Ökonomische Analyse der Gesellschafterhaftung aus § 128 HGB und § 31 BGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159506