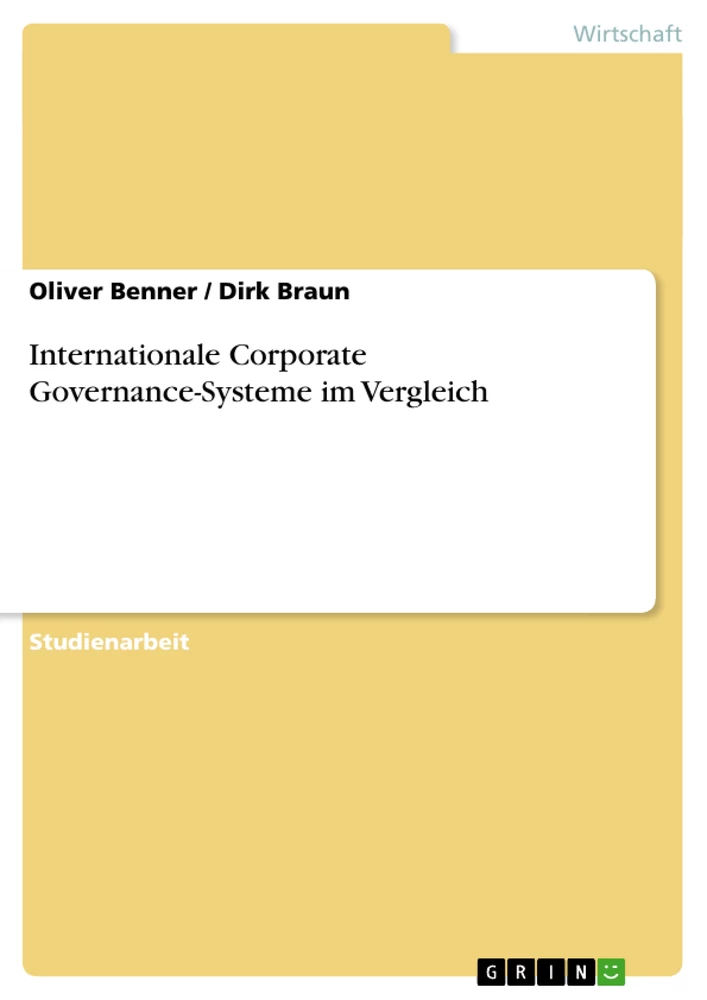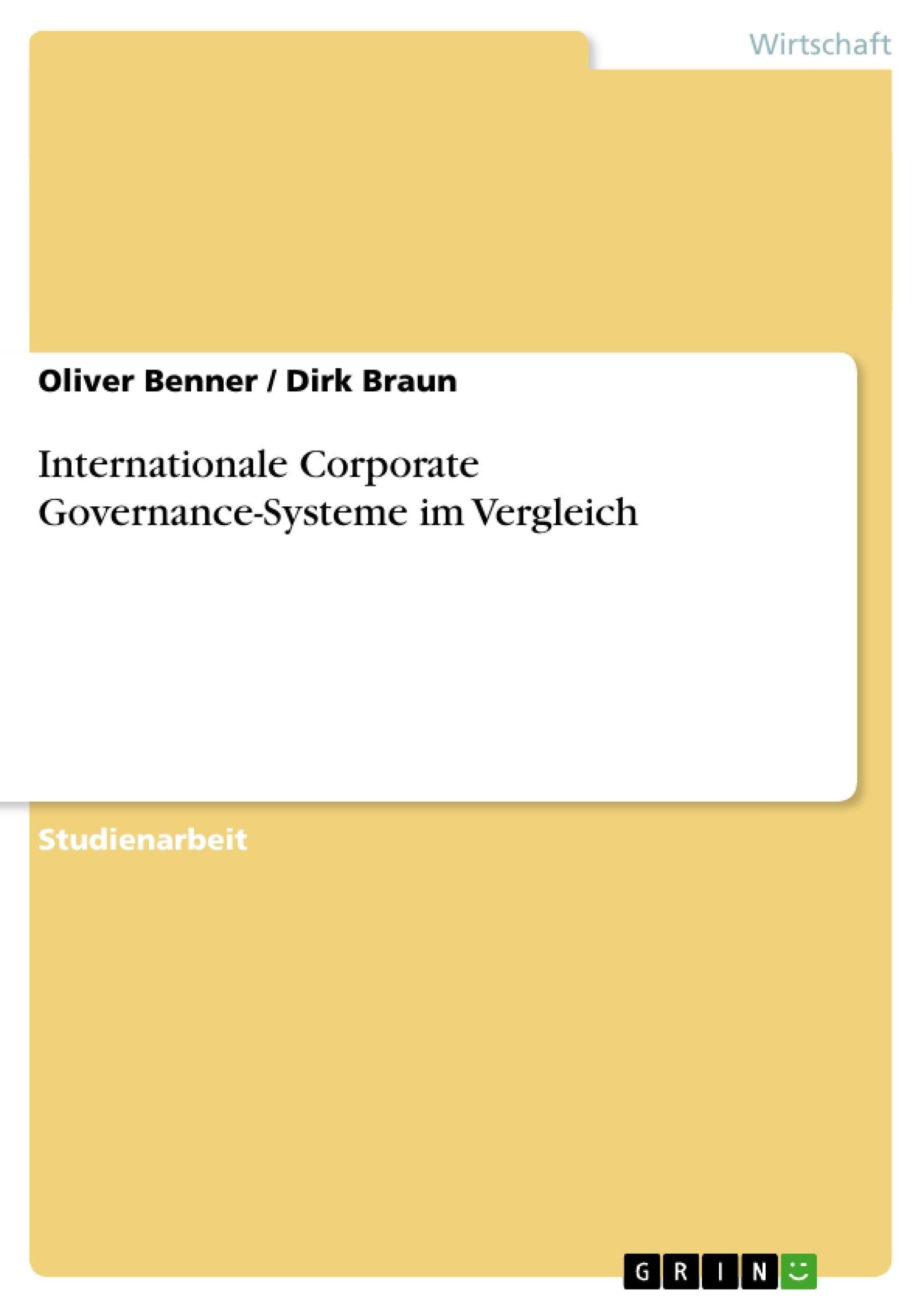Kaum ein Thema wird aktuell in den Finanzmärkten so intensiv diskutiert, wie das der Corporate Governance. Täglich liefert die aktuelle Tages- und Wirtschaftspresse neue Schlagzeilen im Zusammenhang mit Fragestellungen der Corporate Governance. So lautet bspw. eine Überschrift der Süddeutschen Zeitung vom 19. Mai 2003 „Cromme-Kommission plant Veröffentlichungspflicht – Jeder einzelne Vorstand soll Bezüge nennen“. Im Rahmen der öffentlichen Diskussion werden besonders die Bezüge sowie die Möglichkeiten einer wirksamen Kontrolle des Managements thematisiert. Problematik und Relevanz des Themas lassen sich am Besten anhand eines Fallbeispiels aus der nahen Vergangenheit skizzieren.
Fallbeispiel: Bremer Vulkan Verbund AG1 Im Jahr 1987 hatte die in Bremen ansässige Vulkan-Werft mit 11.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 1,5 Mrd. DM einen Fehlbetrag von 179 Mio. DM erwirtschaftet; das Grundkapital betrug 150 Mio. DM. Eine Rettung des Unternehmens war nur durch hohe staatliche Subventionen seitens des Bundes und des Landes Bremen möglich. Zum 1. November 1987 wurde der bis zu diesem Zeitpunkt für Wirtschaft und Außenhandel zuständige Senatsdirektor Bremens, ein SPD-Mitglied, zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. In den folgenden sechs Jahren wuchs die Werftengruppe, sehr zur Freude führender Kräfte in der Bremer Politik, durch zahlreiche Zukäufe zu einem großen Technologie- und Industriekonzern heran. Der Bremer Vulkan Verbund umfasste zuletzt 89 Firmen in einem Konglomerat von Werften, Reedereien, Maschinenbauunternehmen, Elektronikfirmen, Dienstleistungsunternehmen und Produzenten militärischer Güter. Durch den Aufbau neuer Standbeine sollten die Risiken des ertragsschwachen Schiffbaus durch gezielte Diversifikation reduziert werden.
Aber auch das Kerngeschäft wurde ausgedehnt. Durch den Zukauf mehrerer Werften wurde der Konzern zum größten deutschen Schiffbauer und übernahm im Zuge der Wiedervereinigung mehrerer ostdeutsche Werften mit bedeutender Finanzhilfe der Treuhandanstalt.
Anfänglich konnte der Vorstandsvorsitzende Erfolge mit seinem Vorgehen vorweisen. Die Schwächen des eilig zusammengekauften Firmenkonglomerats wurden aber immer deutlicher.
[...]
1 Vgl. Schneider (2000), S. 9; Capital Heft 4, 1996, S. 40-60; FAZ Nr. 47 v. 24.02.1996, S. 13; Wirtschaftswoche Nr. 27 v. 27.06.1996, S. 44-45; Nr. 14 v. 28.03.1996, S. 8-9; Nr. 9 v. 22.02.1996, S. 38-41.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Corporate Governance
- Die Interessengruppen eines Unternehmens
- Theoretische Modelle der Corporate Governance
- Shareholder Value-Ansatz
- Mitbestimmungsansatz
- Stakeholder Value-Ansatz
- Corporate Governance Systeme im internationalen Vergleich
- Aufsichtsratmodell (two tier-system) am Beispiel Deutschlands
- Board-Modell (one tier-System) am Beispiel der USA
- Verwaltungsratsystem am Beispiel der Schweiz
- Das japanische Modell der Corporate Governance
- Wettbewerb der Corporate Governance Systeme
- Konvergenz der Corporate Governance Systeme
- Dominanz eines Corporate Governance-Systems
- Fortbestand inhaltlich unterschiedlicher Corporate Governance-Systeme
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Corporate Governance und beleuchtet deren Bedeutung im internationalen Kontext. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Modelle und Systeme der Corporate Governance zu vermitteln und deren Einfluss auf die Unternehmenssteuerung und -entwicklung zu untersuchen.
- Definition und Entwicklung des Begriffs der Corporate Governance
- Analyse der wichtigsten Interessengruppen und deren Ziele innerhalb von Unternehmen
- Vorstellung und Vergleich verschiedener theoretischer Modelle der Corporate Governance
- Untersuchung der Corporate Governance Systeme im internationalen Vergleich
- Analyse des Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Corporate Governance Systemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Corporate Governance ein und erläutert deren Relevanz anhand eines Fallbeispiels. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs der Corporate Governance und seiner Entwicklung. Kapitel 3 stellt die wichtigsten Interessengruppen eines Unternehmens vor und erläutert deren Ziele und Interessen. In Kapitel 4 werden verschiedene theoretische Modelle der Corporate Governance dargestellt, darunter der Shareholder Value-Ansatz, der Mitbestimmungsansatz und der Stakeholder Value-Ansatz. Kapitel 5 befasst sich mit dem internationalen Vergleich der Corporate Governance Systeme. Hier werden das Aufsichtsratmodell (two tier-system), das Board-Modell (one tier-System), das Verwaltungsratsystem sowie das japanische Modell der Corporate Governance vorgestellt und analysiert. Kapitel 6 schließlich beleuchtet den Wettbewerb der Corporate Governance Systeme und diskutiert die Konvergenz, Dominanz und den Fortbestand inhaltlich unterschiedlicher Systeme.
Schlüsselwörter
Corporate Governance, internationale Unternehmensführung, Shareholder Value, Stakeholder Value, Aufsichtsratmodell, Board-Modell, Verwaltungsratsystem, Japanisches Modell, Konvergenz, Wettbewerb.
- Quote paper
- Oliver Benner (Author), Dirk Braun (Author), 2003, Internationale Corporate Governance-Systeme im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15949