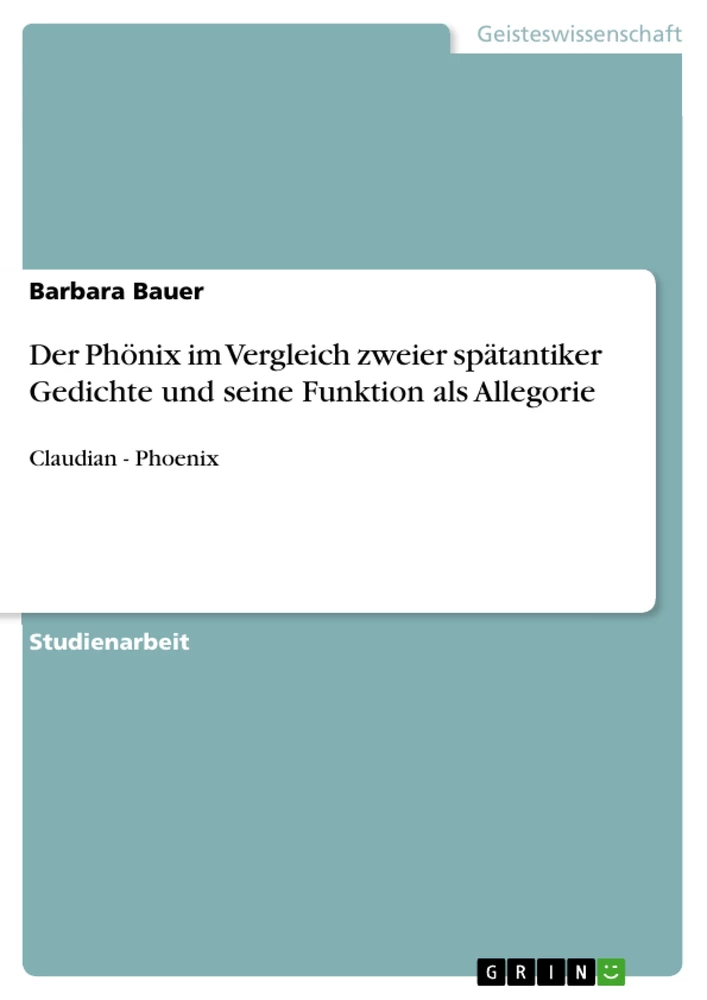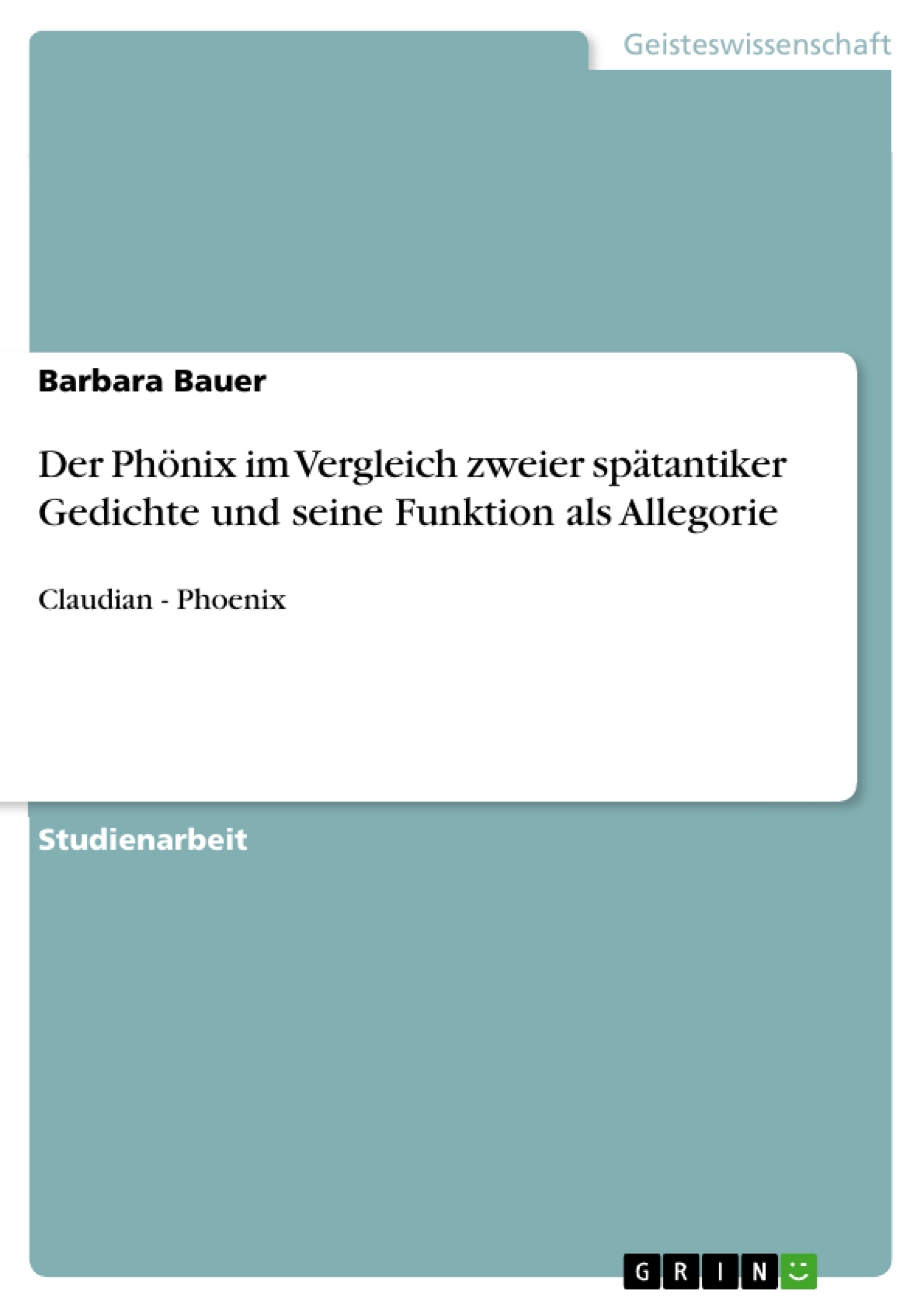Der Mythos um den wunderbaren Vogel Phoenix, der sein Leben immer wieder nach Ablaufen einer bestimmten Zeitspanne auf einem Scheiterhaufen verbrennt und aus seiner Asche neu entsteht, verdeutlicht grundlegende Sehnsüchte der Menschen. Das Überwinden von zeitlichen Grenzen, das Erlangen einer zweiten Chance oder das Leben noch einmal neu beginnen zu dürfen, wie es schon der bekannte Ausdruck „wie ein Phoenix aus der Asche“ andeutet. Seit jeher schwirren diese Vorstellungen in den Köpfen der Menschen und umso leichter konnte sich der Mythos des Phoenix verbreiten und entwickeln. Sucht man in den Werken griechischer und römischer Autoren, stößt man auf eine Vielzahl von Erwähnungen, in denen der ägyptische Vogel „als Sinnbild des sich durch den Tod erneuernden Lebens“ übernommen wurde. Wie der Name Phoenix im Griechischen genau zu verstehen war, ist schwierig, da er drei verschiedene Bedeutungen hat: „Purpur, Phönikier, Dattelpalme“ ; so kann er sich beispielsweise aus überlieferten Elementen des Mythos erschlossen haben. Als grundlegendes klassisches Zeugnis des Vogels gilt dessen Darstellung in seinen Historien des Herodot, der selbst ein Bild des Vogels in Heliopolis gesehen haben will und hierauf die Aussagen der Einwohner (wj Hliopolitai legousi) schildert: Der Vogel käme alle 500 Jahre aus Arabien, wenn sein Vater stirbt (foitan de tote fasi, epean oi apoqanh o pathr); diesen bringe er eingehüllt in einem Ei aus Myrrhe zur Bestattung in das Heiligtum des Helios (qaptein en tou Hliou tw irw). In seiner Gestalt sei er wohl einem Adler am ähnlichsten sowie von roter und goldener Farbe (Hdt. 73). Seinem Bericht folgten im Großen und Ganzen nachfolgende Schriftsteller, die sich mit dem Phoenix befassten; Details des Mythos wurden aber immer wieder verändert und neu ausgestaltet. Hierzu zählen unter anderem Autoren wie Tacitus, Plinius der Ältere, Pomponius Mela, Ovid und Philostratus.
In meiner Arbeit werden ich mich mit zwei spätantiken Gedichten über den Phoenix befassen, PHOENIX von Claudius Claudianus (c.m. 27) sowie DE AVE PHOENICE von L. Caelius Firmianus Lactantius, an dem sich Claudian wohl orientiert hat. Inwieweit es sich hier um eine imitatio oder aemulatio - oder gar um beides - handelt, oder ob sich Claudian bewusst von seinem Vorbild distanziert, wird im Folgenden ersichtlich werden. Neben der Frage, wie diese den Mythos ausgearbeitet haben, werde ich besonders auf den Phoenix als Allegorie eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- STAND DER FORSCHUNG
- DE AVE PHOENICE VON LAKTANZ
- Gliederung und Paraphrase
- Gattungsmerkmale
- PHOENIX VON CLAUDIAN
- Gliederung und Paraphrase
- Gattungsmerkmale
- VERGLEICH IN DER AUSGESTALTUNG EINZELNER ELEMENTE
- Die Heimat des Phoenix
- Der Vogel Phoenix
- Sterben und Wiedergeburt
- Die Sonnensymbolik
- DER PHOENIX ALS ALLEGORIE
- Laktanz
- Die Entwicklung christlicher lateinischer Literatur
- Betonung der Gottesnähe und der Verehrung
- Christliche Aspekte des Sterbens und der Auferstehung
- Der Phoenix als christliche Allegorie
- Claudian
- Politische Aspekte
- Die Metamorphose als Übertragung der dicio
- Der Phoenix als Allegorie für das Imperium Romanum
- Die Beständigkeit und Vormacht Roms
- Laktanz
- FAZIT: CLAUDIANS GEDICHT ALS AEMULATIO
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit zwei spätantiken Gedichten über den Phönix, "PHOENIX" von Claudius Claudianus und "DE AVE PHOENICE" von L. Caelius Firmianus Lactantius. Ziel ist es, die beiden Gedichte im Hinblick auf ihre Gestaltung des Phönix-Mythos sowie deren allegorische Funktion zu analysieren. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob es sich bei Claudians Gedicht um eine Imitatio oder Aemulatio von Laktanzs Werk handelt.
- Der Phönix-Mythos in der Spätantike
- Allegorische Interpretation des Phönix
- Vergleichende Analyse der beiden Gedichte
- Die Rolle der Aemulatio in Claudians Werk
- Die Bedeutung des Phönix als Symbol für Erneuerung und Beständigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik und stellt den Phönix-Mythos in seiner historischen Entwicklung dar. Im zweiten Kapitel wird der Forschungsstand zum Gedicht "DE AVE PHOENICE" von Laktanz beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse des Laktanz-Gedichts, wobei die Gliederung und Paraphrase sowie die Gattungsmerkmale im Vordergrund stehen. Das vierte Kapitel analysiert das Gedicht "PHOENIX" von Claudian in gleicher Weise. Das fünfte Kapitel vergleicht die beiden Gedichte in ihrer Ausgestaltung einzelner Elemente, wie z. B. der Heimat des Phönix, der Darstellung des Vogels selbst sowie des Sterbens und der Wiedergeburt. Das sechste Kapitel untersucht den Phönix in seiner Funktion als Allegorie, sowohl im Laktanz- als auch im Claudian-Gedicht. Hierbei werden die jeweiligen Interpretationen im Hinblick auf christliche und politische Aspekte betrachtet. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und beleuchtet Claudians Gedicht als Aemulatio von Laktanzs Werk.
Schlüsselwörter
Phönix, Allegorie, Spätantike, Laktanz, Claudian, DE AVE PHOENICE, PHOENIX, Imitatio, Aemulatio, Erneuerung, Beständigkeit, Christentum, Politik, Imperium Romanum, Gattungsmerkmale, Vergleichende Analyse
- Quote paper
- Barbara Bauer (Author), 2010, Der Phönix im Vergleich zweier spätantiker Gedichte und seine Funktion als Allegorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159188