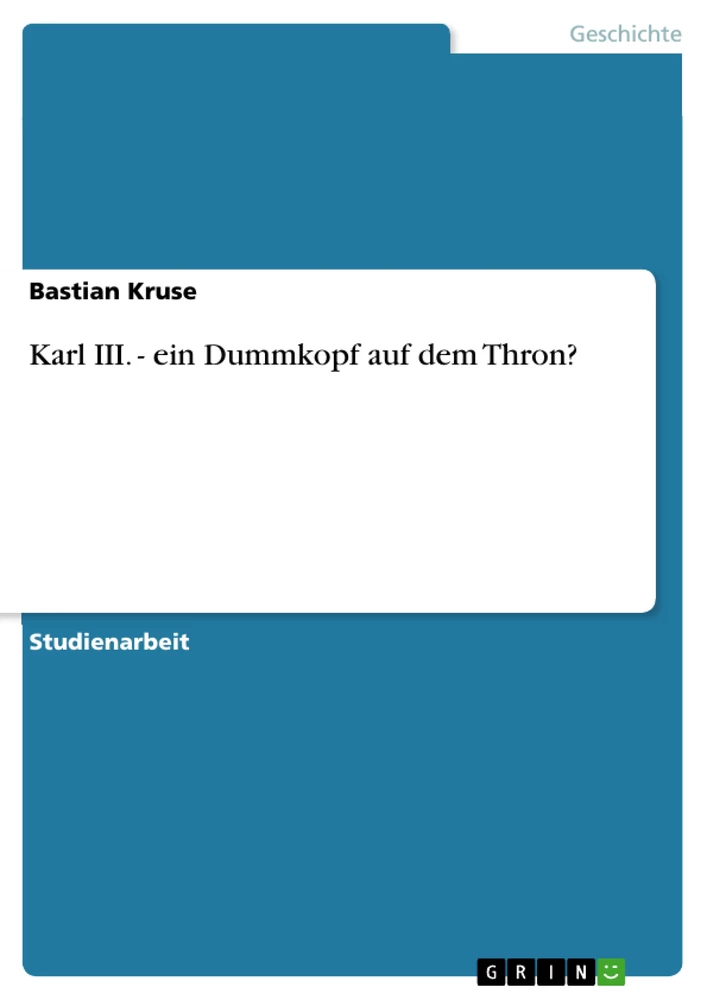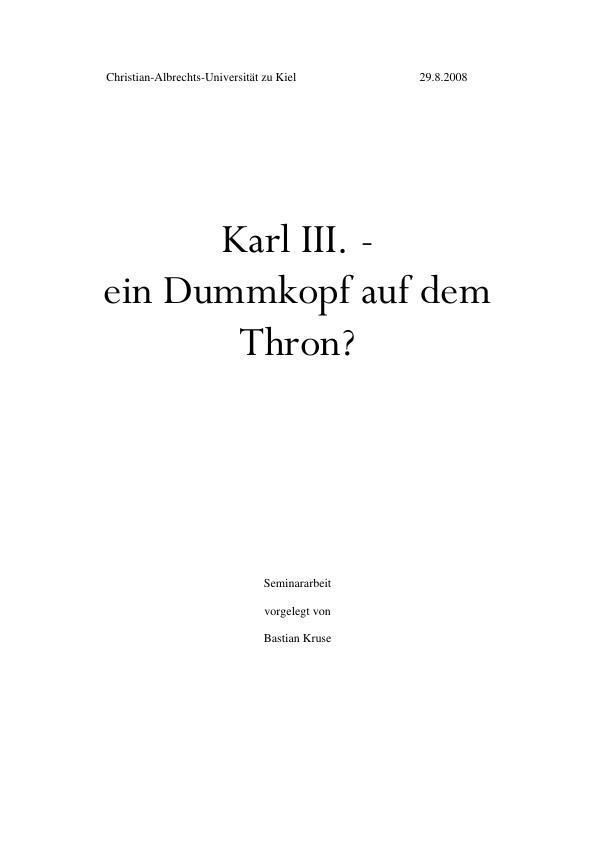Gegen Ende der Herrschaftszeit der karolingischen Dynastie und kurz nachdem das alte Reich Karls des Großen zum letzten Mal für kurze Zeit in einer Hand (nämlich der Karls des Dicken) vereinigt war, ging die Königskrone in Westfranken an ein Kind, das spätere Geschichtsschreiber Karl „den Einfältigen“ nannten. Karl III., der Sohn Ludwigs des Stammlers und zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung noch minderjährig, musste sich während seiner Regentschaft veränderter Machtverhältnisse in seinem Land sowie ernstzunehmender Feinde von innen und außen erwehren. Doch schon durch die Namenswahl stellte seine Familie einen Anspruch auf Legitimität, einen Anspruch auf die Regentschaft nicht nur in West-, sondern auch in Ostfranken.
Durch den Beinamen „der Einfältige“ erhält Karls Regentschaft einen negativen Beigeschmack. Es gilt zu überprüfen, ob Karl wirklich ein schlechter Herrscher war, womöglich tatsächlich ein Dummkopf auf dem Thron. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Karl III. von Westfranken ein gescheiterter Herrscher war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Karl III. – Vom Kindkönig zum Verratenen
- Der Kampf um das Königtum
- Die Regierungszeit: Veränderung der Machtverhältnisse und der Griff nach Lothringen
- Die Niederlage gegen die Robertiner
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Regierungszeit Karls III. von Westfranken und befasst sich mit der Frage, ob er als gescheiterter Herrscher einzustufen ist. Die Arbeit analysiert seine Machtergreifung, seine Regierungszeit im Kontext veränderter Machtverhältnisse und Konflikte, sowie den Verlust seines Königtums.
- Karls III. Aufstieg zum König und die Legitimitätsfrage
- Die instabile Machtbasis Karls III. und seine Abhängigkeit von adligen Familien
- Die Konflikte mit Odo und den Robertinern
- Karls III. Bestrebungen in Lothringen
- Der Sturz Karls III. im Jahr 923
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Beurteilung Karls III. als Herrscher. Sie benennt die verwendeten Quellen, darunter die Annales Vedastini, die Chronik Reginos von Prüm und die Historia Remensis Ecclesiae von Flodoard, und erläutert deren jeweilige Vor- und Nachteile. Die methodische Vorgehensweise, eine chronologische Betrachtung der Ereignisse, wird ebenfalls skizziert. Die Arbeit zielt darauf ab, die Frage nach Karls Erfolg oder Misserfolg als König anhand einer umfassenden Analyse seiner Regierungszeit zu beantworten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf seiner Machtergreifung und den politischen und militärischen Herausforderungen seiner Herrschaft.
Karl III. - vom Kindkönig zum Verratenen: Dieses Kapitel gliedert sich in drei Unterkapitel. Das erste Unterkapitel befasst sich mit dem Kampf um das Königtum nach dem Tod Karls des Dicken. Hier wird detailliert dargestellt, wie Karl trotz seiner Minderjährigkeit und der Vorbehalte der Mächtigen zum König erhoben wurde und wie er in Abhängigkeit von mächtigen adligen Familien stand. Die instabile Machtbasis Karls und seine strategischen Bündnisse werden beleuchtet. Das zweite Unterkapitel fokussiert auf die Veränderungen in den Machtverhältnissen während seiner Regierungszeit, den Konflikt mit Robert von Neustrien und seine Ambitionen in Lothringen. Es wird gezeigt, wie Karl trotz Bemühungen um diplomatische Lösungen in ständige militärische Auseinandersetzungen verwickelt war. Das dritte Unterkapitel beleuchtet die letztendliche Niederlage Karls gegen die Robertiner und seinen Sturz im Jahr 923. Es wird die Frage nach den Ursachen für sein Scheitern thematisiert und der Verlust seines Königtums eingeordnet. Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Faktoren, die zu Karls schwacher Position beitrugen, die Herausforderungen seiner Herrschaft und die Gründe für seine Niederlage.
Schlüsselwörter
Karl III., Westfranken, Kindkönig, Robertiner, Odo, Lothringen, karolingische Dynastie, Legitimität, Machtverhältnisse, mittelalterliches Königtum, Annales Vedastini, Regino von Prüm, Flodoard.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Karl III. – Vom Kindkönig zum Verratenen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Regierungszeit Karls III. von Westfranken und analysiert, ob er als gescheiterter Herrscher einzustufen ist. Sie befasst sich mit seiner Machtergreifung, seiner Herrschaft im Kontext veränderter Machtverhältnisse und Konflikte, sowie seinem Verlust des Königtums.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Karls III. Aufstieg zum König und die Legitimitätsfrage, seine instabile Machtbasis und Abhängigkeit von adligen Familien, die Konflikte mit Odo und den Robertinern, seine Bestrebungen in Lothringen und seinen Sturz im Jahr 923.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Seminararbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter die Annales Vedastini, die Chronik Reginos von Prüm und die Historia Remensis Ecclesiae von Flodoard. Die Arbeit erläutert jeweils die Vor- und Nachteile dieser Quellen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel über Karl III., und ein Fazit. Das Hauptkapitel unterteilt sich in drei Unterkapitel: den Kampf um das Königtum, die Regierungszeit mit Veränderungen der Machtverhältnisse und den Griff nach Lothringen, sowie die Niederlage gegen die Robertiner.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt eine chronologische Betrachtung der Ereignisse, um die Frage nach Karls Erfolg oder Misserfolg als König zu beantworten. Besonderes Augenmerk liegt auf seiner Machtergreifung und den politischen und militärischen Herausforderungen seiner Herrschaft.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die Forschungsfrage nach der Beurteilung Karls III. als Herrscher und benennt die verwendeten Quellen und deren Vor- und Nachteile. Sie beschreibt die methodische Vorgehensweise (chronologische Betrachtung) und das Ziel der Arbeit: die Beantwortung der Frage nach Karls Erfolg oder Misserfolg anhand einer umfassenden Analyse seiner Regierungszeit.
Was ist der Inhalt des Kapitels über Karl III.?
Das Kapitel "Karl III. - vom Kindkönig zum Verratenen" gliedert sich in drei Unterkapitel. Das erste behandelt den Kampf um das Königtum nach dem Tod Karls des Dicken und Karls Abhängigkeit von adligen Familien. Das zweite fokussiert auf die Veränderungen der Machtverhältnisse, den Konflikt mit Robert von Neustrien und Karls Ambitionen in Lothringen. Das dritte beleuchtet die Niederlage gegen die Robertiner und seinen Sturz 923, inklusive der Ursachenanalyse seines Scheiterns.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Karl III., Westfranken, Kindkönig, Robertiner, Odo, Lothringen, karolingische Dynastie, Legitimität, Machtverhältnisse, mittelalterliches Königtum, Annales Vedastini, Regino von Prüm, Flodoard.
- Quote paper
- Bastian Kruse (Author), 2008, Karl III. - ein Dummkopf auf dem Thron?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159084