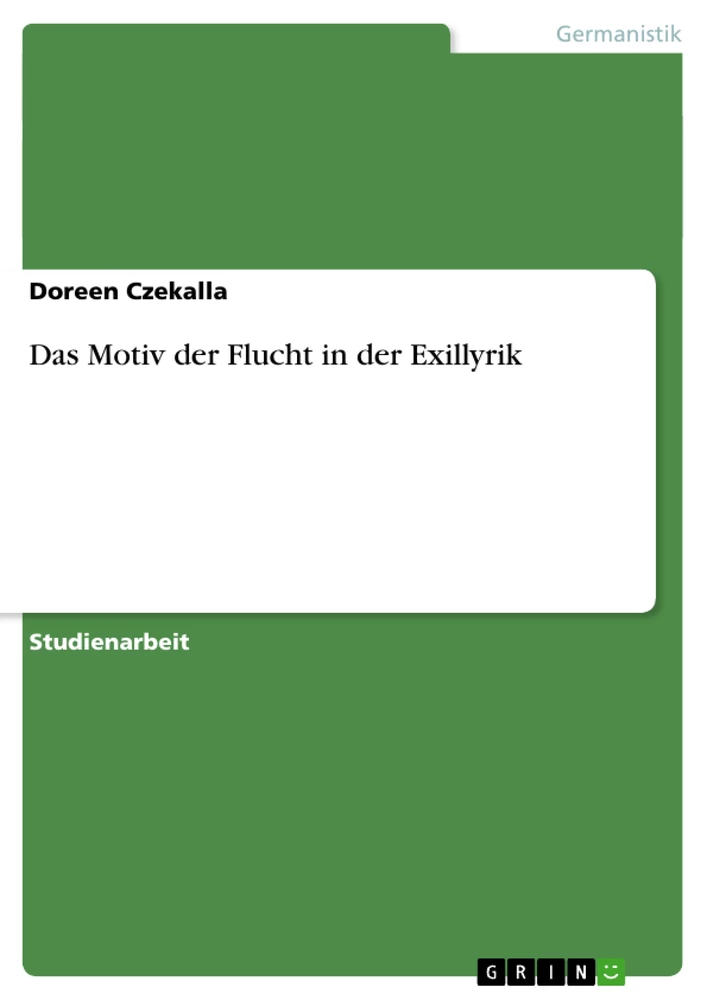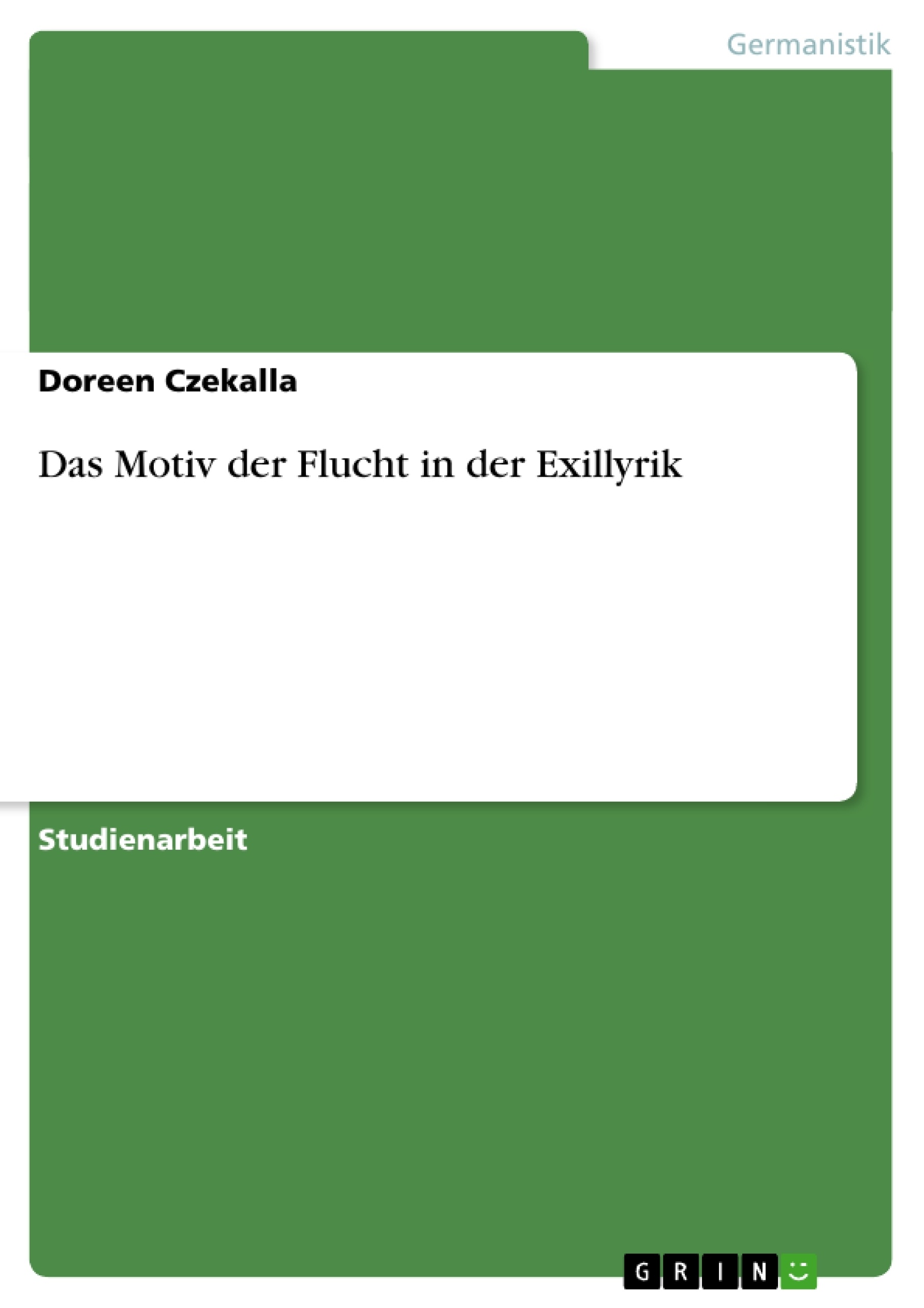„[I]n den ersten Minuten nach der Flucht war er nur ein Tier, das in die Wildnis ausbricht, die
sein Leben ist, und Blut und Haare klebten noch an der Falle. [...]Ein zweiter Anfall von
Angst, die Faust, die einem das Herz zusammendrückt. Jetzt nur kein Mensch sein, jetzt
Wurzeln schlagen, ein Weidenstamm unter Weidenstämmen, jetzt Rinde bekommen und
Zweige statt Arme. [...] Warum muß man gerade ein Mensch sein, und wenn schon einer,
warum gerade ich, Georg.“1 Ich habe dieses Zitate aus Anna Seghers Das Siebte Kreuz meiner
Arbeit vorangestellt, weil es widerspiegelt, was Flucht bedeutet. Die Flucht assoziiert die
ständige Angst und das Verfolgtwerden, das Verstecken und die Gefahr, vielleicht vor dem
drohenden Tod. Der Flüchtende muss in jeder Minute auf der Hut sein vor dem, wovor er
flieht, dass dieser ihn nicht entdeckt. Er möchte sich auflösen, unsichtbar machen oder, wie
Georg in Das siebte Kreuz, sich in eine Weide verwandeln. Das Flüchtlingsdasein ist ein
hastiges Leben von begrenzter Dauer zwischen zwei Welten: Dem Ort, von dem man
geflüchtet ist und dem Ort, an den man sich flüchtet und Rettung erhofft. Es ist eine Suche
und Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit, nach Ruhe und Rast von der erschöpfenden
Flucht.
Ich werde anhand ausgesuchter Gedichte von Paul Zech, Nelly Sachs, Berthold Viertel und
Max Herrmann-Neisse zeigen, wie diese Autoren das Thema Flucht lyrisch umsetzen. Hierbei
möchte ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede formaler und inhaltlicher Natur aufzeigen
und interpretieren. Ich bin mir bewusst, dass die ausgewählten Lyriker keine heterogene
Gruppe bilden, die man anhand je eines Gedichtes vergleichen kann. So verschieden die
Autoren sind und so verschieden ihr Werk ist, haben sie eines gemeinsam: Sie teilen das
Schicksal der vielen tausend Exilanten in den dreißiger und vierziger Jahren des 20.
Jahrhunderts und sie verbindet die Flucht vor dem Nationalsozialismus aus Deutschland
beziehungsweise Österreich.
Zuerst gehe ich in meiner Arbeit jeweils kurz auf die persönlichen Fluchterlebnisse des
Autors ein. Dann werde ich jedes Gedicht vorstellen, es formal und inhaltlich unter dem
Gesichtspunkt der Fluchtthematik analysieren und interpretieren. Am Schluss möchte ich
zusammenfassend vor allem die Gemeinsamkeiten der einzelnen Gedichte hervorheben und
das Problem des Ankommens nach der Flucht ansprechen.
1 Seghers: S. 23ff.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paul Zech: Aus meinem Haus, von Hab und Gut….
- Nelly Sachs: In der Flucht…
- Berthold Viertel: Der Gehetzte
- Max Herrmann-Neisse: Rast auf der Flucht
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und interpretiert die lyrische Umsetzung des Themas Flucht in ausgewählten Gedichten von Paul Zech, Nelly Sachs, Berthold Viertel und Max Herrmann-Neisse. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der formalen und inhaltlichen Darstellung der Fluchterfahrung im Kontext des Exils während der dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts.
- Das Motiv der Flucht in der Lyrik des Exils
- Die individuelle Fluchterfahrung der Dichter
- Formale und inhaltliche Analyse der Gedichte
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gedichte
- Das Problem des Ankommens nach der Flucht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Flucht und die Bedeutung der Flucht als zentrales Motiv in der Exilliteratur ein. Das erste Kapitel analysiert das Gedicht "Aus meinem Haus, von Hab und Gut..." von Paul Zech, das die Flucht aus Deutschland im Jahr 1933 thematisiert. Im zweiten Kapitel wird Nelly Sachs' Gedicht "In der Flucht..." untersucht, das die Angst und Unsicherheit der Flucht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zum Ausdruck bringt.
Schlüsselwörter
Exilliteratur, Flucht, Lyrik, Gedichtanalyse, Paul Zech, Nelly Sachs, Berthold Viertel, Max Herrmann-Neisse, Nationalsozialismus, Exil, Deutschland, Österreich, 1930er Jahre, 1940er Jahre.
- Quote paper
- Doreen Czekalla (Author), 2003, Das Motiv der Flucht in der Exillyrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15888