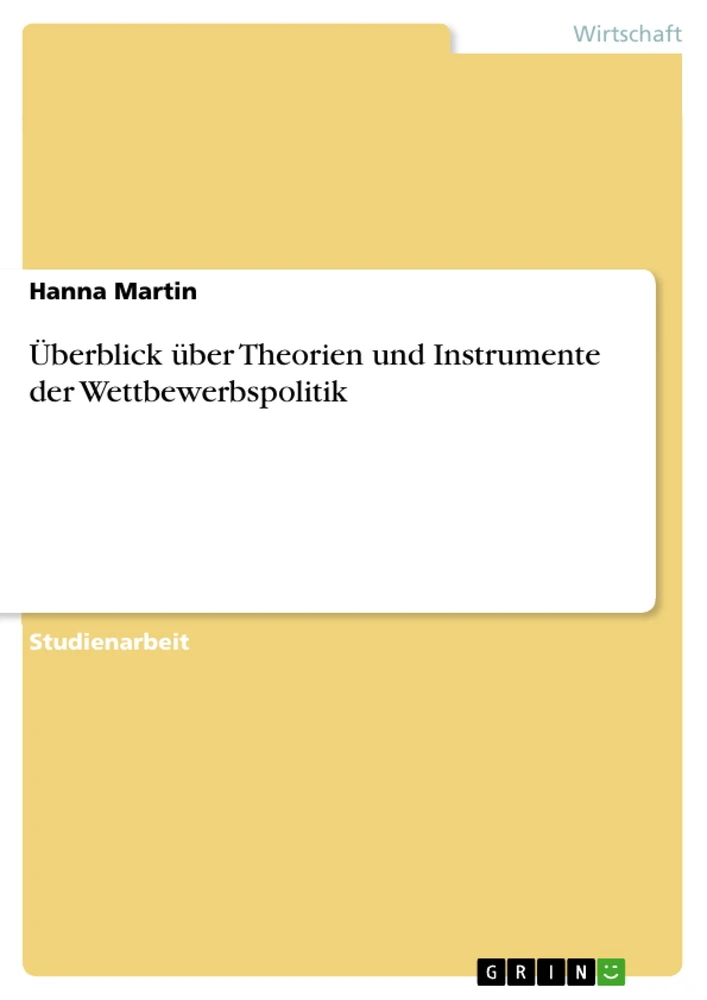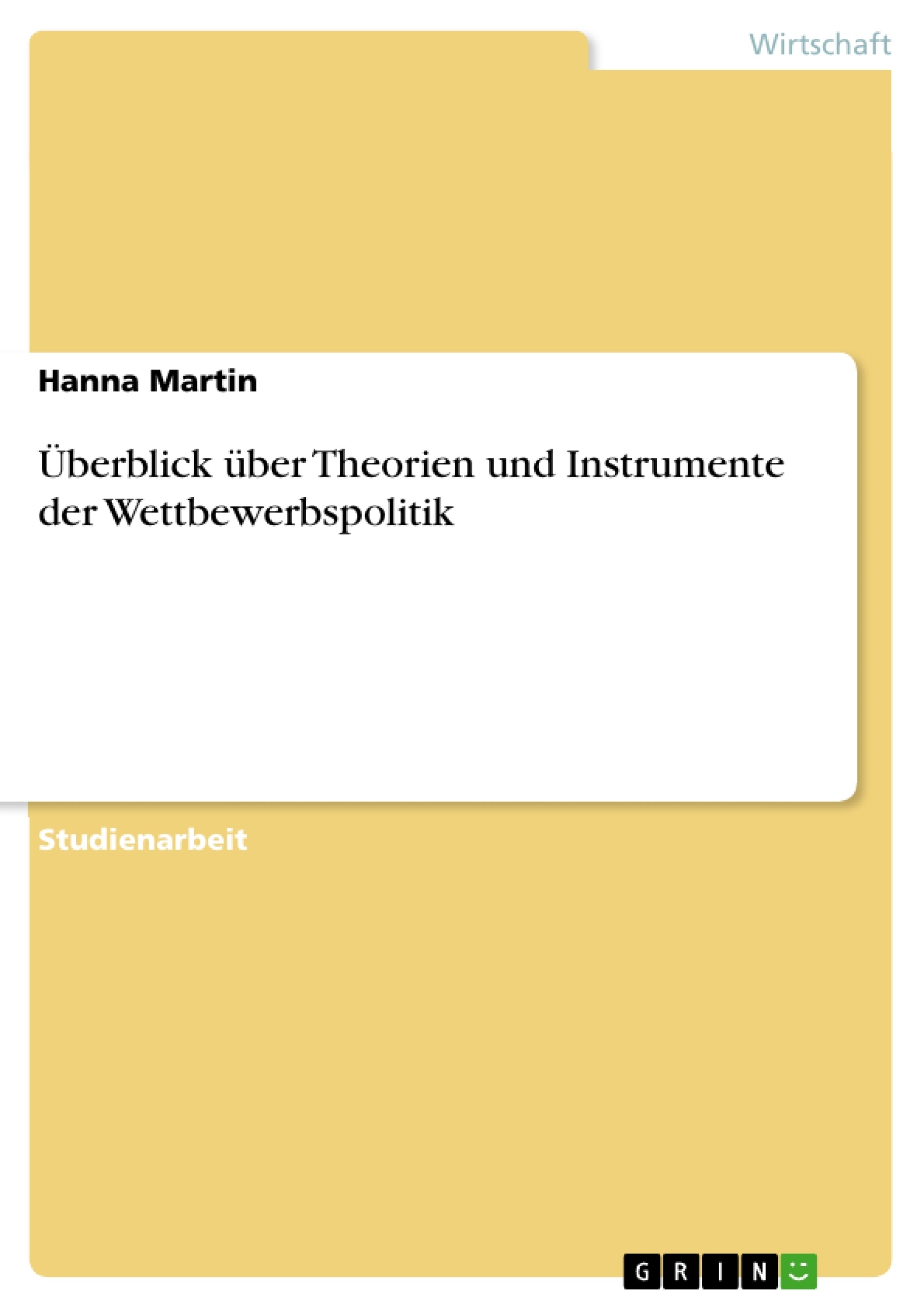Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit einem Überblick über Theorien und Instrumente der Wettbewerbspolitik. Unter Wettbewerbspolitik versteht man einen Teilbereich der Allokationspolitik. Ziel der Wettbewerbspolitik ist es, Kartelle (vertraglich geregelte Zusammenschlüsse rechtlich und organisatorisch
selbstständig bleibender Unternehmen zur Beschränkung oder Ausschaltung des Wettbewerbs (vgl.Paulick/Philipp 2005)und eine marktbeherrschende Stellung einzelner Unternehmen zu verhindern (vgl.
Bofinger 2007). Die Wettbewerbspolitik kann somit als Summe aller Maßnahmen des politischen Systems verstanden werden, die den Wettbewerb als wesentliches Element der Sozialen Marktwirtschaft sichern sollen. Die Wettbewerbspolitik ist notwendig, da Wettbewerb eine zentrale Voraussetzung für ein funktionsfähiges
marktwirtschaftliches System ist und dieser sich nicht von selbst einstellt, sondern durch Wettbewerbsbeschränkungen ständig gefährdet ist.
In der Seminararbeit werden zunächst die statische, dynamische und evolutorische Wettbewerbstheorie vorgestellt. Danach werden die daraus folgenden Leitbilder der vollständigen Konkurrenz, des
funktionsfähigen Wettbewerbs, der Wettbewerbsfreiheit und der Maximierung der Konsumentenwohlfahrt vorgestellt. Punkt vier erläutert Instrumente der Wettbewerbspolitik, die zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung von Wettbewerb verwendet werden. Daran anschließend werden Instrumente der Wettbewerbspolitik auf nationaler als auch auf europäischer Ebene dargestellt. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das einen kurzen Blick auf die Vergangenheit der Wettbewerbspolitik als auch auf gegenwärtige Probleme und Anforderungen gibt.
Bei der Wahl der Literatur stütze ich mich vorwiegend auf Rainer Klump (2006): Wirtschaftspolitik, Instrumente, Ziele, Institutionen. München: Pearson, auf Peter Bofinger (2007): Grundzüge der
Volkswirtschaftslehre, Eine Einführung in die Wissenschaft von Märkten, 2. Auflage. München: Pearson und auf Hermann May (2005): Ökonomie für Pädagogen, 12. Auflage. München: Oldenbourg, S. 261-271.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wettbewerbstheorien
- 2.1 Statische Wettbewerbstheorie
- 2.2 Dynamische Wettbewerbstheorie
- 2.3 Evolutorische Wettbewerbstheorie
- 3. Leitbilder der Wettbewerbspolitik
- 3.1 Vollständige Konkurrenz
- 3.2 Funktionsfähiger Wettbewerb
- 3.3 Wettbewerbsfreiheit
- 3.4 Maximierung der Konsumentenwohlfahrt
- 4. Instrumente der Wettbewerbspolitik
- 5. Einzelne Instrumente der Wettbewerbspolitik in Deutschland und Europa
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bietet einen Überblick über Theorien und Instrumente der Wettbewerbspolitik. Ziel ist es, die verschiedenen theoretischen Ansätze des Wettbewerbs zu beleuchten und die daraus resultierenden Instrumente zur Gestaltung und Aufrechterhaltung von Wettbewerb zu erklären. Die Arbeit betrachtet sowohl nationale als auch europäische Ebenen der Wettbewerbspolitik.
- Verschiedene Wettbewerbstheorien (statisch, dynamisch, evolutorisch)
- Leitbilder der Wettbewerbspolitik (vollständige Konkurrenz, funktionsfähiger Wettbewerb etc.)
- Instrumente der Wettbewerbspolitik
- Wettbewerbspolitik in Deutschland und Europa
- Zusammenhang zwischen Theorien und Instrumenten der Wettbewerbspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Wettbewerbspolitik ein und beschreibt deren Ziel, Kartelle und marktbeherrschende Stellungen zu verhindern, um ein funktionsfähiges marktwirtschaftliches System zu gewährleisten. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, der die Darstellung verschiedener Wettbewerbstheorien, Leitbilder und Instrumente beinhaltet, sowie deren Anwendung auf nationaler und europäischer Ebene. Die gewählte Literatur wird genannt.
2. Wettbewerbstheorien: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ansätze zur Beschreibung von Wettbewerb. Es beginnt mit der statischen Wettbewerbstheorie, die von gegebenen Marktbedingungen ausgeht und die Auswirkungen unterschiedlicher Marktstrukturen auf das Marktergebnis analysiert. Die dynamische Wettbewerbstheorie hingegen betont die ständigen Veränderungen der Marktbedingungen durch Innovationen, wobei temporäre Monopolgewinne als Anreiz für Innovationen dienen. Schließlich wird die evolutorische Wettbewerbstheorie vorgestellt, die den Wettbewerb als einen Such- und Entdeckungsprozess beschreibt, bei dem Unternehmen ständig nach neuen Marktchancen suchen und Lernprozesse eine wichtige Rolle spielen. Die Kapitel vergleicht die verschiedenen Ansätze und zeigt deren jeweilige Stärken und Schwächen.
2.1 Statische Wettbewerbstheorie: Dieser Abschnitt analysiert die Bedingungen auf Märkten, sowohl qualitativ (Marktvollkommenheit, Transparenz, Marktzutritt) als auch quantitativ (Anzahl der Anbieter und Nachfrager). Es werden Extremfälle wie Monopol und Polypol verglichen, um die Auswirkungen auf Marktergebnisse wie Güterversorgung und Marktpreise zu verdeutlichen. Die Analyse zeigt, wie unter vollständiger Konkurrenz die Grenzkosten mit dem Marktpreis übereinstimmen und wie der Eintritt neuer Anbieter den Marktpreis senkt. Das Kapitel schlussfolgert, dass vollständige Konkurrenz im Vergleich zu Monopol eine gesellschaftlich optimale Ressourcenallokation ermöglicht und Monopolgewinne verhindert.
2.2 Dynamische Wettbewerbstheorie: Im Gegensatz zur statischen Betrachtungsweise fokussiert sich dieser Teil auf die dynamischen Aspekte des Wettbewerbs, insbesondere auf Innovationen als treibende Kraft. Aufbauend auf Schumpeter wird argumentiert, dass Unternehmen permanent neue Produkte einführen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Pionierunternehmen erzielen temporäre Monopolgewinne als Entgelt für das Innovationsrisiko, die aber durch Nachahmerunternehmen wieder aufgezehrt werden. Dieser ständige Innovationszyklus verhindert ein stabiles Marktgleichgewicht, wie es in der statischen Theorie angenommen wird.
2.3 Evolutorische Wettbewerbstheorie: Dieser Abschnitt präsentiert Hayeks Sichtweise des Wettbewerbs als Such- und Entdeckungsprozess mit unvollständigem Wissen der Marktteilnehmer. Unternehmen suchen ständig nach neuen Möglichkeiten und reagieren auf Veränderungen des Preissystems. Der Wettbewerb ist eng mit Lernprozessen verbunden, die sich dezentral über den Preismechanismus ausbreiten. Dieser Ansatz ist kaum mit statischen Modellen vereinbar.
Schlüsselwörter
Wettbewerbspolitik, Wettbewerbstheorien (statisch, dynamisch, evolutorisch), Leitbilder der Wettbewerbspolitik, Instrumente der Wettbewerbspolitik, vollständige Konkurrenz, Funktionsfähiger Wettbewerb, Marktstrukturen, Innovation, Monopol, Polypol, Konsumentenwohlfahrt, Deutschland, Europa.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Wettbewerbspolitik
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Theorien und Instrumente der Wettbewerbspolitik. Sie beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze des Wettbewerbs (statisch, dynamisch, evolutorisch), die Leitbilder der Wettbewerbspolitik (vollständige Konkurrenz, funktionsfähiger Wettbewerb etc.), die Instrumente der Wettbewerbspolitik sowie deren Anwendung in Deutschland und Europa. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Theorien und Instrumenten.
Welche Wettbewerbstheorien werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die statische, dynamische und evolutorische Wettbewerbstheorie. Die statische Theorie analysiert Marktstrukturen und deren Auswirkungen auf Marktergebnisse unter gegebenen Bedingungen. Die dynamische Theorie betont Innovationen als treibende Kraft des Wettbewerbs. Die evolutorische Theorie betrachtet Wettbewerb als Such- und Entdeckungsprozess mit unvollständigem Wissen.
Welche Leitbilder der Wettbewerbspolitik werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Leitbilder wie vollständige Konkurrenz, funktionsfähigen Wettbewerb und die Maximierung der Konsumentenwohlfahrt. Es wird erläutert, wie diese Leitbilder die Gestaltung der Wettbewerbspolitik beeinflussen.
Welche Instrumente der Wettbewerbspolitik werden vorgestellt?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Instrumente der Wettbewerbspolitik, jedoch ohne konkrete Beispiele zu nennen. Die Einzelheiten zu konkreten Instrumenten in Deutschland und Europa werden in einem separaten Kapitel behandelt.
Wie wird die Wettbewerbspolitik in Deutschland und Europa behandelt?
Ein Kapitel widmet sich der Anwendung der Wettbewerbspolitik in Deutschland und Europa. Es zeigt, wie die behandelten Theorien und Instrumente in diesen Ländern angewendet werden.
Wie sind die Kapitel der Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Wettbewerbstheorien (mit Unterkapiteln zu statischer, dynamischer und evolutorischer Theorie), Leitbilder der Wettbewerbspolitik, Instrumente der Wettbewerbspolitik, Einzelne Instrumente in Deutschland und Europa, und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wettbewerbspolitik, Wettbewerbstheorien (statisch, dynamisch, evolutorisch), Leitbilder der Wettbewerbspolitik, Instrumente der Wettbewerbspolitik, vollständige Konkurrenz, funktionsfähiger Wettbewerb, Marktstrukturen, Innovation, Monopol, Polypol, Konsumentenwohlfahrt, Deutschland, Europa.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, einen Überblick über die Theorien und Instrumente der Wettbewerbspolitik zu geben und den Zusammenhang zwischen beiden zu verdeutlichen. Die Arbeit betrachtet sowohl nationale als auch europäische Aspekte.
- Quote paper
- Hanna Martin (Author), 2008, Überblick über Theorien und Instrumente der Wettbewerbspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158831