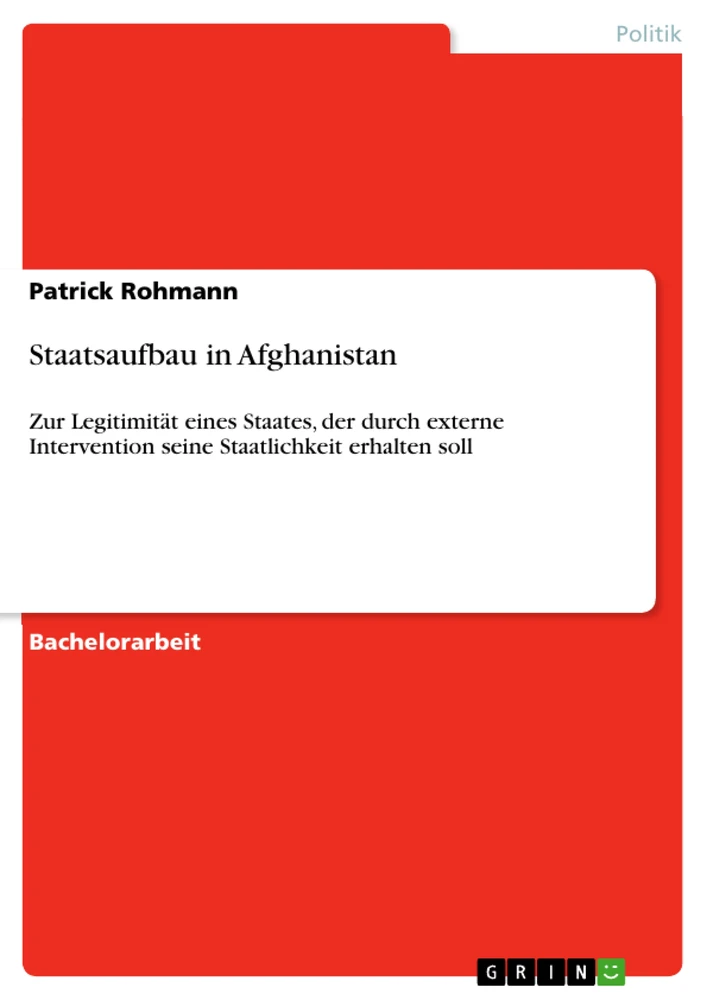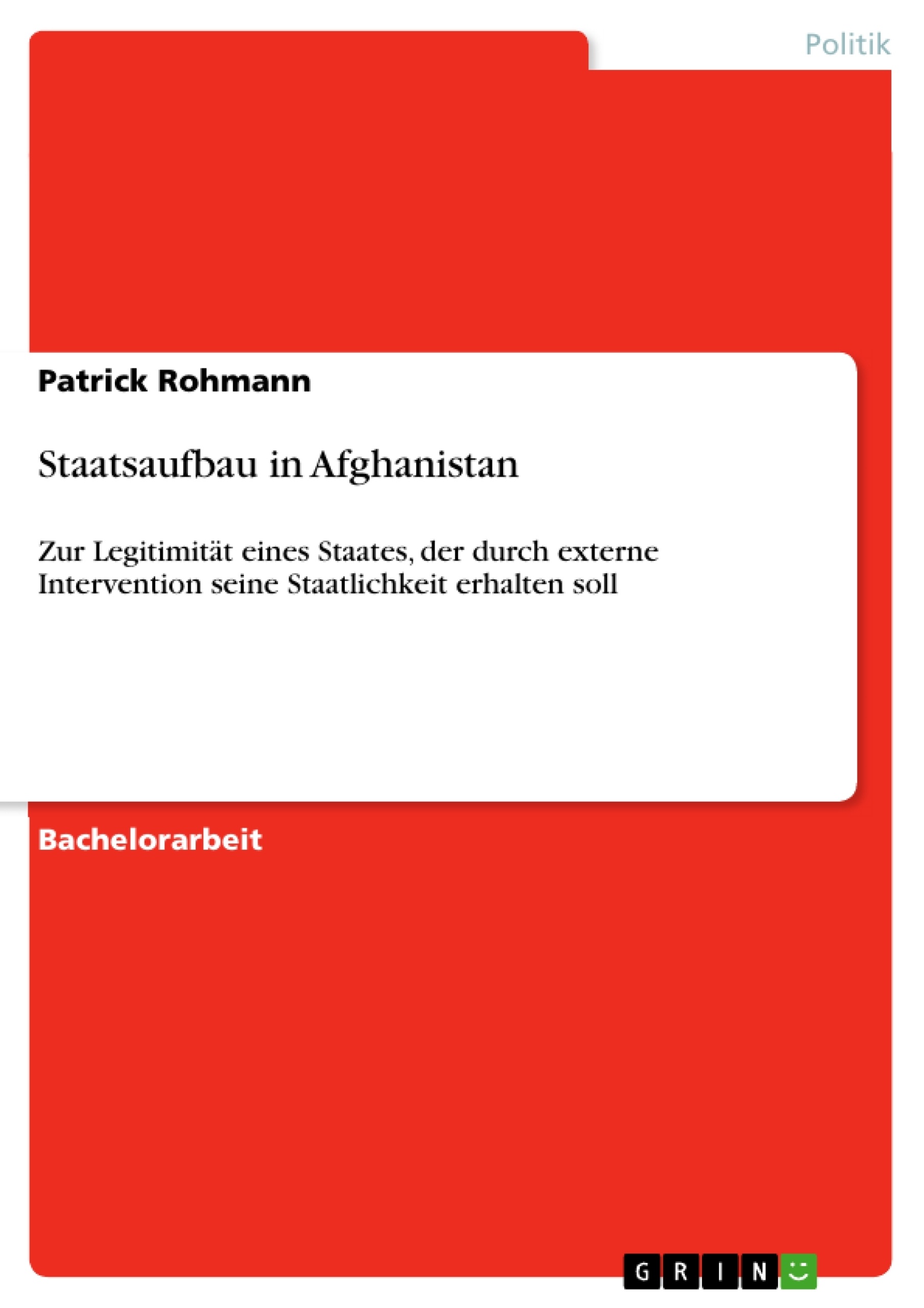1. Einleitung
„Von einer Legitimitätskrise kann dann gesprochen werden, wenn (große) Teile der Bevölkerung an den Grundwerten oder an der Rechtmäßigkeit des Handelns der Herrschenden zweifeln (Schubert/Klein 2007: 183)“.
Dieser Definition folgend, befindet sich die gegenwärtige Regierung Afghanistans offenkundig in einer Legitimitätskrise. Weder die Regierung, noch die Staatsaufbau- Mission (inklusive ausländischer Truppenpräsenz) genießen ein ausreichendes Maß an lokaler Zustimmung. Dies belegen aktuelle Bevölkerungsumfragen und stetig steigende Anschlagszahlen. „In Afghanistan müssen die internationalen Truppen nicht nur gegen erstarkte Taliban kämpfen, sondern in zunehmendem Maße auch gegen
eine feindliche Stimmung in der Bevölkerung“, lautete das Ergebnis einer groß angelegten Umfrage der Rundfunkanstalten ARD, ABC und BBC im Februar 2009 (Henze 2009:1). Einrichtungen und Angehörige der Regierung geraten ebenso wie internationale Soldaten zunehmend ins Visier von Aufständischen. Dessen ungeachtet gilt der Demokratisierungsprozess, wie er im Petersberger Abkommen 2001 vorgesehen war, seit den Parlamentswahlen vom September 2005 formal als abgeschlossen. Ernstzunehmenden Wahlbetrugsvorwürfen zum Trotz wurde Präsident Hamid Karzai im November 2009 für eine zweite Amtszeit vereidigt. Nach offiziellen afghanischen Angaben hat das Volk ihn mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt. Institutionell verfügt Afghanistan mit eigener Verfassung, Zweikammerparlament,
Oberstem Gerichtshof und eigenen Polizei- und Streitkräften über wichtige Institutionen einer modernen Demokratie. Außerdem ist Afghanistan laut Freedom House Bericht 2007 im Bezug auf garantierte Bürgerrechte „freier“ als Russland oder Thailand (Ruttig 2008: 7). Es drängt sich daher nach mehr als acht Jahren „Kapazitätsaufbau“ die Frage auf: Was verhindert die Akzeptanz der von den Interventen oktroyierten Ordnung?
Sowohl in der breiten Öffentlichkeit, als auch in der Wissenschaft werden gemeinhin zwei Antworten auf diese Frage gegeben. Die erste These hebt im Kern auf die grundsätzliche Diskrepanz ab, dass es sich beim Staatsaufbau in Afghanistan um ein Projekt der internationalen Gemeinschaft ohne (ausreichend) lokale Verwurzelung
handelt. Wie kritische Stimmen sagen: Aus der Weigerung zu akzeptieren, dass die Legitimität der internationalen Administration aus einer militärischen Okkupation herrührt, ergibt sich eine Inkonsistenz zwischen den Mitteln und den Zielen der Administration.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Legitimität
- Das europäische Ideal
- Staatliche Strukturen in Afghanistan
- Gewaltmonopol
- Rechtsstaatlichkeit
- Demokratische Beteiligung
- Soziale Gerechtigkeit
- Interdependenzen und Affektkontrolle
- Konstruktive politische Konfliktkultur
- Zur Notwendigkeit einer Strategieänderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Legitimitätskrise der gegenwärtigen afghanischen Regierung im Kontext des durch externen Interventionen erfolgten Staatsaufbaus. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen den Zielen der internationalen Gemeinschaft und der lokalen Verwurzelung der neuen Institutionen. Die Arbeit beleuchtet die Frage, inwieweit die von außen oktroyierte Ordnung in Afghanistan Akzeptanz in der Bevölkerung findet.
- Legitimitätskrise der afghanischen Regierung
- Staatsaufbau in Afghanistan durch externe Intervention
- Diskrepanz zwischen internationalen Zielen und lokaler Verwurzelung
- Akzeptanz der neuen Ordnung in der Bevölkerung
- Vereinbarkeit von Islam und Demokratie in Afghanistan
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die Legitimitätskrise der afghanischen Regierung dar und stellt die Frage nach den Gründen für die fehlende Akzeptanz der neuen Ordnung. Die verschiedenen Thesen zu diesem Thema werden vorgestellt, wobei die Diskrepanz zwischen den Zielen der internationalen Gemeinschaft und der lokalen Verwurzelung der neuen Institutionen im Vordergrund steht.
- Zum Begriff der Legitimität: Das Kapitel definiert den Begriff der Legitimität und zeigt auf, wie sich eine Legitimitätskrise äußert. Die Rolle der lokalen Bevölkerung und die Bedeutung demokratischer Institutionen für die Legitimität des Staates werden diskutiert.
- Das europäische Ideal: Dieses Kapitel stellt das europäische Ideal einer Demokratie vor und beleuchtet die Frage, inwieweit dieses Modell auf Afghanistan anwendbar ist. Die Kritiker des Demokratieprojekts in Afghanistan werden vorgestellt und ihre Argumente gegen die Durchsetzbarkeit westlicher Werte in einer islamisch geprägten Gesellschaft werden dargelegt.
- Staatliche Strukturen in Afghanistan: Dieser Abschnitt analysiert die staatlichen Strukturen in Afghanistan und untersucht, inwieweit diese die Kriterien einer modernen Demokratie erfüllen. Die Themen Gewaltmonopol, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Beteiligung, soziale Gerechtigkeit, Interdependenzen und Affektkontrolle sowie eine konstruktive politische Konfliktkultur werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die zentralen Themen der Legitimität, Staatsaufbau, externe Intervention, Afghanistan, Demokratie, Islam, lokale Verwurzelung, Akzeptanz, Tradition, Stammeskultur, Staatsstabilität, und die Frage nach der Vereinbarkeit von westlichen Werten mit afghanischen Traditionen.
- Quote paper
- Patrick Rohmann (Author), 2010, Staatsaufbau in Afghanistan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158821