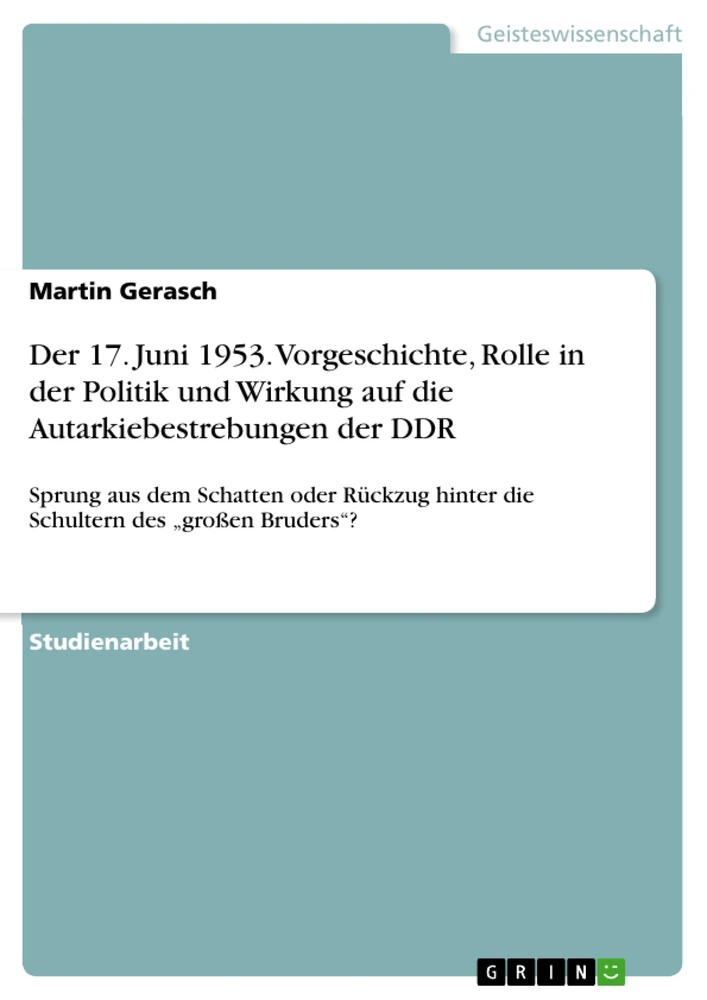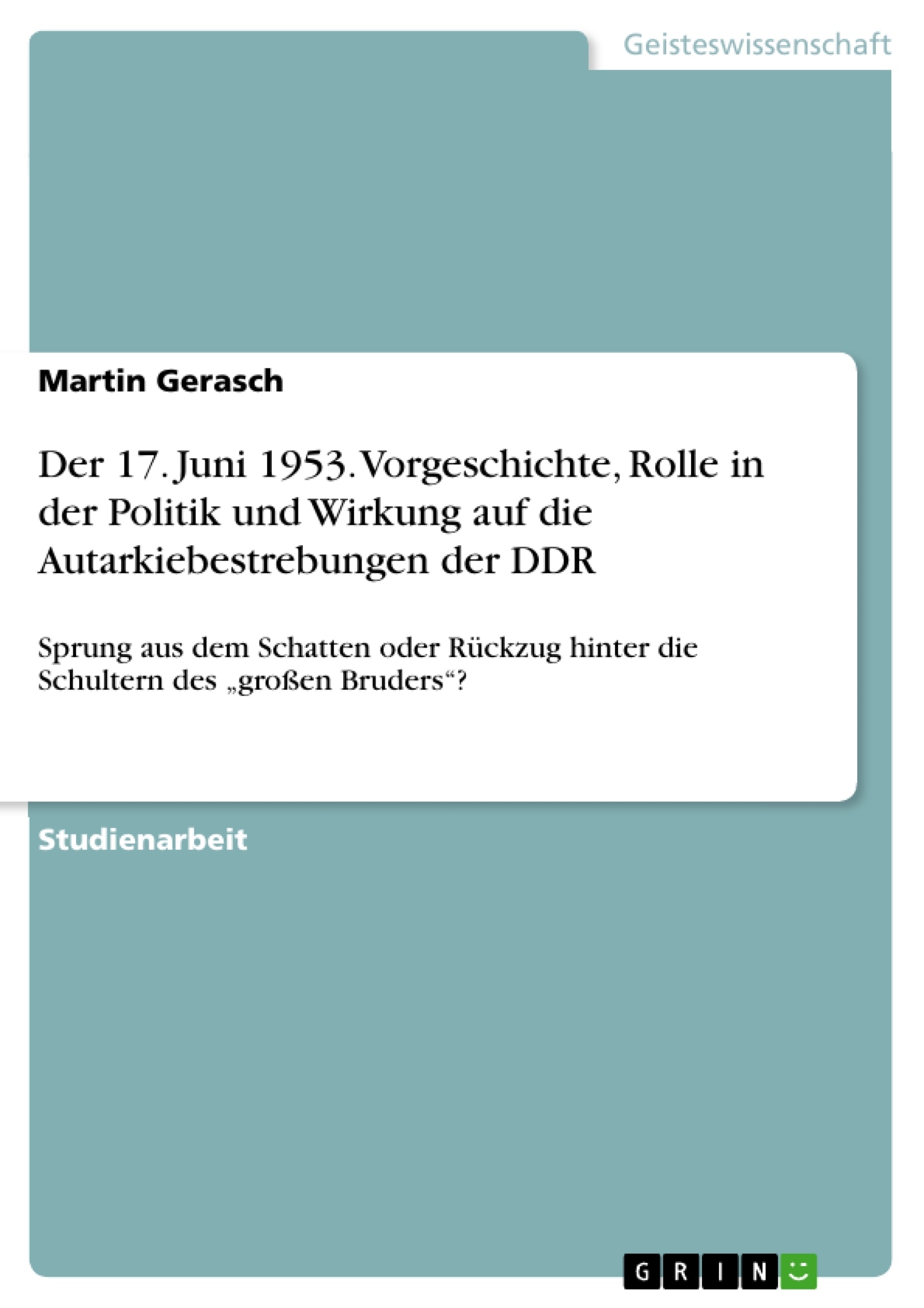„Die vertragsschließenden Seiten bestätigen feierlich, daß die Beziehungen zwischen ihnen auf völliger Gleichberechtigung, gegenseitiger Achtung der Souveränität und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten beruhen. In Übereinstimmung hiermit ist die [DDR] frei in der Entscheidung über Fragen ihrer Innenpolitik und Außenpolitik […].“
Diese Formulierung entstammt dem Freundschaftsvertrag zwischen der UdSSR und der DDR aus dem September 1955. Auch wenn solche formellen Zugeständnisse nicht überbewertet werden dürfen, stellt Michael Lemke doch die Bedeutung dieses Abkommens heraus, die der DDR die Möglichkeit einer Rechtsbasis in bipolaren Verträgen mit der ehemaligen Besatzungsmacht und eines moralischen Zeigefingers bezüglich sowjetischer Verpflichtungen gab. Ebenfalls 1955 explizierte Chruschtschow auf der Genfer Gipfelkonferenz der Siegermächte seine Zwei-Staaten-Theorie und die DDR trat dem Warschauer Pakt bei, der das Gegenstück der NATO im östlichen Blocksystem darstellte. All dies mutet zunächst wie ein Fortschritt auf dem Weg zur eigenständigen Politik und aus der Aura der direkten Weisungen der Sowjetunion an. Allerdings scheint das paradox, wenn man sich bewusst macht, dass nur wenige Jahre zuvor noch auf dem Alexanderplatz für ein geeintes Deutschland und freie Wahlen demonstriert wurde. Die Proteste, die immer mit dem Schlagwort „17. Juni“ verbunden sind, waren jedoch nicht auf diesen Tag beschränkt und erfassten nicht nur Berlin, sondern breiteten sich auch auf die anderen Regionen der DDR aus. Ob dieser Protest als „Arbeiteraufstand“, „Volksaufstand“ oder „Revolution“ bezeichnet werden sollte, ist kontrovers diskutiert worden. Da an diesem Aufstand längst nicht nur Arbeiter beteiligt waren, scheint die These von Hermann Wentker angemessen, die impliziert, dass es sich hier um einen „von Arbeitern getragenen Volksaufstand mit revolutionären Zügen“ handelte.
Hier sollen aber andere Fragen untersucht werden. Es waren im Wesentlichen sowjetische Panzer, welche die Juni-Proteste niederschlugen. War die SED-Führung so überrascht oder die KVP so schlecht vorbereitet? Was sagt uns der vehemente Eingriff der Sowjet-Armee über die Rolle Ostdeutschlands in Moskaus Plänen in der „Deutschen Frage“?
Inhaltsverzeichnis
- I. Ausgangsbedingungen, Ziele, Grenzen
- I.1. Innenpolitik - Krise im Volk und in der SED-Führung?
- I.2. Die Lage in der UdSSR – Die „Diadochenkämpfe“ um Stalins Erbe
- II. Der „17. Juni 1953“. „…sonst hol' ich meinen großen Bruder“?
- II.1. Auslöser und Verlauf der Aufstände
- II.2. Die Rolle der Sowjets und des DDR-Sicherheitsapparats.
- II.3. Folgen - „Innere Mobilmachung“ trotz „Neuem Kurs“?
- II.4. Pro und Kontra - Wird die Schwäche zur Stärke?
- III. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Vorgeschichte und Einordnung des „17. Juni 1953“ in die „große Politik“ sowie die Analyse seiner Rolle bei der „inneren Mobilmachung“ und den Autarkiebestrebungen der DDR. Die Arbeit beleuchtet die Spannungsverhältnisse zwischen der DDR und der Sowjetunion im Kontext des Kalten Krieges und untersucht die Auswirkungen des Aufstands auf die Politik der DDR und die Beziehungen zum „großen Bruder“.
- Die Rolle des „Deutschen Sonderkonflikts“ in der DDR-Politik der frühen 1950er Jahre.
- Die Hintergründe und Ursachen des „17. Juni 1953“.
- Die Reaktion der Sowjetunion auf den Aufstand und die Rolle der Sowjetarmee.
- Die Auswirkungen des Aufstands auf die „innere Mobilmachung“ in der DDR und die Autarkiebestrebungen.
- Die Bedeutung des „17. Juni“ für die „Emanzipation von vollständiger zu bedingter Abhängigkeit“ der DDR von der UdSSR.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ausgangssituation der DDR in den frühen 1950er Jahren, die geprägt war von der Sozialisierung und der engen Bindung an die Sowjetunion. Es werden die Herausforderungen der SED-Führung und die politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten der DDR beleuchtet. Darüber hinaus wird die Rolle der UdSSR und die Machtverhältnisse nach Stalins Tod betrachtet.
Das zweite Kapitel widmet sich dem „17. Juni 1953“. Es untersucht die Ursachen und den Verlauf der Aufstände, die Rolle der Sowjetarmee und die Reaktion der SED-Führung. Außerdem werden die Folgen des Aufstands für die DDR, insbesondere die „innere Mobilmachung“ und die Autarkiebestrebungen, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselthemen des Kalten Krieges, der deutschen Frage, der DDR-Politik, dem „17. Juni 1953“, der „inneren Mobilmachung“ und den Autarkiebestrebungen der DDR. Es werden wichtige Begriffe wie „Deutscher Sonderkonflikt“, „Diadochenkämpfe“, „Volksaufstand“, „Sicherheitsstaat“, „Emanzipation“ und die „sicherheitsstaatliche Expansion“ behandelt.
- Quote paper
- Martin Gerasch (Author), 2010, Der 17. Juni 1953. Vorgeschichte, Rolle in der Politik und Wirkung auf die Autarkiebestrebungen der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158755