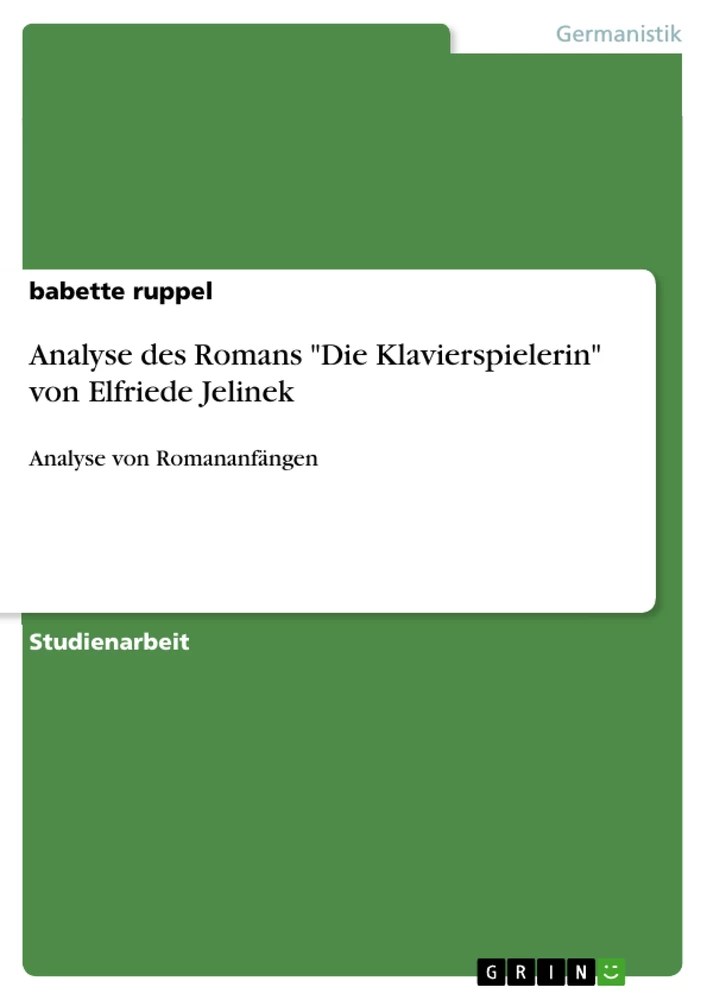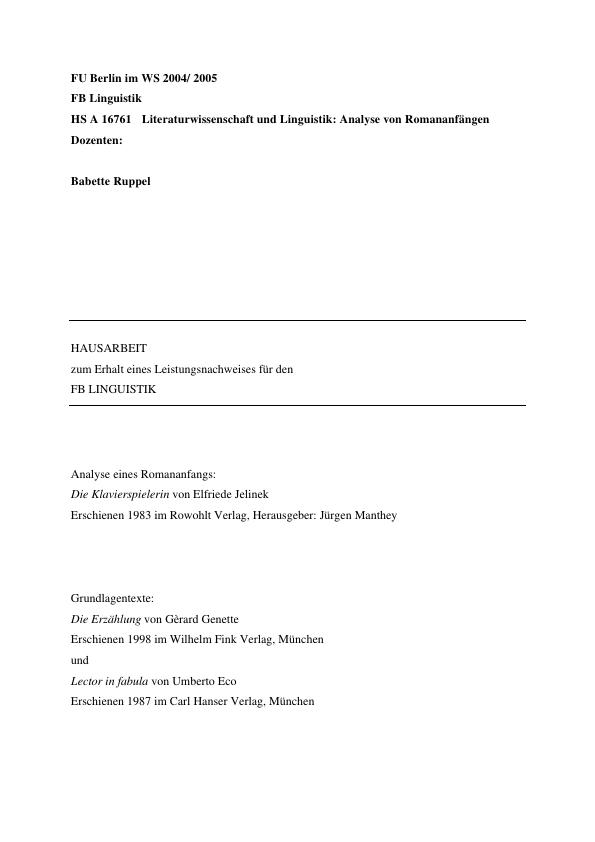Gliederung:
1 Einleitung
1.1 Vorstellung der Autorin Elfriede Jelinek
1.2 Inhaltsangabe
2 Formanalyse
2.1 Erzähler (Stimme)
2.2 Modus: Distanz vs. Fokalisierung (Perspektive)
2.3 Erzählzeit und erzählte Zeit
2.4 Wortspiele und Rhetorik, Musikalität in der Erzählung
3 Sprache, Macht, Gewalt
3.1 Fazit
Und um ein Gefühl für den Schreibstil der Arbeit zu bekommen hier eine kurze Sequenz:
"„Erikas Eitelkeit macht der Mutter zu schaffen und bohrt ihr Dornen ins Auge. Diese Eitelkeit ist das einzige…was Erika noch aufgeben muss, ist die Eitelkeit.“
Handelt es sich hierbei um interne Fokalisierung, die im inneren Monolog restlos verwirklicht ist, oder um wortgetreue Redewiedergabe durch die Erzählinstanz? Beim Inneren Monolog verschwindet die außenstehende Erzählinstanz. Die Figur, deren „Selbstgespräch“ wir lesen, wird zur einzigen Figur, die wir noch wahrnehmen. Dafür spricht vor allem die verwendete Alltagssprache in der fraglichen Sequenz, der deutliche Perspektivwechsel in dem Einschub, der suggeriert, es handle sich um einen aufgeteilten Gedankengang und die Tatsache, dass der Text im Präsens geschrieben ist. Aber bei genauerem Hinsehen fallen zwei Aspekte auf, die einen Inneren Monolog unwahrscheinlicher werden lassen: das unpersönliche Pronomen „man“ gleich am Anfang, und das Fehlen einer inquit-Formel in Gestalt eines verbum credendi.
Dass wir der Sprachverwendung Jelineks und ihrer Erzählinstanzen nicht blind vertrauen dürfen, lernen wir bereits in den ersten Absätzen. Ihre Sprache strotzt nur so vor Überraschungsmomenten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Autorin Elfriede Jelinek
- Inhaltsangabe S. 7-21 der o.g. Ausgabe
- Formanalyse
- Erzähler (Stimme)
- Modus: Fokalisierung vs. Distanz
- Erzählzeit und erzählte Zeit
- Wortspiele und Rhetorik, Musikalität in der Erzählung
- Sprache, Macht, Gewalt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Romananfang von Elfriede Jelineks "Die Klavierspielerin". Ziel ist es, die Erzähltechnik und die sprachlichen Mittel zu untersuchen, die Jelinek einsetzt, um eine bestimmte Wirkung beim Leser zu erzielen. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie die Erzählung konstruiert ist und welche Botschaft sie vermitteln möchte.
- Analyse der Erzählperspektive und des Erzählers
- Untersuchung der sprachlichen Gestaltung und ihrer Wirkung
- Erforschung des Verhältnisses zwischen Mutter und Tochter
- Interpretation der autobiografischen Elemente
- Analyse der thematischen Schwerpunkte wie Macht, Gewalt und Abhängigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den umfangreichen literarischen Hintergrund der Autorin und führt in die Thematik der Erzähltechnik ein. Die Wahl von Jelineks "Die Klavierspielerin" als Analysegegenstand wird begründet durch die Vielschichtigkeit des Textes und den ungewöhnlichen Schreibstil der Autorin, der sich durch Formspiele, rhetorische Brüche und einen hohen Interpretationsspielraum auszeichnet.
Vorstellung der Autorin Elfriede Jelinek: Dieses Kapitel bietet eine kurze biographische Skizze von Elfriede Jelinek, ihren Werdegang und ihre vielseitigen literarischen Aktivitäten. Es wird auf ihre psychischen Probleme und ihre spätere Anerkennung als Schriftstellerin eingegangen, die von anfänglicher Kritik bis hin zur Verleihung des Nobelpreises reichte. Die Darstellung ihrer Biografie dient dazu, den Kontext für die Analyse ihres Romans zu liefern und mögliche autobiographische Bezüge zu beleuchten.
Inhaltsangabe S. 7-21 der o.g. Ausgabe: Dieser Abschnitt präsentiert eine knappe Zusammenfassung des Romananfangs, die sich auf die Beziehung zwischen Erika Kohut und ihrer Mutter konzentriert. Die Darstellung des konflikthaften Verhältnisses, geprägt von Kontrolle, Abhängigkeit und emotionaler Gewalt, bildet die Grundlage für die spätere formanalytische Untersuchung. Besonders hervorgehoben wird die Mutter-Tochter-Dynamik und Erikas vergebliche Versuche, sich Freiraum zu schaffen.
Formanalyse: Die Formanalyse untersucht die Frage nach der fiktionalen und autobiografischen Natur des Romans. Es wird die These diskutiert, dass der Roman, obwohl autobiografische Elemente enthält, dennoch ein fiktionales Werk darstellt. Die Analyse beleuchtet die Schreibweise und die Absicht der Autorin, beim Leser ein Gefühl des Unbehagens zu erzeugen. Die zentralen Fragen nach dem Erzähler, der Wirkung auf den Leser und den verwendeten sprachlichen Mitteln werden als Ausgangspunkt der weiteren Analyse formuliert.
Schlüsselwörter
Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin, Romananfang, Erzähltechnik, Formanalyse, Mutter-Tochter-Beziehung, Macht, Gewalt, Abhängigkeit, autobiografische Elemente, Sprachstil, Rhetorik.
Häufig gestellte Fragen zu Elfriede Jelineks "Die Klavierspielerin" (Romananfang)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert den Romananfang von Elfriede Jelineks "Die Klavierspielerin". Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Erzähltechnik und der sprachlichen Mittel, die Jelinek einsetzt, um eine bestimmte Wirkung beim Leser zu erzielen. Es wird untersucht, wie die Erzählung konstruiert ist und welche Botschaft sie vermittelt.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf die Erzählperspektive und den Erzähler, die sprachliche Gestaltung und ihre Wirkung, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, mögliche autobiografische Elemente und die thematischen Schwerpunkte Macht, Gewalt und Abhängigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Vorstellung der Autorin Elfriede Jelinek, eine Inhaltsangabe der ersten Seiten des Romans, eine Formanalyse, eine detaillierte Betrachtung des Erzählers und der Erzähltechnik (Fokalisierung, Distanz, Erzählzeit und erzählte Zeit), eine Analyse der Sprache (Wortspiele, Rhetorik, Musikalität), eine Auseinandersetzung mit den Themen Sprache, Macht und Gewalt, sowie ein Fazit.
Wie wird die Erzähltechnik analysiert?
Die Analyse der Erzähltechnik umfasst die Untersuchung der Erzählperspektive, des Erzählers, der Fokalisierung, der Distanz zwischen Erzähler und Geschichte, sowie die Betrachtung der Erzählzeit und der erzählten Zeit. Es wird auch auf die Musikalität und die rhetorischen Mittel in der Erzählung eingegangen.
Welche Rolle spielen Sprache, Macht und Gewalt in der Analyse?
Sprache, Macht und Gewalt sind zentrale Themen der Analyse. Es wird untersucht, wie Jelinek diese Themen durch ihre sprachliche Gestaltung und Erzählweise darstellt und welche Wirkung diese Darstellung auf den Leser hat. Der Fokus liegt dabei auch auf dem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter und den Machtstrukturen innerhalb dieser Beziehung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin, Romananfang, Erzähltechnik, Formanalyse, Mutter-Tochter-Beziehung, Macht, Gewalt, Abhängigkeit, autobiografische Elemente, Sprachstil, Rhetorik.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit beinhaltet Kapitelzusammenfassungen, welche die Einleitung, die Vorstellung der Autorin, die Inhaltsangabe des Romananfangs, und die Formanalyse detailliert beschreiben. Diese Zusammenfassungen liefern einen Überblick über den Inhalt und die Argumentationslinie der jeweiligen Kapitel.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen über die Erzähltechnik, die sprachlichen Mittel und die thematischen Schwerpunkte des Romananfangs. Es wird eine Gesamtinterpretation des Textes angeboten.
Welche Informationen über Elfriede Jelinek werden gegeben?
Die Arbeit enthält eine kurze biographische Skizze von Elfriede Jelinek, die ihren Werdegang, ihre literarischen Aktivitäten und ihre psychischen Probleme beleuchtet. Diese Informationen dienen dazu, den Kontext für die Analyse ihres Romans zu liefern und mögliche autobiografische Bezüge zu beleuchten.
Ist der Roman autobiografisch?
Die Formanalyse untersucht die Frage nach dem Verhältnis zwischen fiktionalen und autobiografischen Elementen im Roman. Es wird diskutiert, inwieweit der Roman, trotz autobiografischer Bezüge, als fiktionales Werk zu betrachten ist.
- Quote paper
- babette ruppel (Author), 2004, Analyse des Romans "Die Klavierspielerin" von Elfriede Jelinek, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158326