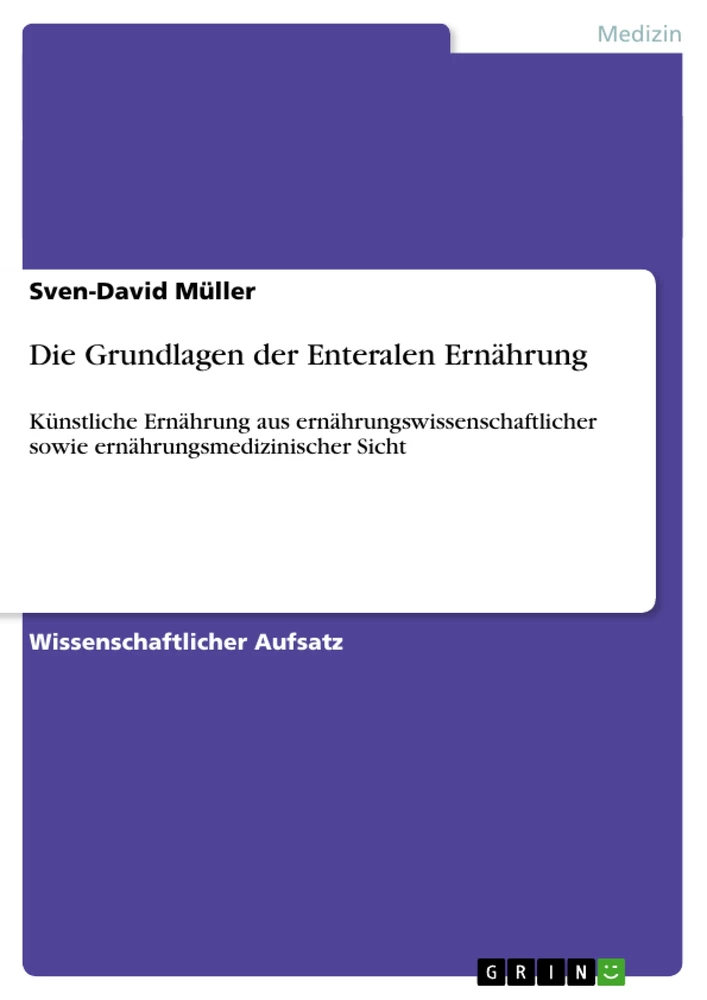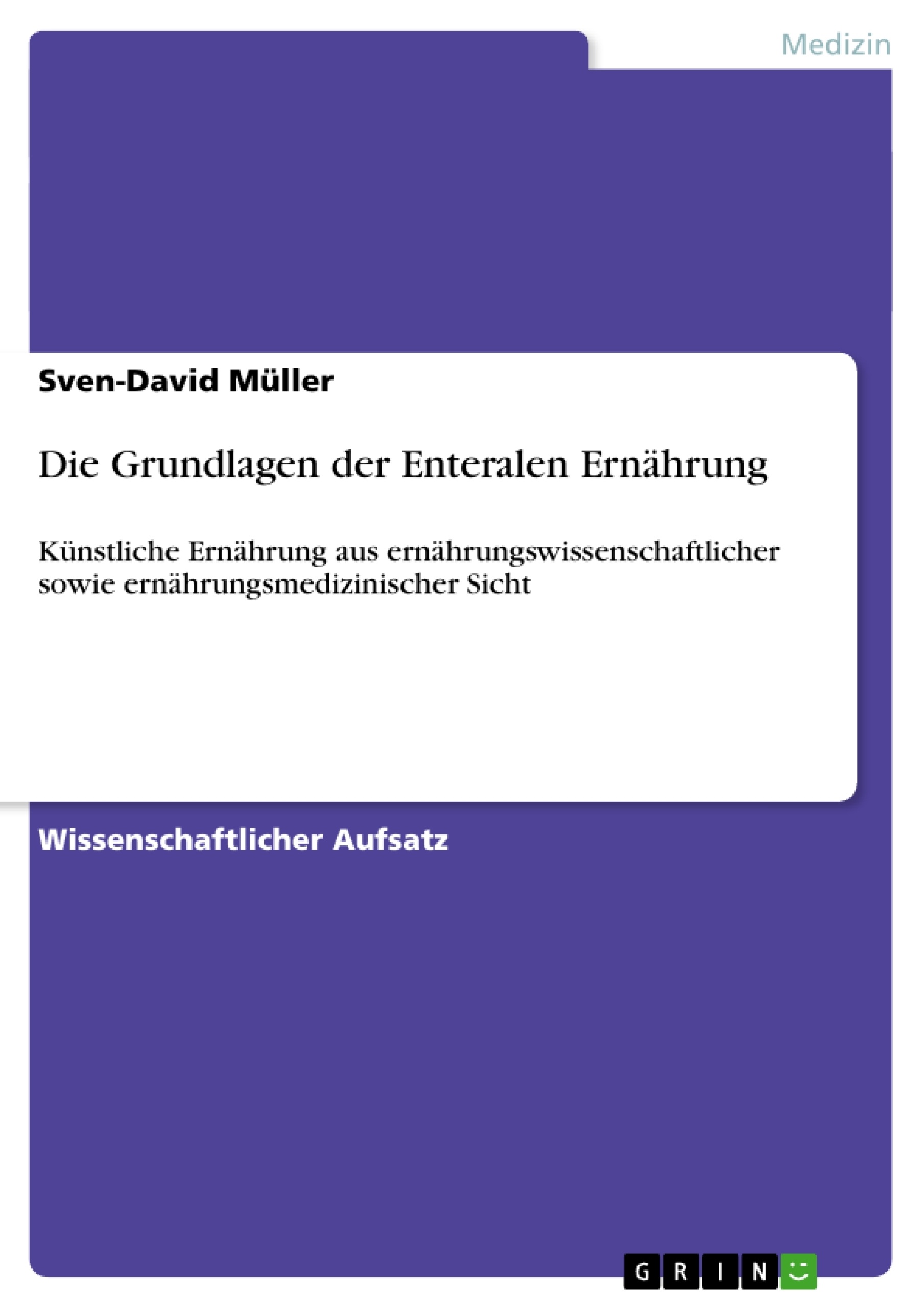Unter den Schlagworten "Künstliche Ernährung" werden die enterale Ernährung und die parenterale Ernährung zusammengefasst. Künstliche Ernährung ist erforderlich, wenn Menschen (Patienten) nicht essen können, wollen, dürfen oder sollten. Die Nahrungsaufnahme erfolgt im Rahmen der künstlichen Ernährung nicht mit üblichen Lebensmitteln, sondern mit Infusionslösungen (parenterale Ernährung) oder bilanzierten Diäten (Supplement, Trink- und Sondennahrung; pulverisiert oder flüssig im Rahmen der enteralen Ernährung). Für viele Patienten ist die klinische Ernährung der entscheidende Faktor im Gesamtbehandlungskonzept zur Wiederherstellung und/oder Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit und Lebensqualität. Wichtige Beispiele sind Patienten mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Schluckstörungen (Dysphagie), HIV-Infektion oder AIDS und Tumorpatienten (zur Vermeidung oder unterstützenden Ernährungstherapie der Tumorkachexie). Die Ernährungstherapie kann andere therapeutische Maßnahmen unterstützen, Komplikationen vermeiden und die Rekonvaleszenz verkürzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Enterale Ernährung
- 2.1 Bedarfsdeckende bilanzierte Diäten
- 2.2 Ergänzende bilanzierte Diäten
- 3 Parenterale Ernährung
- 4 Vergleich enterale Ernährung versus parenterale Ernährung
- 4.1 Physiologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Grundlagen der enteralen und parenteralen Ernährung. Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Methoden, Indikationen und physiologischen Aspekte beider Ernährungsformen zu geben und den Vergleich beider Verfahren vorzunehmen.
- Enterale Ernährung mit Trink- und Sondennahrung
- Parenterale Ernährung und deren Indikationen
- Vergleich der physiologischen Auswirkungen beider Ernährungsmethoden
- Unterschiedliche Arten von bilanzierten Diäten
- Indikationen für klinische Ernährung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der enteralen Ernährung und führt in die Thematik der klinischen Ernährung ein. Sie betont die Bedeutung der klinischen Ernährung bei verschiedenen Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Schluckstörungen, HIV/AIDS und Tumorerkrankungen, um die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Indikation zur klinischen Ernährung wird bei (drohender) Mangelernährung, erhöhtem Energieverbrauch und verlängerter Nahrungskarenz erläutert. Der Nutzen einer gezielten Ernährungstherapie wird im Kontext der Dauer der Nahrungskarenz und dem Ausmaß des Ernährungsdefizits betrachtet. Es wird hervorgehoben, dass bei gut ernährten Patienten nach 5 bis 7 Tagen Nahrungskarenz eine gezielte Ernährungstherapie erfolgen sollte, während bei drohender oder bereits manifester Mangelernährung so früh wie möglich mit der Therapie begonnen werden muss. Die Einleitung listet verschiedene Indikationen zur klinischen Ernährung auf, darunter Schluckstörungen, Bewusstseinsstörungen, konsumierende Erkrankungen, Mucoviszidose und mehr.
2 Enterale Ernährung: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der enteralen Ernährung mittels Trink- und Sondennahrung. Es betont die Notwendigkeit stabiler Stoffwechselverhältnisse und einer zumindest partiellen Funktion des Gastrointestinaltrakts als Voraussetzung. Die Applikationsmethoden, oral als Trinknahrung oder gastral, duodenal oder jejunal als Sondennahrung, werden beschrieben. Die Wahl zwischen Nasensonden für kürzere und transkutanen Sonden (PEG) für längere Ernährungszeiten wird erläutert. Das Kapitel kritisiert die früher übliche selbst hergestellte Trink- und Sondennahrung aufgrund mangelnder Inhaltsstoffdefinition und Hygiene. Es empfiehlt den Einsatz industrieller bilanzierter Diäten, die gesetzlich definiert sind und deren Zusammensetzung durch die Richtlinie 1999/21/EG geregelt wird. Verschiedene Kaloriendichten (1 kcal/ml, hyperkalorisch, hypokalorisch) werden erwähnt. Das Kapitel unterteilt weiter in bedarfsdeckende und ergänzende bilanzierte Diäten, erläutert deren Zusammensetzung und Einsatzgebiete im Detail, inklusive nährstoffdefinierter und chemisch definierter Diäten, sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile.
3 Parenterale Ernährung: Kapitel 3 beschreibt die parenterale Ernährung als Alternative, die nur dann in Frage kommt, wenn eine enterale Ernährung nicht möglich ist. Die Indikationen umfassen beispielsweise Ileus, Stenosen im Magen-Darm-Trakt, unstillbares Erbrechen, akute Pankreatitis (wenngleich eine enterale Ernährung hier nicht mehr absolut kontraindiziert ist) und schwere Stoffwechselentgleisungen. Der Vorteil enteraler Ernährung prä-, post- und intraoperativ wird angesprochen und mit einer Meta-Analyse belegt, die eine geringere Häufigkeit postoperativer septischer Komplikationen unter enteraler im Vergleich zu parenteraler Ernährung zeigt. Im Gegensatz zur enteralen Ernährung existieren keine vollständig bilanzierten Infusionslösungen. Die Zusammensetzung handelsüblicher Komplettlösungen wird beschrieben, und die Notwendigkeit der individuellen Anpassung und Mischung von Einzelkomponenten unter dem Arzneimittelgesetz hervorgehoben. Die Applikation erfolgt über zentrale oder periphere Venenkatheter, wobei die Nährstoffe in direkt verwertbarer Form vorliegen. Das Kapitel unterscheidet zwischen hypokalorischer (partielle parenterale Ernährung) und vollständiger, bedarfsdeckender oder bedarfsüberschreitender (totale parenterale Ernährung).
4 Vergleich enterale Ernährung versus parenterale Ernährung: Dieses Kapitel vergleicht enterale und parenterale Ernährung. Es wird betont, dass 90 % der Patienten enteral ernährt werden könnten, jedoch in der Praxis häufiger parenteral ernährt werden. Die enterale Ernährung wird der parenteralen vorgezogen, da sie physiologischer, risikoärmer, weniger pflegeintensiv und kostengünstiger ist. Der Abschnitt „Physiologie“ vergleicht die Stoffwechselprozesse von Glukose, Aminosäuren und Lipiden bei beiden Ernährungsformen detailliert und hebt die physiologischen Vorteile der enteralen Ernährung hervor, unter anderem den trophischen Effekt auf die Darmschleimhaut und das geringere Risiko bakterieller Translokation im Gegensatz zur parenteralen Ernährung, welche zu Zottenatrophie und einer reduzierten Resorptionsfähigkeit führen kann.
Schlüsselwörter
Enterale Ernährung, Parenterale Ernährung, Trinknahrung, Sondennahrung, bilanzierte Diäten, Nährstoffdefinierte Diäten (NDD), Chemisch definierte Diäten (CDD), klinische Ernährung, Mangelernährung, Gastrointestinaltrakt, Stoffwechsel, Physiologie, Indikation, Kontraindikation, Komplikationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Klinische Ernährung - Enteral vs. Parenteral
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über enterale und parenterale Ernährung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Enterale Ernährung, Parenterale Ernährung, Vergleich beider Methoden) und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf den Grundlagen, Indikationen, physiologischen Aspekten und dem Vergleich beider Ernährungsformen.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Dokuments?
Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Methoden, Indikationen und physiologischen Aspekte der enteralen und parenteralen Ernährung zu geben und einen detaillierten Vergleich beider Verfahren vorzunehmen. Die Themenschwerpunkte umfassen enterale Ernährung (Trink- und Sondennahrung), parenterale Ernährung und deren Indikationen, den Vergleich der physiologischen Auswirkungen beider Methoden, verschiedene Arten von bilanzierten Diäten und Indikationen für klinische Ernährung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der enteralen Ernährung, führt in die Thematik der klinischen Ernährung ein und betont deren Bedeutung bei verschiedenen Erkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Schluckstörungen, HIV/AIDS, Tumorerkrankungen). Sie erläutert die Indikation zur klinischen Ernährung bei (drohender) Mangelernährung, erhöhtem Energieverbrauch und verlängerter Nahrungskarenz und beschreibt den Nutzen einer gezielten Ernährungstherapie in Abhängigkeit von der Dauer der Nahrungskarenz und dem Ausmaß des Ernährungsdefizits. Schließlich werden verschiedene Indikationen zur klinischen Ernährung aufgeführt (z.B. Schluckstörungen, Bewusstseinsstörungen, konsumierende Erkrankungen, Mucoviszidose).
Was sind die Hauptaspekte der enteralen Ernährung?
Das Kapitel zur enteralen Ernährung behandelt die Ernährung mittels Trink- und Sondennahrung. Es betont die Notwendigkeit stabiler Stoffwechselverhältnisse und einer zumindest partiellen Funktion des Gastrointestinaltrakts. Es beschreibt die Applikationsmethoden (oral, gastral, duodenal, jejunal) und die Wahl zwischen Nasensonden und PEG-Sonden. Es kritisiert selbst hergestellte Mischungen und empfiehlt den Einsatz industrieller bilanzierter Diäten (gesetzlich definiert, Richtlinie 1999/21/EG). Es differenziert zwischen bedarfsdeckenden und ergänzenden bilanzierten Diäten (inkl. nährstoffdefinierter und chemisch definierter Diäten) und erläutert deren Zusammensetzung und Einsatzgebiete.
Welche Aspekte der parenteralen Ernährung werden behandelt?
Das Kapitel zur parenteralen Ernährung beschreibt sie als Alternative zur enteralen Ernährung, wenn diese nicht möglich ist (z.B. Ileus, Stenosen, unstillbares Erbrechen, akute Pankreatitis). Es betont den Vorteil enteraler Ernährung prä-, post- und intraoperativ und belegt dies mit einer Meta-Analyse. Es erklärt, dass keine vollständig bilanzierten Infusionslösungen existieren und beschreibt die Zusammensetzung handelsüblicher Komplettlösungen sowie die Notwendigkeit der individuellen Anpassung. Die Applikation über zentrale oder periphere Venenkatheter wird erläutert, und die Unterscheidung zwischen hypokalorischer (partielle) und vollständiger, bedarfsdeckender oder bedarfsüberschreitender (totale) parenteraler Ernährung wird gemacht.
Wie werden enterale und parenterale Ernährung verglichen?
Der Vergleich beider Ernährungsformen betont, dass 90% der Patienten enteral ernährt werden könnten, aber häufiger parenteral ernährt werden. Die enterale Ernährung wird aufgrund ihrer physiologischen Vorteile, des geringeren Risikos, des geringeren Pflegeaufwands und der niedrigeren Kosten bevorzugt. Der Abschnitt „Physiologie“ vergleicht die Stoffwechselprozesse detailliert und hebt die Vorteile der enteralen Ernährung hervor (trophischer Effekt auf die Darmschleimhaut, geringeres Risiko bakterieller Translokation). Die parenterale Ernährung kann zu Zottenatrophie und reduzierter Resorptionsfähigkeit führen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Thema?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Enterale Ernährung, Parenterale Ernährung, Trinknahrung, Sondennahrung, bilanzierte Diäten, Nährstoffdefinierte Diäten (NDD), Chemisch definierte Diäten (CDD), klinische Ernährung, Mangelernährung, Gastrointestinaltrakt, Stoffwechsel, Physiologie, Indikation, Kontraindikation, Komplikationen.
- Quote paper
- M.Sc. Sven-David Müller (Author), 2010, Die Grundlagen der Enteralen Ernährung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158217