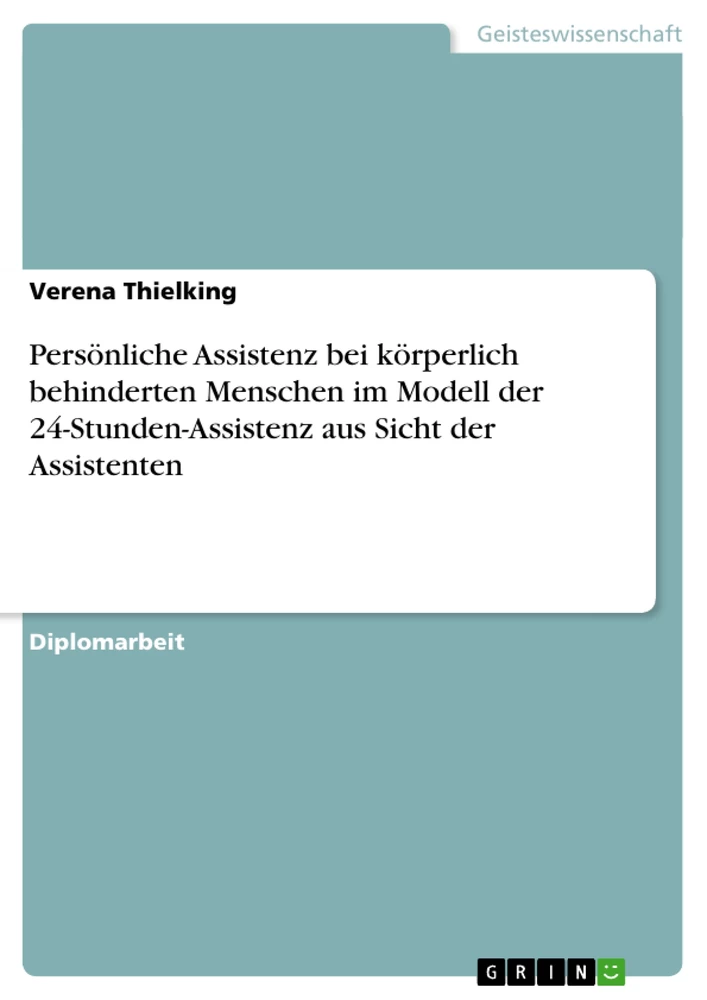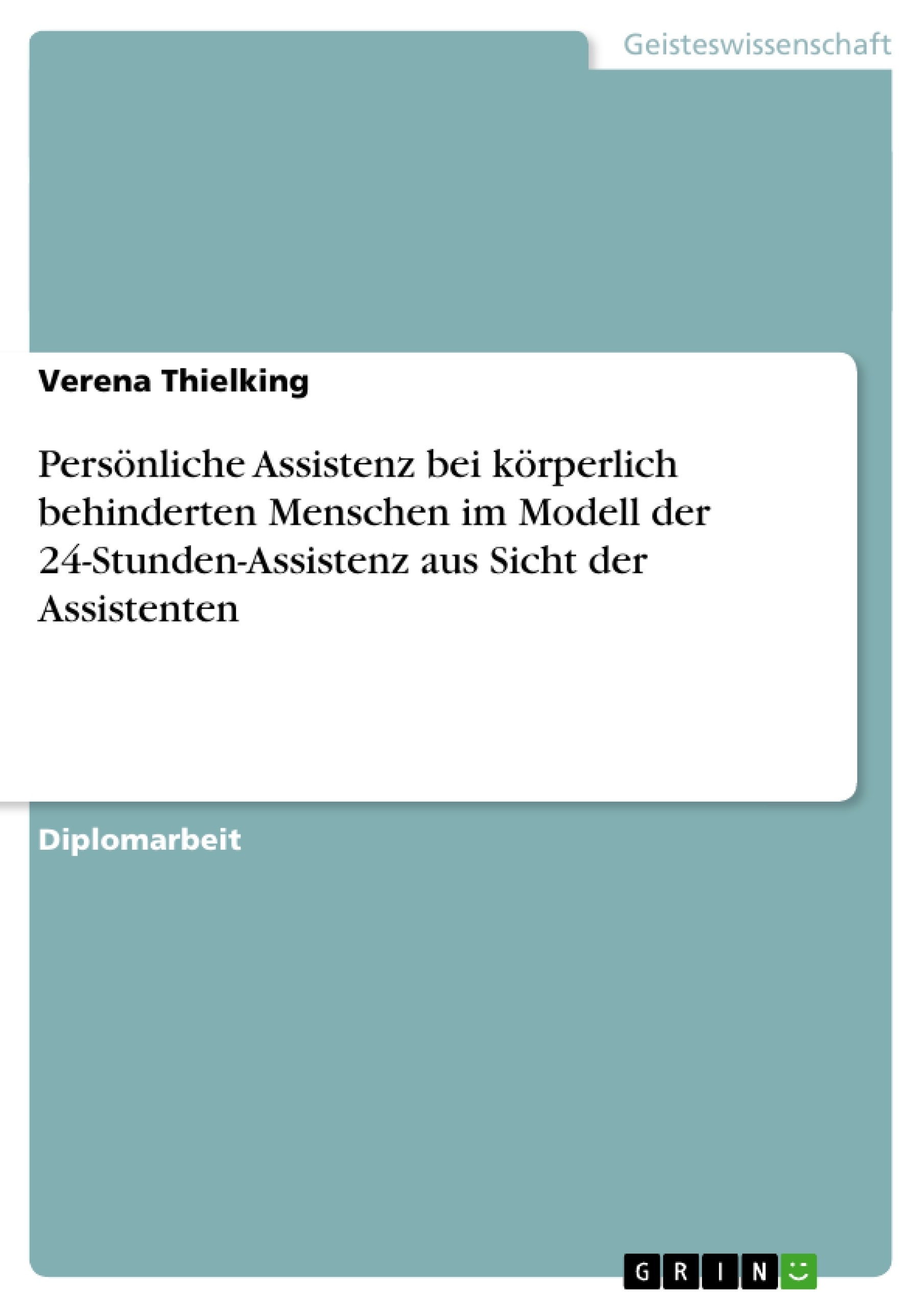Für meine Diplomarbeit wollte ich ein Thema erörtern, welches mich interessiert, mich auch privat beschäftigt und mit dem ich mich identifizieren kann.
Während meines Studiums arbeitete ich knapp zwei Jahre als Assistentin bei einer körperlich behinderten jungen Frau, welche die 24 Stunden Assistenz in Anspruch nimmt, um ein selbstständiges Leben außerhalb ihres Elternhauses führen zu können.
Im Rahmen dieser Arbeit stellten sich mir aus Sicht einer angehenden Sozialpädagogin, aber zugleich auch aus der Sicht einer Assistentin immer wieder Fragen, deren Antworten offen blieben oder nur unbefriedigend von dem Arbeitgeber oder Behindertenverbänden beantwortet wurden. Zusätzlich machte sich in meinem Team ein Unmut über schlechte Bezahlung trotz extremer Arbeitszeiten und wenig Hilfen bei zwischenmenschlichen Problemen breit. Zu vielen Themen fehlte mir die Sichtweise der Assistenten. Ich wollte wissen, was Assistenten aus anderen Teams über dieses Arbeitsfeld denken, wie es ihnen geht, ob und welche Probleme es dort gibt, gerade in Bezug auf die 24 Stunden Assistenz und ob und welche Unterstützung sie bekommen.
Deshalb entschloss ich mich, diesen Bereich im Rahmen meiner Diplomarbeit näher zu beleuchten, um Antworten auf meine Fragen zu erhalten.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema konnte nicht Anhand von Literatur theoretisch erschlossen werden, da das Feld der persönlichen Assistenz noch sehr jung ist. Außerdem bot sich eine eigenständige Erhebung aufgrund der speziellen Frageinhalte geradezu an .
Im Verlauf dieser Arbeit werden zunächst grundlegende Informationen zur Entstehung und zur Entwicklung Persönlicher Assistenz gegeben. Es wird dargestellt, welche Inhalte und welche Bedeutung der Persönlichen Assistenz zugrunde liegen.
Nach der Präsentation der Thesen wird die Auswahl der Methodischen Instrumente begründet. Auf eine deskriptive statistische Auswertung der Erhebung folgt die Beantwortung und Bewertung der erstellten Thesen.
Abschließend werden die Ergebnisse kritisch reflektiert und diskutiert, sowie die Bedeutung für die Soziale Arbeit erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil I: Grundlagen
- 2. Geschichte der (west-)deutschen Behindertenbewegung
- 3. Der Weg zur Persönlichen Assistenz
- 3.1. Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung
- 3.2. Assistenzgenossenschaften
- 3.3. Das Konzept „Selbstbestimmt Leben“
- 4. Die Persönliche Assistenz
- 4.1. Begriffserklärung und Definitionen
- 4.2. Das Konzept der Persönlichen Assistenz
- 4.3. Verhältnis von Assistenznehmer und Assistent im Modell der Persönlichen Assistenz
- 4.3.1. Rollenverständnis von Assistent und Assistenznehmer
- 4.3.2. Macht und Abhängigkeit
- 4.3.3. Formen der Gewalt im Verhältnis von Assistenznehmer und Assistent
- 4.4. Finanzierung von Persönlicher Assistenz
- 4.5. Zahlen/Fakten
- 4.6. 24-Stunden-Modell in Abgrenzung zu anderen Modellen
- Teil II: Empirischer Teil
- 5. Methodische Vorgehensweise
- 5.1. Zugrunde liegende Thesen
- 5.2. Stichprobenziehung
- 5.3. Auswahl des methodischen Instruments
- 5.4. Pretest
- 5.5. Probleme der Befragung
- 6. Statistische Auswertung
- 6.1. Basisdaten der Stichproben
- 6.2. Soziographische Datenbasis
- 6.2.1. Geschlecht und Alter
- 6.2.2. Arbeitsstatus und Intensität ausgehend von der Stundenzahl
- 6.2.3. Berufserfahrung in der Persönlichen Assistenz
- 6.2.4. Zusammenfassung der soziographischer Daten
- 6.3. Empirische Datenbasis
- 6.3.1. Form der Behinderung und sich daraus ergebende Aufgaben des Assistenten
- 6.3.2. Arbeitsverständnis/Werte
- 6.3.3. Beziehung zu Assistenznehmer
- 6.3.4. Vorhandene oder mögliche Schwierigkeiten
- 6.3.5. Persönliche Grenzen
- 6.3.6. Erwartungen an Assistenznehmer
- 6.3.7. Einstellung zu Nähe und Distanz
- 6.3.8. Vorhandene Konfliktfelder oder Situationen
- 6.3.9. Umgang mit Konflikten
- 6.3.10. Fortbildung und Supervision
- 7. Prüfung der Thesen
- 8. Abschließende Diskussion / Bedeutung für soziale Arbeit
- 9. Zusammenfassung
- Die Geschichte und Entwicklung der Persönlichen Assistenz in Deutschland
- Das Konzept der Persönlichen Assistenz und seine verschiedenen Modelle
- Das Verhältnis zwischen Assistenznehmern und Assistenten: Rollenverständnis, Machtstrukturen und Konflikte
- Die Arbeitsbedingungen und Herausforderungen für Assistenten im 24-Stunden-Modell
- Empirische Befunde zur Arbeitszufriedenheit, Belastung und den Erfahrungen der Assistenten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Perspektive von Assistenten in der 24-Stunden-Assistenz für körperlich behinderte Menschen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Arbeitsrealität, der Herausforderungen und des Rollenverständnisses der Assistenten zu zeichnen.
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Grundlagen: Dieser Teil legt das theoretische Fundament der Arbeit. Er beleuchtet die historische Entwicklung der Behindertenbewegung in Westdeutschland und beschreibt den Weg zur Etablierung der Persönlichen Assistenz, inklusive verschiedener Modelle wie der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung und Assistenzgenossenschaften. Der Fokus liegt auf dem Konzept „Selbstbestimmt Leben“ und seiner Bedeutung für die Persönliche Assistenz. Das Kapitel analysiert den Begriff der Persönlichen Assistenz, definiert zentrale Konzepte, und untersucht das Verhältnis zwischen Assistenten und Assistenznehmern, inklusive Rollenverständnissen, Machtstrukturen und möglichen Konflikten. Die Finanzierung und unterschiedliche Modelle der Assistenz, insbesondere das 24-Stunden-Modell, werden detailliert dargestellt.
Teil II: Empirischer Teil: Der empirische Teil der Arbeit beschreibt die methodische Vorgehensweise, die angewandten Forschungsmethoden und die Stichprobenziehung. Es werden die soziographischen Daten der befragten Assistenten analysiert (z.B. Alter, Geschlecht, Berufserfahrung). Die empirischen Daten werden ausführlich interpretiert, um ein umfassendes Bild der Arbeitsrealität der Assistenten zu liefern. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit den im theoretischen Teil erörterten Konzepten in Beziehung gesetzt.
Schlüsselwörter
Persönliche Assistenz, 24-Stunden-Assistenz, körperliche Behinderung, Selbstbestimmt Leben, Assistenznehmer, Assistent, Rollenverständnis, Machtstrukturen, Konflikte, Arbeitsbedingungen, empirische Forschung, qualitative Methoden, soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Persönliche Assistenz im 24-Stunden-Modell
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Perspektive von Assistenten in der 24-Stunden-Assistenz für körperlich behinderte Menschen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Arbeitsrealität, der Herausforderungen und des Rollenverständnisses der Assistenten zu zeichnen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte und Entwicklung der Persönlichen Assistenz in Deutschland, das Konzept der Persönlichen Assistenz und seine verschiedenen Modelle, das Verhältnis zwischen Assistenznehmern und Assistenten (Rollenverständnis, Machtstrukturen und Konflikte), die Arbeitsbedingungen und Herausforderungen für Assistenten im 24-Stunden-Modell und empirische Befunde zur Arbeitszufriedenheit, Belastung und den Erfahrungen der Assistenten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: Teil I (Grundlagen) legt das theoretische Fundament, indem er die historische Entwicklung der Behindertenbewegung, den Weg zur Persönlichen Assistenz und das Konzept "Selbstbestimmt Leben" beleuchtet. Teil II (Empirischer Teil) beschreibt die methodische Vorgehensweise, die Datenerhebung und -auswertung sowie die Interpretation der empirischen Ergebnisse.
Welche Methoden wurden im empirischen Teil verwendet?
Der empirische Teil beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise, inklusive Stichprobenziehung und Auswahl des methodischen Instruments (wahrscheinlich Befragungen). Die soziographischen Daten der befragten Assistenten (Alter, Geschlecht, Berufserfahrung etc.) werden analysiert und interpretiert, um ein umfassendes Bild der Arbeitsrealität zu liefern.
Welche Aspekte des Verhältnisses zwischen Assistenznehmer und Assistent werden untersucht?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Assistenznehmer und Assistent im Detail, inklusive Rollenverständnis, Machtstrukturen, möglichen Konflikten und dem Umgang damit. Es werden auch Aspekte der Nähe und Distanz in der Beziehung beleuchtet.
Welche konkreten Fragestellungen werden im empirischen Teil untersucht?
Der empirische Teil untersucht unter anderem das Arbeitsverständnis/die Werte der Assistenten, die Beziehung zu den Assistenznehmern, vorhandene Schwierigkeiten, persönliche Grenzen, Erwartungen an Assistenznehmer, Konfliktfelder und den Umgang mit Konflikten sowie Fortbildung und Supervision.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse und ihrer Bedeutung für die soziale Arbeit. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem empirischen Teil werden mit den im theoretischen Teil erörterten Konzepten in Beziehung gesetzt und zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Persönliche Assistenz, 24-Stunden-Assistenz, körperliche Behinderung, Selbstbestimmt Leben, Assistenznehmer, Assistent, Rollenverständnis, Machtstrukturen, Konflikte, Arbeitsbedingungen, empirische Forschung, qualitative Methoden, soziale Arbeit.
- Quote paper
- Verena Thielking (Author), 2010, Persönliche Assistenz bei körperlich behinderten Menschen im Modell der 24-Stunden-Assistenz aus Sicht der Assistenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158167