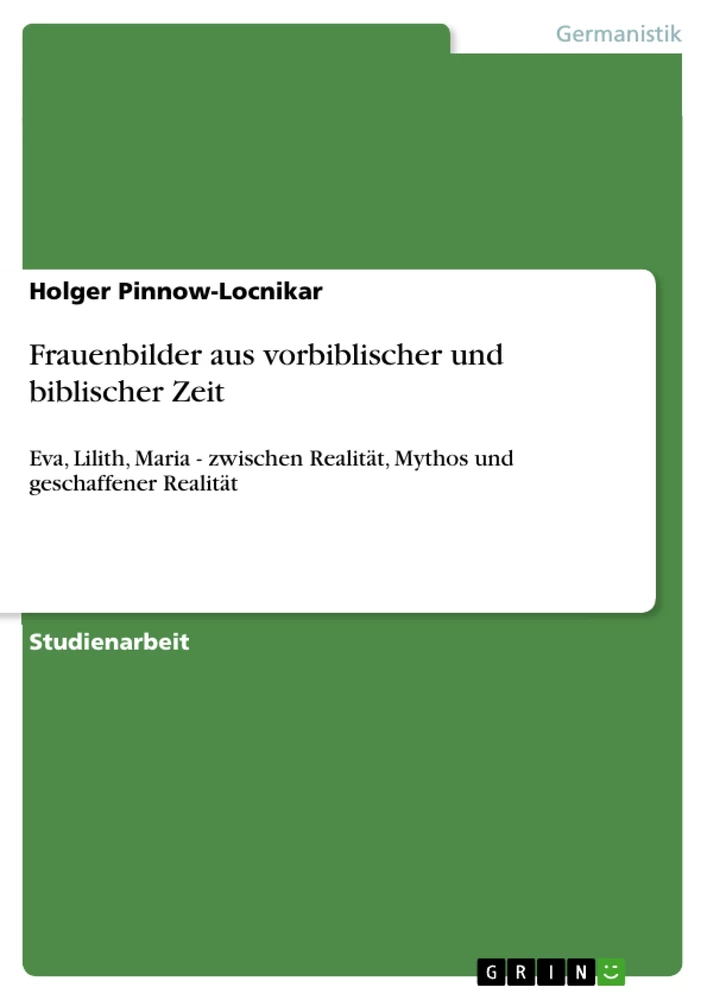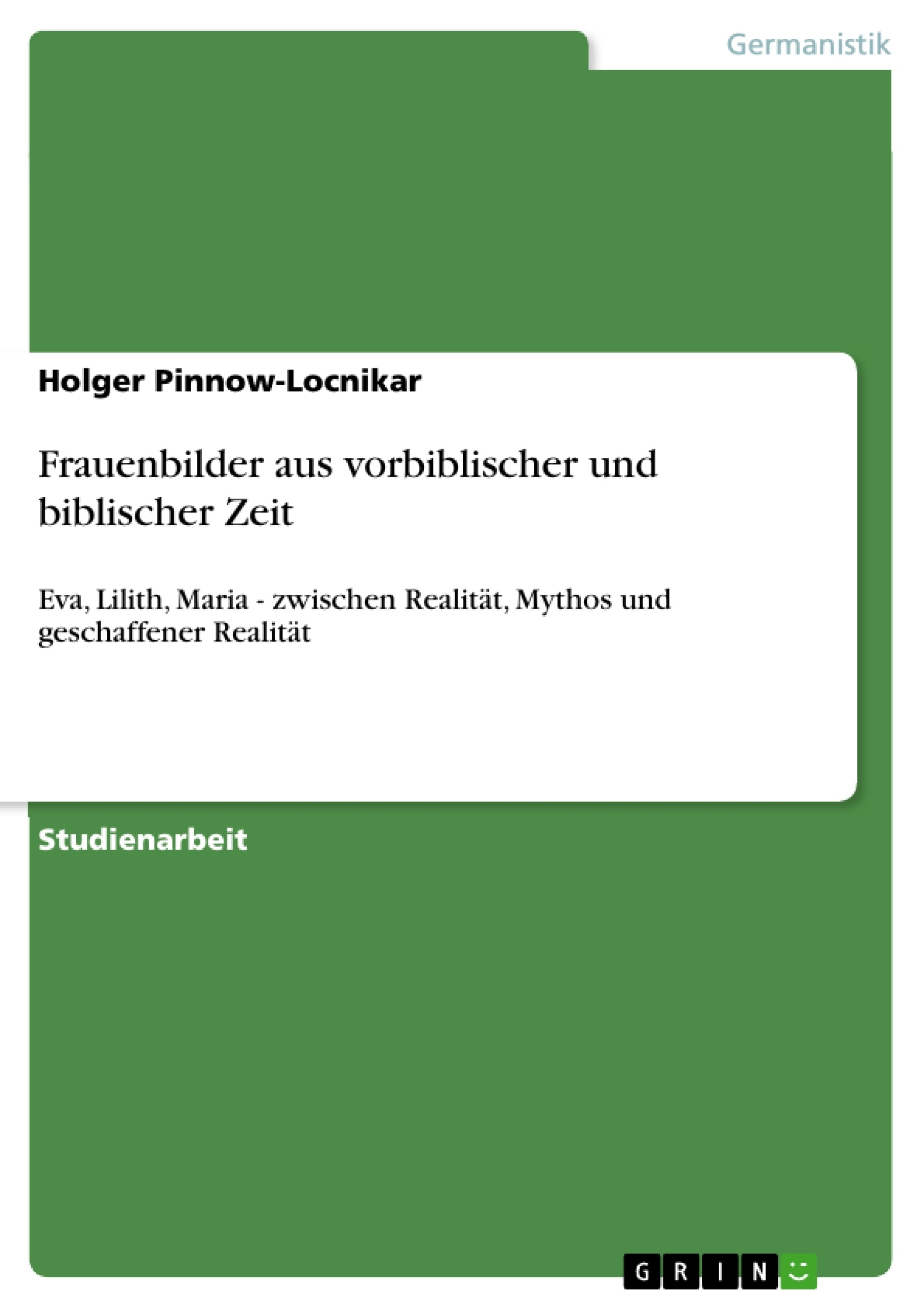Die vorliegende Veröffentlichung basiert auf einer Hausarbeit, die ich 2004 im Seminar „Die Bibel“ an der Universität Bremen zur Beurteilung vorlegte. Die Arbeit wurde vom hoch geschätzten, inzwischen emeritierten Prof. Dr. Dieter Richter für „sehr gut“ befunden. Seinerzeit schrieb er mir in die Beurteilung: „Vieles kommt zusammen, fließt ineinander…: Philologie, Mythengeschichte, Theologie in klassischer und feministischer Spielart, gar noch Wirkungsgeschichte. Als Thema stellt sich für mich dar: die Bedeutung der Bibel, positiv wie negativ, für Grundkonstellationen unserer Geschlechterbeziehungen zu bestimmen. Ich bin dabei auch inhaltlich in vielem Ihrer Auffassung.“
Gleichwohl war Prof.Dr. Richter nicht in allem meiner Auffassung. Wir hatten im Anschluss an die Beurteilung eine angeregte und anregende Diskussion und auch in seinen Kommentar zur Arbeit flossen viele sinnvolle Hinweise und Denkanstöße ein. Dafür möchte ich mich mit dieser Veröffentlichung noch einmal bedanken, denn mit dem Abstand der Jahre erscheint es mir angemessen, die vielen angeregten Detailverbesserungen auch in die hier vorliegende Veröffentlichung einfließen zu lassen.
Die Bibel gilt gemeinhin als eines der wichtigsten Bücher, vielleicht sogar als das wichtigste überhaupt in unserer westlichen Welt, und das obwohl wir in einer weitestgehend säkularisierten Gesellschaft leben, in der zumindest die christliche Religion im Alltag nur noch einen marginalen Stellenwert zu haben scheint.
Aber der Eindruck täuscht: Der Wertekanon unserer westlichen, christlich geprägten Gesellschaft leitet sich aus der Bibel ab, mal sehr, mal weniger direkt.
Das trifft auch auf die Rolle der Frau in der christlichen Gesellschaft zu. Diese hat sich zwar über die Jahrhunderte durchaus verändert und verfügt über einen gewissen, gesellschaftlich und allgemein anthropologisch bedingten Facettenreichtum, aber in der Grundstruktur des Geschlechterverhältnisses und der Frauenrollen scheinen immer noch die biblischen Wurzeln durch.
Für mich persönlich immer wieder erstaunlich ist, dass gerade die biblische Geschichte über die Schöpfung des Menschen und über den so genannten „Sündenfall“ so große Auswirkungen auf das gesellschaftliche Selbstverständnis der Frau und auch auf das Verständnis der Männer bezüglich der Frauen haben konnte und immer noch hat, obwohl gerade die Genesis ein "Schöpfungsmythos" ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Quellen und Zitierweisen
- Ältere Schöpfungsgeschichten
- Die Entstehung des Pentateuchs
- Die Genesis
- Die Schöpfung des Menschen: Eva kommt auf die Welt
- Der „Sündenfall“
- Die Erfindung der Erbsünde
- Zwischenfazit
- Lilith die erste Eva?
- Zwischenfazit
- Exkurs: Frauenleben zur Zeit der Geburt Jesu
- Maria - von der Frau zur Ikone
- Wirkungsgeschichte
- Zwischenfazit
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Frauen in vorbiblischen und biblischen Texten, insbesondere die Figuren Eva, Lilith und Maria. Die Zielsetzung besteht darin, die literaturhistorische Entwicklung dieser Bilder und ihre Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart zu beleuchten. Dabei wird der Einfluss der biblischen Schöpfungsgeschichte auf das gesellschaftliche Frauenbild analysiert.
- Die Entstehung und Interpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte
- Der Vergleich der Frauenfiguren Eva, Lilith und Maria
- Die Wirkungsgeschichte dieser Frauenbilder auf das gesellschaftliche Selbstverständnis der Frau
- Der Einfluss der biblischen Tradition auf das Geschlechterverhältnis
- Die Relevanz der biblischen Schöpfungsmythen in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung der Bibel für das westliche Frauenbild dar. Sie betont den anhaltenden Einfluss der Genesis-Erzählung trotz der Säkularisierung und kündigt den Forschungsansatz an, der sowohl die Entstehungsgeschichte der Texte als auch ihre Wirkungsgeschichte untersucht. Die Autorin hebt die Bedeutung der Figuren Eva, Lilith und Maria für die Untersuchung hervor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
Ältere Schöpfungsgeschichten: Dieses Kapitel behandelt die Schöpfungsmythen vor der Genesis und liefert einen wichtigen Kontext für das Verständnis der biblischen Schöpfungsgeschichte. Es beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Überlieferungen, die in die Genesis eingeflossen sind, und zeigt die Entwicklung des Menschenbildes auf. Durch den Vergleich mit anderen Mythen wird die Einzigartigkeit, aber auch die Gemeinsamkeiten der biblischen Erzählung deutlich.
Die Genesis: Dieses Kapitel analysiert die Schöpfungsgeschichte der Genesis im Detail. Die Analyse umfasst die Schöpfung des Menschen, den Sündenfall und die Erfindung der Erbsünde. Es werden die literarischen Techniken und die theologischen Implikationen der Erzählung untersucht, um die Entstehung des Frauenbildes in der westlichen Kultur zu verstehen. Die Autorin beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Genesis und deren Auswirkungen auf die Rolle der Frau.
Lilith die erste Eva?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Figur Lilith, einer vorbiblischen Gestalt, die oft als alternative "erste Eva" interpretiert wird. Es untersucht die Mythen und Legenden um Lilith und analysiert deren Bedeutung im Kontext von Feminismus und New Age-Bewegungen. Der Vergleich mit der biblischen Eva wird herangezogen, um die unterschiedlichen Frauenbilder und deren gesellschaftliche Implikationen zu beleuchten.
Maria - von der Frau zur Ikone: Dieses Kapitel analysiert die Figur Maria, der Mutter Jesu. Die Untersuchung umfasst Marias Rolle in den Evangelien und ihre spätere Entwicklung zur wichtigen religiösen Ikone. Die Autorin beleuchtet die verschiedenen Interpretationen und die Wirkungsgeschichte Marias bis in die Gegenwart, mit besonderem Fokus auf deren Einfluss auf das Frauenbild.
Schlüsselwörter
Biblische Schöpfungsgeschichte, Eva, Lilith, Maria, Frauenbild, Geschlechterverhältnis, Wirkungsgeschichte, Literaturgeschichte, Feminismus, Patriarchat, Mythos, Genesis, Religionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu: Darstellung von Frauen in vorbiblischen und biblischen Texten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Frauen in vorbiblischen und biblischen Texten, insbesondere die Figuren Eva, Lilith und Maria. Sie beleuchtet die literaturhistorische Entwicklung dieser Bilder und ihre Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart, analysiert den Einfluss der biblischen Schöpfungsgeschichte auf das gesellschaftliche Frauenbild und untersucht die Relevanz der biblischen Schöpfungsmythen in der heutigen Gesellschaft.
Welche Figuren stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentralen Figuren der Analyse sind Eva, Lilith und Maria. Die Arbeit vergleicht diese Frauenfiguren und untersucht ihre unterschiedlichen Darstellungen und ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Selbstverständnis der Frau.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Interpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte, den Vergleich der Frauenfiguren Eva, Lilith und Maria, die Wirkungsgeschichte dieser Frauenbilder auf das gesellschaftliche Selbstverständnis der Frau, den Einfluss der biblischen Tradition auf das Geschlechterverhältnis und die Relevanz der biblischen Schöpfungsmythen in der heutigen Gesellschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu älteren Schöpfungsgeschichten, die Genesis (einschließlich der Schöpfung des Menschen, des Sündenfalls und der Erfindung der Erbsünde), Lilith als mögliche "erste Eva", Maria als Frau und Ikone, sowie ein Zwischenfazit, eine Schlussbetrachtung und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse und Interpretation der jeweiligen Thematik.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche und religionsgeschichtliche Methode. Sie analysiert die Texte, untersucht ihre Entstehungsgeschichte und ihre Wirkungsgeschichte und vergleicht verschiedene Interpretationen und Perspektiven.
Welche Bedeutung hat die Genesis in dieser Arbeit?
Die Genesis spielt eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für das westliche Frauenbild bildet. Die Arbeit analysiert die Schöpfungsgeschichte im Detail, untersucht ihre literarischen Techniken und theologischen Implikationen und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen und deren Auswirkungen auf die Rolle der Frau.
Welche Rolle spielt Lilith in der Arbeit?
Lilith, oft als alternative "erste Eva" interpretiert, wird im Kontext von Mythen, Legenden, Feminismus und New Age-Bewegungen untersucht. Der Vergleich mit der biblischen Eva verdeutlicht unterschiedliche Frauenbilder und deren gesellschaftliche Implikationen.
Welche Bedeutung hat Maria in dieser Arbeit?
Maria, die Mutter Jesu, wird als wichtige religiöse Ikone analysiert. Die Arbeit beleuchtet ihre Rolle in den Evangelien, ihre Entwicklung zur Ikone und ihre Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart, mit besonderem Fokus auf ihren Einfluss auf das Frauenbild.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Biblische Schöpfungsgeschichte, Eva, Lilith, Maria, Frauenbild, Geschlechterverhältnis, Wirkungsgeschichte, Literaturgeschichte, Feminismus, Patriarchat, Mythos, Genesis, Religionsgeschichte.
- Quote paper
- Holger Pinnow-Locnikar (Author), 2004, Frauenbilder aus vorbiblischer und biblischer Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157752