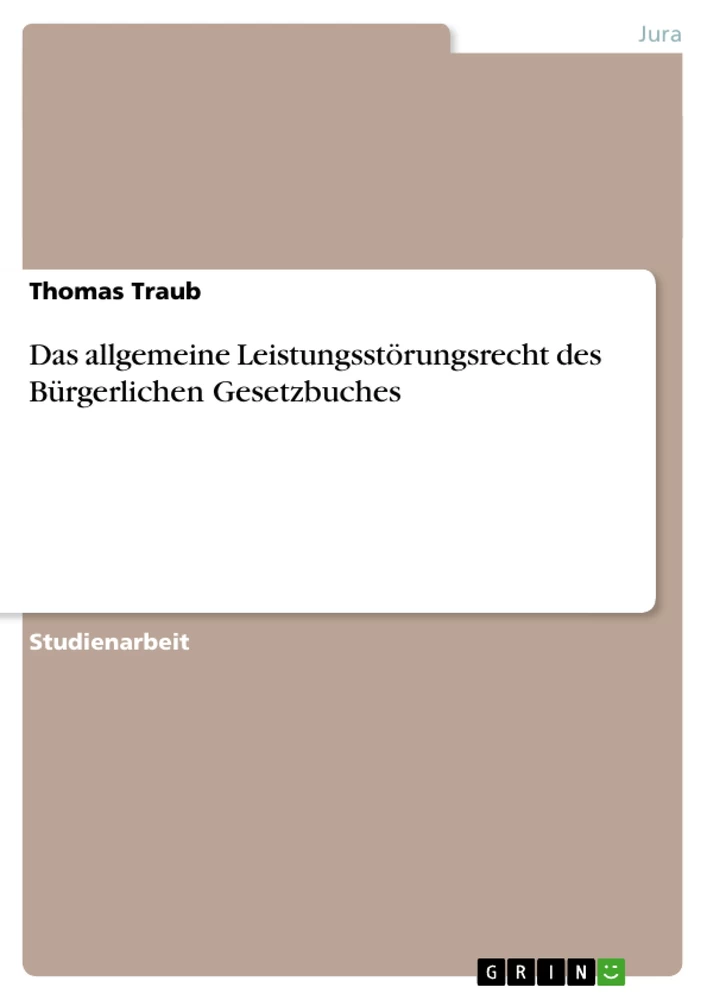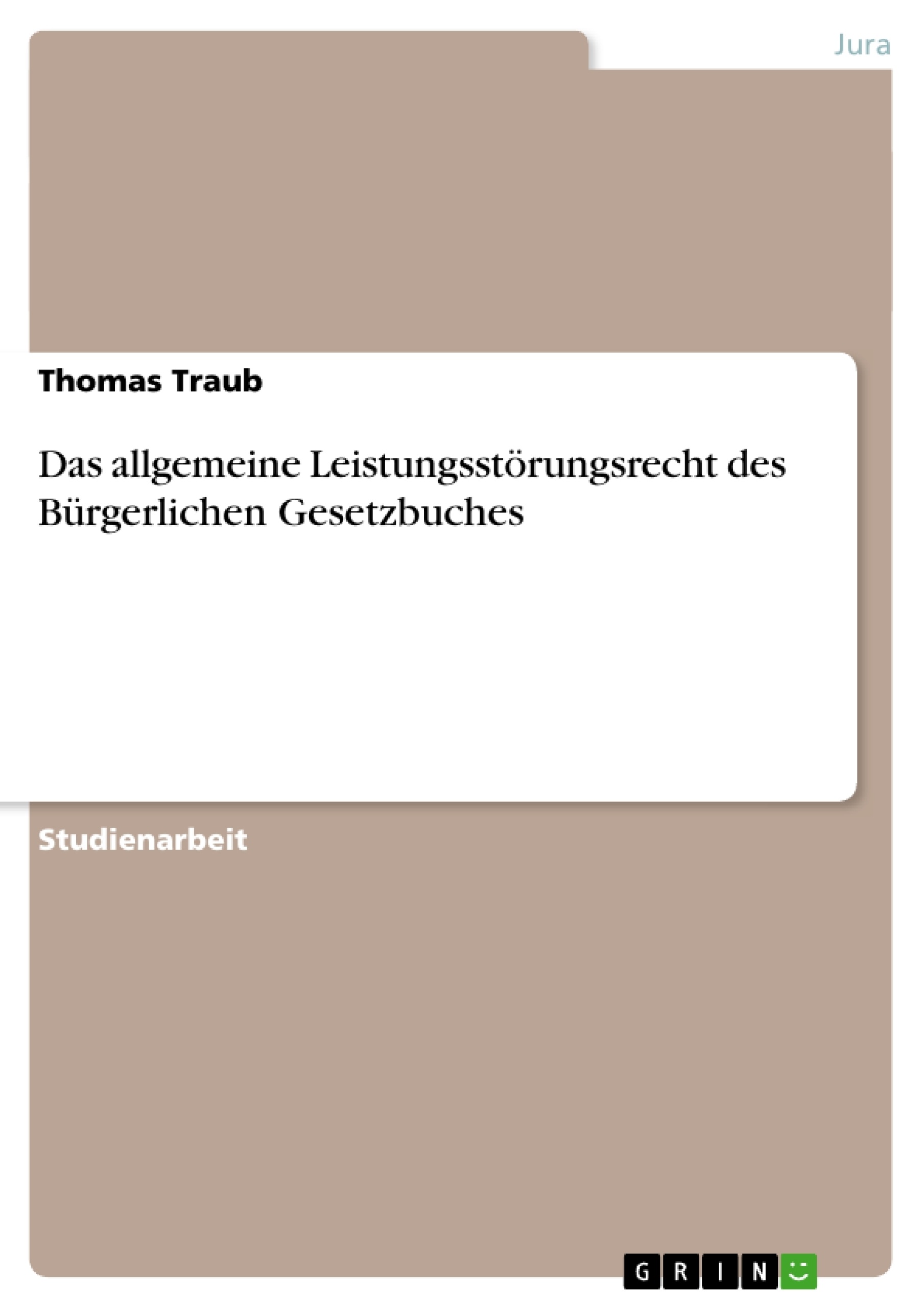Die Arbeit gibt einen Überblick über das allgemeine Leistungsstörungsrecht nach dem BGB und ist im Rahmen eines Deutsch – Polnisches Seminars der Universitäten Heidelberg, Krakau und Mannheim zum Thema „Schuldrecht und seine Reformen“ entstanden.
Der Autor stellt weniger die in den Kommentaren zum BGB ausführlich und umfassend behandelten Detailprobleme dar, sondern bietet einen systematischen Überblick über die Regelungen des Leistungsstörungsrechts im BGB.
Ausgangspunkt ist dabei die Unmöglichkeit der Leistung und deren verschiedene Facetten in Form der anfänglichen, nachträglichen, subjektiven oder objektiven Unmöglichkeit.
Ebenso werden die Fälle von Schuldnerverzug und Gläubigerverzug dargestellt.
Anschließend arbeitet der Autor anhand des Kaufrechts exemplarisch die Strukturen der Gewährleistung heraus. Einen weiteren Schwerpunkt bildet eine Analyse der traditionell nicht kodifizierten Rechtsfiguren der „culpa in contrahendo“, der positiven Forderungsverletzung und des Wegfalls der Geschäftsgrundlage.
Die Arbeit differenziert bei sämtlichen Fallgestaltungen deutlich die zentralen Fragen nach dem Primäranspruch, möglichen Sekundäransprüchen und den Folgen der Leistungsstörung für den Gegenanspruch, um die systematische Struktur des Leistungsstörungsrechts zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Überblick über die Regelung der Leistungsstörungen im BGB
- Unmöglichkeit
- Teil 2 A. Einführung
- I. Allgemeines
- II. Systematik
- III. Problemstellungen bei der Unmöglichkeit
- IV. Begriff der Unmöglichkeit
- 1. Physische Unmöglichkeit
- 2. Faktische Unmöglichkeit
- 3. Zweckerreichung und -fortfall
- B. Anfängliche Unmöglichkeit
- I. Tatbestand
- II. Rechtsfolge und Sekundäransprüche
- C. Anfängliches Unvermögen
- D. Nachträgliche Unmöglichkeit und Unvermögen
- I. Grundlagen
- 1. Primäranspruch
- 2. Sekundäranspruch
- II. Besonderheiten beim gegenseitigen Vertrag
- 1. Die von Schuldner und Gläubiger nicht zu vertretende Unmöglichkeit
- 2. Die vom Schuldner zu vertretende Unmöglichkeit
- aa) Schadensersatz wegen Nichterfüllung
- bb) Rücktritt
- cc) Verweis auf die Möglichkeiten des § 323
- 3. Die vom Gläubiger zu vertretende Unmöglichkeit nach § 324 I
- Teil 3 Schuldnerverzug
- A. Voraussetzungen
- 1. Nichtleistung trotz Möglichkeit der Leistung
- 2. Fälligkeit
- 3. Mahnung
- 4. Vertretenmüssen
- B. Rechtsfolgen
- 1. Verzögerungsschaden
- 2. Schadensersatz wegen Nichterfüllung
- a) § 286 II
- b) § 326 - Nachfrist und Ablehnungsandrohung
- c) § 326 - Rechtsfolgen
- 3. Haftungsverschärfung
- Teil 4 Gläubigerverzug
- A. Voraussetzungen
- B. Rechtsfolgen
- 1. Haftungsmilderungen
- 2. Leistungsgefahrübergang bei Gattungsschulden
- 3. Übergang der Gegenleistungsgefahr nach § 324 II
- 4. Ersatz von Mehraufwendungen
- Teil 5 Positive Forderungsverletzung
- A. Entstehung
- B. Mitwirkungspflichten
- Teil 6 Gewährleistungsrecht am Beispiel des Sachkaufs
- A. Grundgedanken der Gewährleistung beim Stückkauf
- B. Abgrenzung des „besonderen“ Leistungsstörungsrechts zu den allgemeinen Vorschriften – Anwendbarkeit der §§ 459 ff.
- Teil 7 Culpa in contrahendo
- A. Entstehung
- B. Voraussetzungen
- I. Sonderverhältnis
- II. Pflichtverletzung
- 1. Verletzung von Schutz- und Fürsorgepflichten
- 2. Verletzung von Aufklärungs- und Informationspflichten
- 3. Abbruch von Vertragsverhandlungen
- III. Verschulden
- C. Rechtsfolge
- Teil 8 Wegfall der Geschäftsgrundlage
- A. Entstehung
- B. Voraussetzungen
- I. Zweckstörung
- II. Äquivalenzstörung
- III. Leistungserschwerung
- C. Rechtsfolge
- Teil 9 Das Prinzip der Verschuldenshaftung als grundlegendes Prinzip des Leistungsstörungsrechts im BGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Ziel ist es, die zentralen Regelungen und deren Anwendung im Detail darzustellen. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Arten von Leistungsstörungen und deren Rechtsfolgen.
- Unmöglichkeit der Leistungserbringung
- Schuldnerverzug und Gläubigerverzug
- Positive Forderungsverletzung
- Gewährleistungsrecht
- Culpa in contrahendo und Wegfall der Geschäftsgrundlage
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 1 Überblick über die Regelung der Leistungsstörungen im BGB: Dieser einleitende Teil bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Arten von Leistungsstörungen, die im BGB geregelt sind. Er dient als Grundlage für die detailliertere Betrachtung in den folgenden Teilen und schafft ein Verständnis für die systematische Einordnung der verschiedenen Problematiken. Die Bedeutung der klaren Strukturierung und der systematischen Darstellung des Leistungsstörungsrechts wird hier hervorgehoben.
Teil 2 A. Einführung: Dieser Teil legt die grundlegenden Begriffe und die Systematik des Leistungsstörungsrechts dar. Er behandelt den Begriff der Unmöglichkeit in seinen verschiedenen Facetten – physisch, faktisch und im Hinblick auf den Zweck – und differenziert zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit. Die systematische Herangehensweise an die Problematik der Unmöglichkeit ist hier von zentraler Bedeutung und wird detailliert erläutert.
Teil 3 Schuldnerverzug: Hier wird der Schuldnerverzug umfassend behandelt. Es werden die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs – Nichtleistung trotz Leistungsfähigkeit, Fälligkeit, Mahnung und Vertretenmüssen – detailliert untersucht. Die Arbeit analysiert die Rechtsfolgen, insbesondere Verzögerungsschaden und Schadensersatz wegen Nichterfüllung, und beleuchtet die Haftungsverschärfung im Zusammenhang mit Verzug.
Teil 4 Gläubigerverzug: Dieser Teil widmet sich dem Gläubigerverzug und seinen Auswirkungen. Die Voraussetzungen und Rechtsfolgen werden analysiert, wobei insbesondere die Haftungsmilderungen, der Leistungsgefahrübergang und der Übergang der Gegenleistungsgefahr im Fokus stehen. Der Ausgleich der Interessen von Schuldner und Gläubiger im Fall des Gläubigerverzugs wird ausführlich diskutiert.
Teil 5 Positive Forderungsverletzung: Die positive Forderungsverletzung wird hier definiert und ihre Entstehung erläutert. Der Fokus liegt auf den Mitwirkungspflichten der Vertragsparteien und deren Bedeutung für die Entstehung und den Umfang der Haftung. Die verschiedenen Konstellationen und Fallgruppen werden detailliert vorgestellt.
Teil 6 Gewährleistungsrecht am Beispiel des Sachkaufs: Dieser Abschnitt behandelt das Gewährleistungsrecht speziell im Kontext des Sachkaufs. Es werden die Grundgedanken der Gewährleistung beim Stückkauf erläutert und die Abgrenzung zum allgemeinen Leistungsstörungsrecht vorgenommen. Die Anwendbarkeit der §§ 459 ff. wird im Detail analysiert.
Teil 7 Culpa in contrahendo: Der Teil behandelt die Culpa in contrahendo, d.h. die Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen. Die Entstehung, die Voraussetzungen – Sonderverhältnis, Pflichtverletzung (insbesondere Schutz- und Fürsorgepflichten, Aufklärungs- und Informationspflichten), Vertragsabbruch und Verschulden – sowie die Rechtsfolgen werden umfassend erörtert.
Teil 8 Wegfall der Geschäftsgrundlage: Dieser Teil befasst sich mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage als eigenständiger Grund für die Anpassung oder Auflösung eines Vertragsverhältnisses. Die Entstehung, die Voraussetzungen (Zweckstörung, Äquivalenzstörung, Leistungserschwerung) und die Rechtsfolgen werden im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Leistungsstörungen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Unmöglichkeit, Schuldnerverzug, Gläubigerverzug, positive Forderungsverletzung, Gewährleistung, Sachkauf, Culpa in contrahendo, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Verschuldenshaftung, Primäranspruch, Sekundäransprüche, Mitwirkungspflichten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Leistungsstörungsrecht im BGB
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Leistungsstörungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der detaillierten Darstellung der verschiedenen Arten von Leistungsstörungen und deren Rechtsfolgen.
Welche Arten von Leistungsstörungen werden behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Arten von Leistungsstörungen: Unmöglichkeit (anfängliche und nachträgliche), Schuldnerverzug, Gläubigerverzug, positive Forderungsverletzung, sowie spezielle Aspekte wie Gewährleistungsrecht (am Beispiel des Sachkaufs), Culpa in contrahendo und den Wegfall der Geschäftsgrundlage.
Was versteht man unter anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit?
Anfängliche Unmöglichkeit liegt vor, wenn die Leistung bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unmöglich ist. Nachträgliche Unmöglichkeit tritt erst nach Vertragsschluss ein. Das Dokument erläutert die unterschiedlichen Rechtsfolgen für beide Fälle.
Wie sind Schuldnerverzug und Gläubigerverzug definiert?
Schuldnerverzug liegt vor, wenn der Schuldner trotz Möglichkeit der Leistungserbringung nicht rechtzeitig leistet. Gläubigerverzug hingegen entsteht, wenn der Gläubiger die Annahme der Leistung trotz Fälligkeit und Möglichkeit der Abnahme verweigert. Das Dokument beschreibt die jeweiligen Voraussetzungen und Rechtsfolgen detailliert.
Was ist eine positive Forderungsverletzung?
Eine positive Forderungsverletzung liegt vor, wenn der Schuldner seine vertraglichen Pflichten verletzt, ohne dass es sich um einen Verzug oder eine Unmöglichkeit handelt. Das Dokument erläutert die Entstehung und die Bedeutung der Mitwirkungspflichten der Vertragsparteien.
Wie wird das Gewährleistungsrecht im Kontext des Sachkaufs behandelt?
Das Dokument behandelt das Gewährleistungsrecht am Beispiel des Sachkaufs. Es erläutert die Grundgedanken der Gewährleistung und grenzt diese von den allgemeinen Vorschriften des Leistungsstörungsrechts ab. Die Anwendbarkeit der §§ 459 ff. BGB wird analysiert.
Was ist Culpa in contrahendo und wie wird sie behandelt?
Culpa in contrahendo bezeichnet das Verschulden bei Vertragsverhandlungen. Das Dokument erläutert die Entstehung, Voraussetzungen (Sonderverhältnis, Pflichtverletzung, Verschulden) und Rechtsfolgen der Culpa in contrahendo.
Was versteht man unter dem Wegfall der Geschäftsgrundlage?
Der Wegfall der Geschäftsgrundlage beschreibt eine Situation, in der die Grundlage des Vertragsverhältnisses wegfällt, so dass eine Anpassung oder Auflösung des Vertrages gerechtfertigt sein kann. Das Dokument erläutert die Entstehung, Voraussetzungen (Zweckstörung, Äquivalenzstörung, Leistungserschwerung) und Rechtsfolgen.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Leistungsstörungen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Unmöglichkeit, Schuldnerverzug, Gläubigerverzug, positive Forderungsverletzung, Gewährleistung, Sachkauf, Culpa in contrahendo, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Verschuldenshaftung, Primäranspruch, Sekundäransprüche, Mitwirkungspflichten.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Teilen des Leistungsstörungsrechts?
Das Dokument enthält ausführliche Kapitelzusammenfassungen, die einen detaillierten Einblick in die einzelnen Teile des Leistungsstörungsrechts bieten. Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht eine gezielte Navigation zu den jeweiligen Themenbereichen.
- Quote paper
- Thomas Traub (Author), 2001, Das allgemeine Leistungsstörungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15758