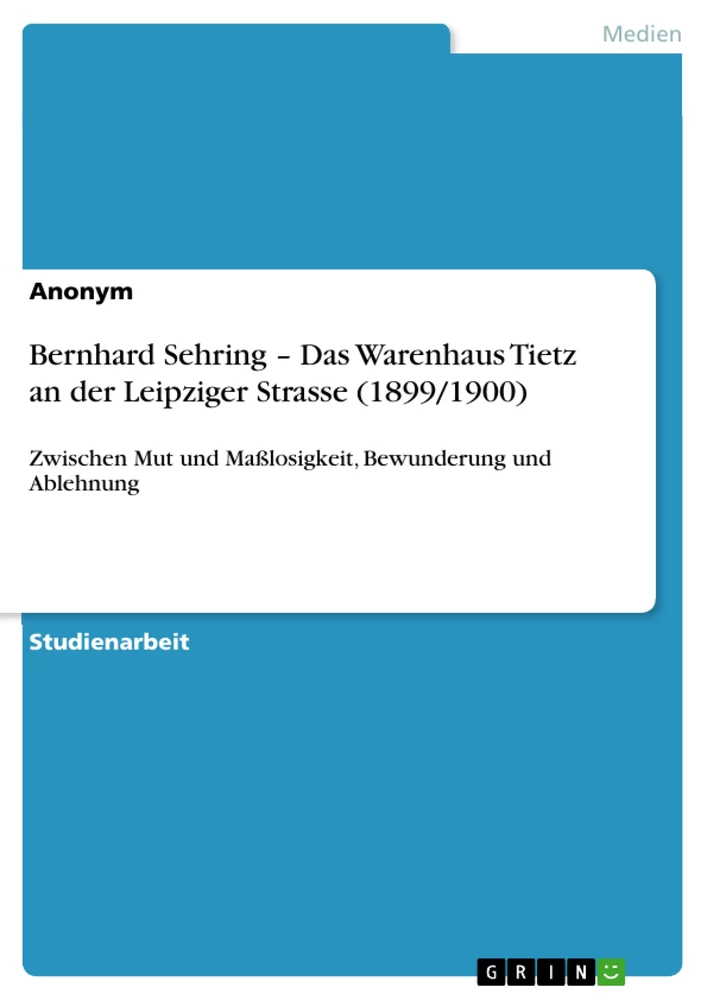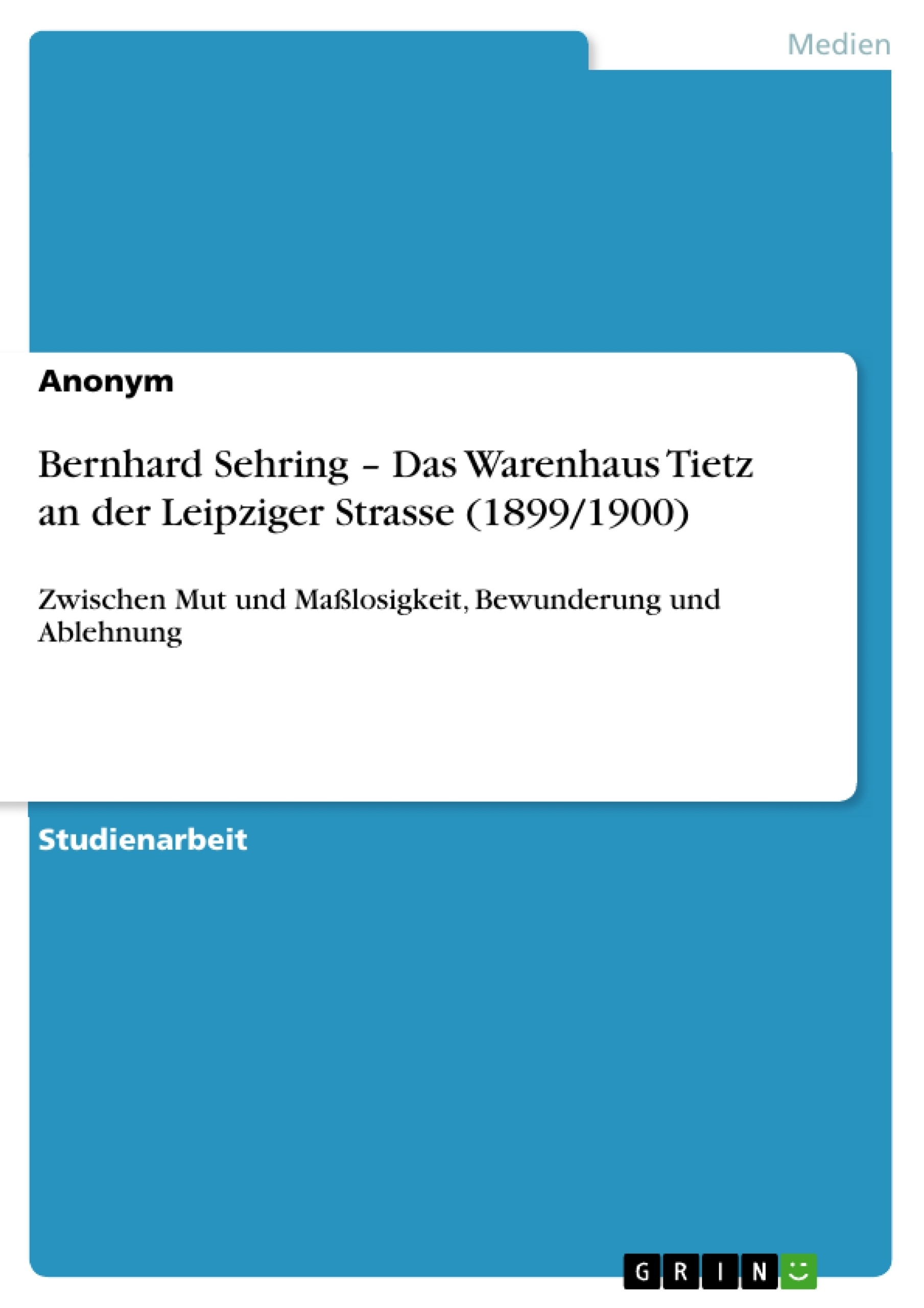Warenhäuser sind heutzutage vertraute Bestandteile einer städtischen Infrastruktur und gehören in größeren Städten zu einem Stück Alltagskultur, selbst wenn es derzeit schlecht um die Zukunft der Kauftempel stehen mag. Auf mehreren Stockwerken wird dem Kunden ein umfangreiches Warenangebot auf großen Verkaufsflächen präsentiert. Zu den bekanntesten Warenhäusern in Deutschland zählen heute unter anderem das Kaufhaus des Westens (KaDeWe), jahrzehntelang das Symbol von materiellem Wohlstand in der westlichen Welt, sowie diverse Karstadt- und Galeria Kaufhof-Filialen.
Die baugeschichtlichen und wirtschaftlichen Wurzeln des Warenhauses lassen sich jedoch schon in den orientalischen Bazaren und den Kaufhallen des Mittelalters finden. Den Grundstein für die Institution Warenhaus legten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Bazaranlagen in London und Paris, in denen zahlreiche Verkaufsstände um einen zentralen Lichthof herum angeordnet waren.
1872 eröffnete in Paris das erste berühmte, mehrstöckige Großwarenhaus. Dieses wurde zum einen Maßstab für die weiterhin in Paris entstandenen Warenhäuser und auch zum anderen Vorbild für die zukünftigen Warenhäuser in Deutschland, insbesondere in Berlin. Es war das „Au Bon Marche“ in der Rue de Sèvres (Abb. 1), welches nach Plänen der Architekten Laplanche und Sédille und dem Konstrukteur Gustav Eiffel errichtet wurde. Eine vertikal gegliederte Fassade mit weit geöffneten Glasflächen und Sprossenwerk, glasgedeckte Lichthöfe, aufwendig ausgestattete Räume mit Verspiegelungen, Täfelungen und durch Gaslicht erhellte Wände machten dieses Gebäude zu einem wahren Palast des Handels.1
[...]
1 Stürzebecher, Peter: Das Berliner Warenhaus. Bautypus, Element der Stadtorganisation, Raumsphäre der Warenwelt. Berlin 1979. S. 17.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bernhard Sehring
- Der Auftrag für die Fassadengestaltung des Warenhauses der H.&C. Tietz AG in Berlin durch Oscar Tietz
- Das Warenhaus Tietz
- Die Hauptfassade an der Leipziger Strasse
- Zwischen Mut und Maßlosigkeit, Bewunderung und Ablehnung
- Die Fassade an der Krausenstrasse
- Der Erweiterungsbau in der Jerusalemer Strasse und das Bauschicksal des Warenhauses
- Die Hauptfassade an der Leipziger Strasse
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Warenhaus Tietz an der Leipziger Straße in Berlin, erbaut um 1900, mit Fokus auf den Architekten Bernhard Sehring und den Bauherren Oscar Tietz. Ziel ist es, die architektonische Gestaltung des Gebäudes, insbesondere die umstrittene Hauptfassade, im Kontext der damaligen Berliner Bau- und Geschäftslandschaft zu analysieren.
- Die Rolle des Warenhauses im städtischen Kontext Berlins um 1900
- Die architektonische Gestaltung des Warenhauses Tietz durch Bernhard Sehring
- Der Einfluss Pariser Vorbilder auf die Berliner Warenhausarchitektur
- Die Rezeption und Kritik an der Fassade des Warenhauses Tietz
- Bernhard Sehrings Karriere und seine Bedeutung für die Berliner Architektur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Geschichte und Entwicklung von Warenhäusern ein, beginnend mit orientalischen Bazaren und mittelalterlichen Kaufhallen bis hin zu den bahnbrechenden mehrstöckigen Warenhäusern in Paris und Berlin. Sie betont die Bedeutung des Warenhauses als Bestandteil der städtischen Infrastruktur und stellt den Wertheim-Bau von Alfred Messel als ersten Berliner Meilenstein dieser Architektur vor. Der Text benennt das Warenhaus Tietz als ein ambitioniertes Projekt, das den Wertheim-Bau in seiner Repräsentanz übertreffen sollte und kündigt die folgende detaillierte Auseinandersetzung mit dem Bauwerk und seinen Schöpfern an.
2. Bernhard Sehring: Dieses Kapitel skizziert das Leben und Wirken des Architekten Bernhard Sehring. Es beschreibt seinen Werdegang von seinen kleinbürgerlichen Anfängen bis zu seinem Erfolg als Theaterbaumeister und Architekt. Der Text beleuchtet den Einfluss seiner frühen Umgebung und seiner Ausbildung auf seine spätere Arbeit. Sehrings Auszeichnungen, wie der Schinkelpreis, werden erwähnt und unterstreichen seine Bedeutung im Kontext der Berliner Architekturszene. Sein Wirken zeigt die Vielseitigkeit und den Erfolg Sehrings in der Architektur des wilhelminischen Zeitalters.
3. Der Auftrag für die Fassadengestaltung des Warenhauses der H.&C. Tietz AG in Berlin durch Oscar Tietz: Dieses Kapitel würde detailliert den Auftrag für die Gestaltung des Tietz-Warenhauses durch Oscar Tietz an Bernhard Sehring beleuchten. Es könnte den Kontext des Auftrags, die Vorstellungen des Bauherrn und die Herausforderungen für den Architekten beleuchten und die Entscheidungsprozesse, die zur Auswahl Sehrings führten, näher erläutern. Ein tieferer Einblick in die Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt würde die Entstehung des Gebäudes besser verstehen lassen.
4. Das Warenhaus Tietz: Dieses Kapitel würde sich umfassend mit der Architektur und Gestaltung des Warenhauses Tietz befassen. Es würde die Hauptfassade an der Leipziger Straße, die Fassade an der Krausenstraße und den Erweiterungsbau in der Jerusalemer Straße detailliert beschreiben und analysieren. Die verschiedenen architektonischen Elemente, Stilmerkmale und die kontroverse Rezeption der Fassade wären zentrale Aspekte der Analyse. Der Text würde die Bedeutung des Warenhauses Tietz im Kontext der Berliner Architektur und des damaligen Wirtschaftsbooms beleuchten.
Schlüsselwörter
Warenhausarchitektur, Berlin, Jahrhundertwende, Bernhard Sehring, Oscar Tietz, Leipziger Straße, Alfred Messel, Wertheim-Bau, Architekturkritik, wilhelminisches Zeitalter, Fassadengestaltung, städtebaulicher Kontext.
Häufig gestellte Fragen zum Text über das Warenhaus Tietz
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit dem Warenhaus Tietz an der Leipziger Straße in Berlin, erbaut um 1900. Im Mittelpunkt stehen der Architekt Bernhard Sehring, der Bauherr Oscar Tietz und die architektonische Gestaltung des Gebäudes, insbesondere die umstrittene Hauptfassade.
Welche Aspekte des Warenhauses Tietz werden behandelt?
Der Text analysiert die architektonische Gestaltung des Warenhauses, seine Rolle im städtischen Kontext Berlins um 1900, den Einfluss Pariser Vorbilder, die Rezeption und Kritik an der Fassade, sowie die Karriere und Bedeutung Bernhard Sehrings für die Berliner Architektur. Es werden die Hauptfassade an der Leipziger Straße, die Fassade an der Krausenstraße und der Erweiterungsbau in der Jerusalemer Straße detailliert untersucht.
Wer war Bernhard Sehring und welche Rolle spielte er?
Bernhard Sehring war der Architekt des Warenhauses Tietz. Der Text beschreibt sein Leben und Wirken, seinen Werdegang und den Einfluss seiner Ausbildung und frühen Umgebung auf seine Arbeit. Seine Bedeutung für die Berliner Architekturszene und sein Erfolg als Theaterbaumeister und Architekt werden hervorgehoben.
Welche Bedeutung hatte Oscar Tietz für das Projekt?
Oscar Tietz war der Bauherr des Warenhauses. Der Text beleuchtet seine Rolle bei der Beauftragung Sehrings und seine Vorstellungen für das Gebäude. Die Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt wird untersucht.
Wie wird die Fassade des Warenhauses Tietz beschrieben und bewertet?
Die Fassade wird als umstritten beschrieben und detailliert analysiert. Der Text untersucht die verschiedenen architektonischen Elemente, Stilmerkmale und die kontroverse Rezeption der Fassade im Kontext der damaligen Berliner Bau- und Geschäftslandschaft.
Welche anderen Berliner Warenhäuser werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt den Wertheim-Bau von Alfred Messel als ersten Berliner Meilenstein der Warenhausarchitektur und vergleicht das Warenhaus Tietz mit diesem in Bezug auf Repräsentanz und Ambition.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text umfasst Kapitel zur Einleitung, zu Bernhard Sehring, zum Auftrag für die Fassadengestaltung, zum Warenhaus Tietz selbst und zu einer Schlussbemerkung. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt des Themas, wie oben detaillierter beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Textes?
Schlüsselwörter sind: Warenhausarchitektur, Berlin, Jahrhundertwende, Bernhard Sehring, Oscar Tietz, Leipziger Straße, Alfred Messel, Wertheim-Bau, Architekturkritik, wilhelminisches Zeitalter, Fassadengestaltung, städtebaulicher Kontext.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für Personen gedacht, die sich für Architekturgeschichte, insbesondere die Berliner Architektur der Jahrhundertwende, interessieren. Er richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von architektonischen Themen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2009, Bernhard Sehring – Das Warenhaus Tietz an der Leipziger Strasse (1899/1900), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157582