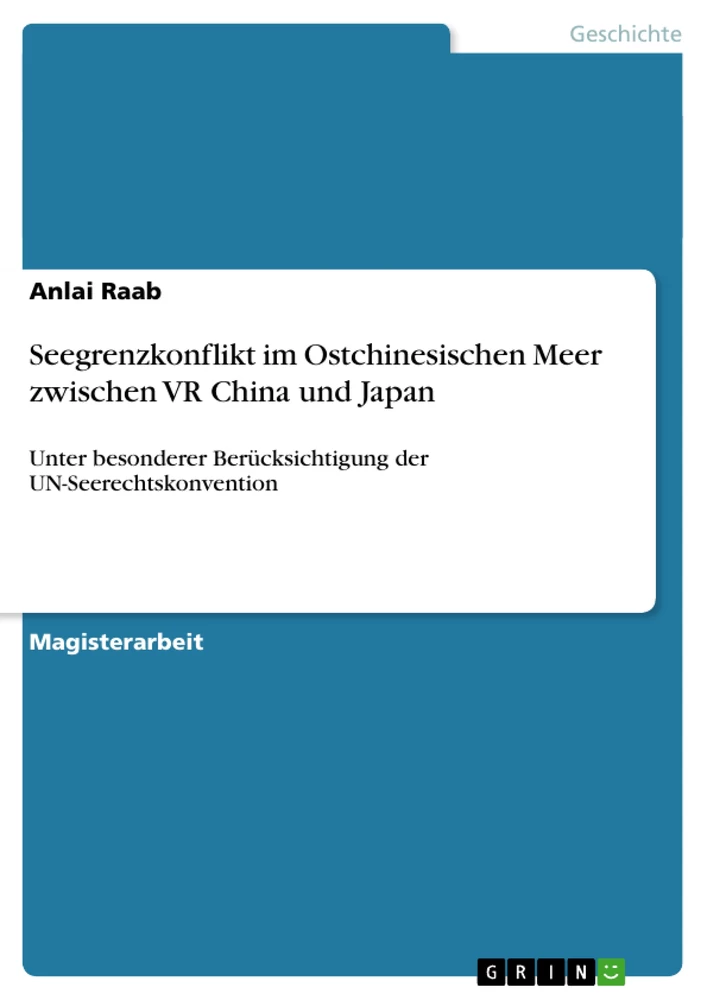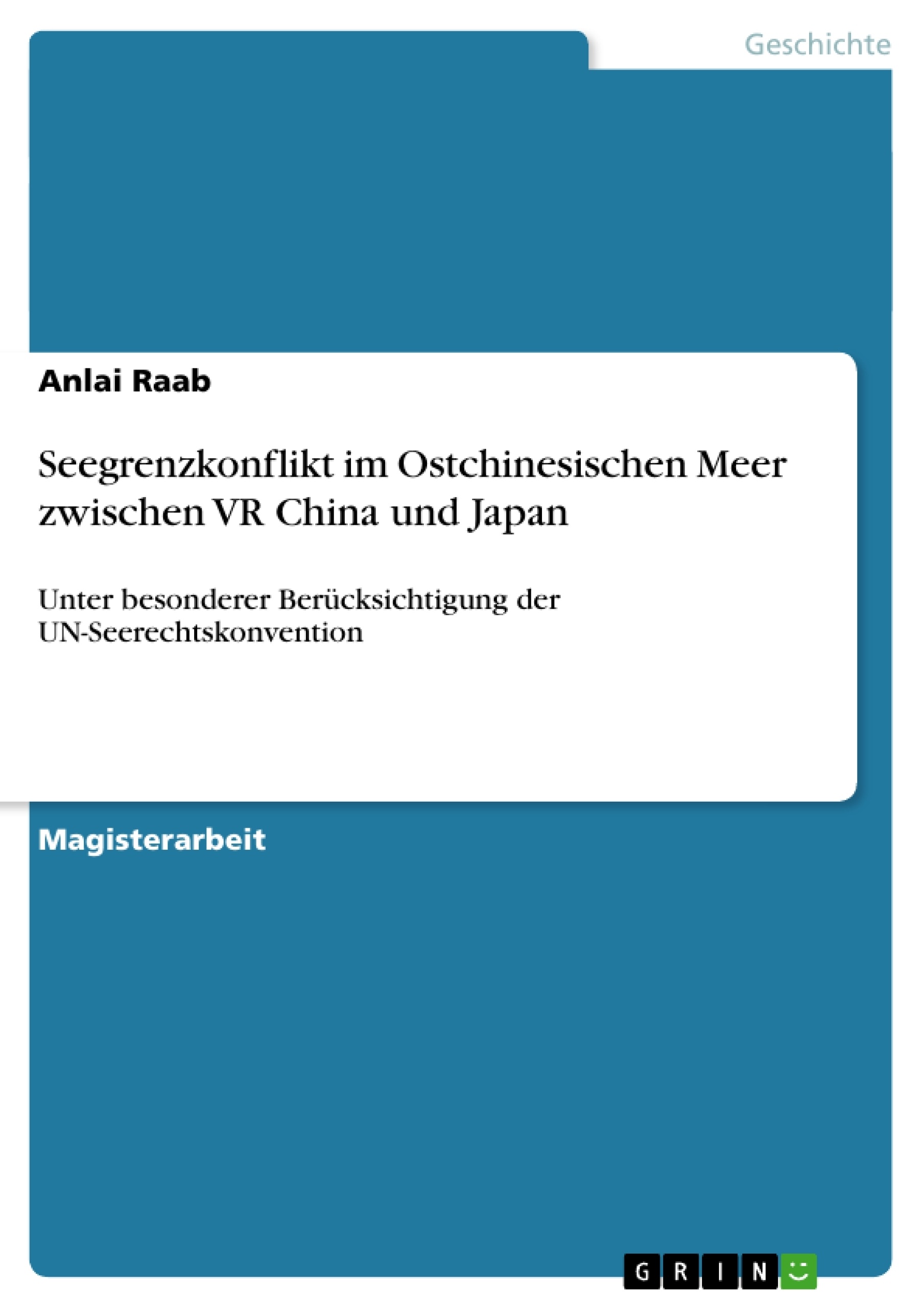Das Ostchinesische Meer (chin.: Donghai) ist ein Randmeer zwischen der östlichen Küste des chinesischen Festlandes und dem Pazifischen Ozean. Es verbindet Südkorea und das Gelbe Meer im Norden, die japanischen Inseln Kyûshû und das Ryûkyû-Archipel im Osten und Taiwan sowie das Südchinesischen Meer im Süden. Um die geographische Nähe zwischen China und Japan zu bezeichnen, werden die chinesischen Worte „Yi Yi Dai Shui“ und „Ge Hai Xiang Wang“ häufig verwendet, d. h. die beiden Nachbarländer werden durch den schmalen Wasserstreifen des Ostchinesischen Meeres getrennt und liegen doch einander gegenüber.
Warum wurde der Konflikt über die Seegrenzlinie zwischen China und Japan im Ostchinesischen Meer im Rahmen des UN-Seerechtsübereinkommens (UNSRK) bis heute noch nicht gelöst und warum eskaliert er zusätzlich durch die UNSRK? Welcher Rechtsstatus wird der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) und dem Festlandsockel in der UNSRK verliehen? Welche Probleme sind bei der Anwendung der AWZ und des Festlandsockels zu beachten und zu berücksichtigen? Nach welcher Rechtsordung - AWZ oder Festlandsockel - soll dieser Streit beigelegt werden? Welche Konfliktlösungen könnten sich eventuell ergeben?
Zu diesen Fragen gibt die folgende Arbeit zunächst einen Überblick über die asiatische und insbesondere chinesische Energiesituation, um den auslösenden Hintergrund dieses Konfliktes darzulegen. Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Zum einen werden die Standpunkte der Staaten China und Japan aus der Perspektive der UN-Seerechtskonvention eingehend dargestellt. Anschließend widme ich mich insbesondere den Fragen, die als Hauptunterschied zwischen China und Japan in der Auffassung über die Abgrenzung im Donghai auftreten, sowie die Anwendbarkeit der bezüglichen Artikel der UNSRK für den Konflikt im Ostchinesischen Meer. Zudem werden insbesondere Perspektiven des Völkerrechts in Präzedenzfällen vom Internationalen Gerichtshof (IGH) in der Praxis analysiert sowie die Auffassungen zahlreicher Experten und Wissenschaftler in diesem Bereich über die jeweiligen Streitpunkte des Konflikts dargestellt. Im letzten Teil werden die Lösungsmöglichkeiten dieses Konflikts aus der Sicht Chinas diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Das sino-japanische Verhältnis in der Gegenwart
- 1.2 Grenzkonflikte Chinas
- 1.3 Entstehung des Seegrenzkonfliktes zwischen China und Japan
- 2. Energiehunger in Ostasien
- 2.1 Allgemeine Energiesituation Asiens
- 2.2 Zunehmende Energieabhängigkeit im asiatisch-pazifischen Raum
- 2.2.1 Rohölkonsum in Ostasien
- 2.2.2 Hohe Abhängigkeit vom Ölimport aus dem Nahen und Mittleren Osten: am Beispiel Japans
- 2.3 Verschlechterte Energiesituation in der VR China
- 2.3.1 Schnell steigender Erdölkonsum
- 2.3.1.1 Beschleunigende Abhängigkeit des Erdölimports
- 2.3.1.2 Begrenzte Erdölreserven
- 2.3.2 Ungünstige Aufteilung des Energieträgers
- 2.3.2.1 Abhängigkeit von Kohle
- 2.3.2.2 Umweltunfreundlicher Energieträger – Kohle
- 2.3.2.3 Entwicklung des Erdgassektors
- 2.4 Zusammenfassung der Energieversorgung Chinas
- 3. Analyse des Grenzkonfliktes im Ostchinesischen Meer zwischen VR China und Japan
- 3.1 Hintergründe des Konfliktes
- 3.2 Auslöser des Konfliktes
- 3.3 Definition der AWZ und des Festlandsockels in der UN-Seerechtskonvention
- 3.3.1 Entstehung der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen
- 3.3.1.1 Historischer Überblick über den Festlandsockel auf der Ersten und Zweiten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen
- 3.3.1.2 Die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen
- 3.3.2 Definition der Ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels
- 3.3.2.1 Rechte der Ausschließlichen Wirtschaftszone
- 3.3.2.2 Rechte des Festlandsockels
- 3.3.2.3 Problematik der Vorschriften über die Ausschließliche Wirtschaftszone und den Festlandsockel
- a) Fehlende konkrete Normen zur Abgrenzung von AWZ und Festlandsockel benachbarter und gegenüberliegender Staaten
- b) Ungenaues Verhältnis zwischen der AWZ und dem Festlandsockel
- 3.4 Analyse der konkreten Probleme bei der Seegrenze im Ostchinesischen Meer zwischen China und Japan
- 3.4.1 Standpunkt der chinesischen Seite
- 3.4.2 Die Ansprüche Japans
- 3.4.3 Analyse der bezüglichen Fragen bei der Abgrenzung im Ostchinesischen Meer zwischen China und Japan
- 3.4.3.1 Anwendungen der Rechte über die AWZ und über den Festlandsockel
- 3.4.3.2 Das natürliche Verlängerungsprinzip und das 200 sm-Entfernungskriterium
- 3.4.3.3 Anwendung der Äquidistanzlinie-Methode
- 3.4.3.4 Anwendbarkeit der Okinawa-Tiefenlinie als natürliche Grenze zwischen China und Japan
- 3.4.3.5 Welche Rolle spielen die Diaoyu-Inseln im Ostchinesischen Meer bei der Abgrenzung des Festlandsockels?
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. Aussicht auf die Lösungsmöglichkeiten des sino-japanischen Seegrenzkonflikts
- 4.1 Kriegsmacht
- 4.2 Juristische Entscheidung
- 4.3 Politische Lösung - auf diplomatischem Wege
- 4.3.1 Abgrenzungsalternative
- 4.3.1.1 Zwei Grenzlinien (AWZ+Festlandsockel) im Ostchinesischen Meer?
- 4.3.1.2 Eine komplexe Grenzlinie nach der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips
- 4.3.2 Vorläufige Verständigung
- 4.3.2.1 Sperrung von Ausbeutung und Erschließung der Ressourcen
- 4.3.2.2 Gemeinsame Ausbeutung in Konfliktzonen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Seegrenzkonflikt im Ostchinesischen Meer zwischen der VR China und Japan, insbesondere im Kontext der UN-Seerechtskonvention. Ziel ist es, die unterschiedlichen Positionen beider Staaten zu analysieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Die sino-japanischen Beziehungen und ihre historische Entwicklung
- Die Energiesituation in Ostasien und die Abhängigkeit von Energieimporten
- Die rechtlichen Grundlagen des Seegrenzkonflikts nach der UN-Seerechtskonvention
- Die unterschiedlichen Interpretationen der UN-Seerechtskonvention durch China und Japan
- Mögliche Lösungsansätze für den Konflikt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses einführende Kapitel beleuchtet die gegenwärtigen sino-japanischen Beziehungen, die trotz wirtschaftlicher Annäherung durch historische und politische Konflikte belastet sind. Es skizziert die generellen Grenzkonflikte Chinas und fokussiert sich auf die Entstehung des Seegrenzkonflikts im Ostchinesischen Meer, der maßgeblich durch die Entdeckung potenzieller Erdöl- und Erdgasvorkommen und divergierende Interpretationen des Festlandsockels ausgelöst wurde. Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor und liefert einen Ausblick auf die folgende Struktur.
2. Energiehunger in Ostasien: Dieses Kapitel analysiert den enormen Energiebedarf Ostasiens und die damit verbundene zunehmende Abhängigkeit von Energieimporten, insbesondere aus dem Nahen und Mittleren Osten. Es beleuchtet die rapide wachsende Energieintensität Chinas, den hohen Anteil der Kohle am Energieverbrauch und die damit verbundenen Umweltprobleme. Im Fokus steht die zunehmende Abhängigkeit Chinas vom Erdölimport und die begrenzten einheimischen Reserven. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der Suche nach alternativen Energiequellen, einschließlich der Meeresressourcen, und führt somit zum zentralen Konflikt im Ostchinesischen Meer.
3. Analyse des Grenzkonfliktes im Ostchinesischen Meer zwischen VR China und Japan: Dieser umfangreiche Kapitelteil bildet das Herzstück der Arbeit. Es beschreibt detailliert die historischen Hintergründe des Konflikts, beginnend mit den ersten Erkundungen des Meeresbodens und den daraus resultierenden territorialen Ansprüchen. Die Rolle der UN-Seerechtskonvention wird umfassend analysiert, wobei die unterschiedlichen Interpretationen der AWZ und des Festlandsockels durch China und Japan im Mittelpunkt stehen. Die Kapitel erörtert die Problematik fehlender konkreter Abgrenzungsnormen und das ungenaue Verhältnis zwischen AWZ und Festlandsockel in der Konvention. Die Arbeit beleuchtet die jeweiligen Standpunkte Chinas und Japans zur Abgrenzung, insbesondere die Bedeutung des Prinzips der natürlichen Verlängerung des Festlandsockels für China und die Anwendung der Äquidistanzlinie durch Japan. Schließlich wird die Rolle der Diaoyu/Senkaku-Inseln bei der Abgrenzung diskutiert.
4. Aussicht auf die Lösungsmöglichkeiten des sino-japanischen Seegrenzkonflikts: Das Kapitel bewertet verschiedene Lösungsansätze für den Seegrenzkonflikt. Es verwirft die Option eines militärischen Konflikts als völkerrechtswidrig und unrealistisch. Die Möglichkeit einer juristischen Lösung vor dem Internationalen Seegerichtshof wird diskutiert, wobei die potentiellen Vor- und Nachteile für beide Seiten abgewogen werden. Der Fokus liegt auf politischen Lösungen, insbesondere auf Verhandlungen und Kompromissen. Es werden verschiedene Abgrenzungsalternativen, darunter die Festlegung von zwei getrennten Grenzlinien oder einer komplexen Grenzlinie nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, sowie vorläufige Vereinbarungen wie die Sperrung der Konfliktzone oder die gemeinsame Ausbeutung der Ressourcen, untersucht und bewertet.
Schlüsselwörter
Seegrenzkonflikt, Ostchinesisches Meer, VR China, Japan, UN-Seerechtskonvention, Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ), Festlandsockel, natürliche Verlängerung, Äquidistanzlinie, Billigkeitsprinzip, Diaoyu/Senkaku-Inseln, Energiehunger, Ressourcenkonflikt, politische Lösung, diplomatische Verhandlungen, gemeinsame Erschließung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Seegrenzkonflikt im Ostchinesischen Meer zwischen China und Japan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Seegrenzkonflikt im Ostchinesischen Meer zwischen der Volksrepublik China und Japan. Sie untersucht die unterschiedlichen Positionen beider Staaten bezüglich der Abgrenzung der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) und des Festlandsockels im Kontext der UN-Seerechtskonvention und erörtert mögliche Lösungsansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die sino-japanischen Beziehungen, die Energiesituation in Ostasien und die Abhängigkeit von Energieimporten, die rechtlichen Grundlagen des Konflikts nach der UN-Seerechtskonvention, die unterschiedlichen Interpretationen der Konvention durch China und Japan, die Rolle der Diaoyu/Senkaku-Inseln, und mögliche Lösungsansätze wie diplomatische Verhandlungen, gemeinsame Erschließung von Ressourcen oder die Festlegung verschiedener Grenzlinien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einführung in den Konflikt und die relevanten Beziehungen. Kapitel 2 analysiert den Energiehunger in Ostasien und die damit verbundene Bedeutung der Meeresressourcen. Kapitel 3 untersucht detailliert den Seegrenzkonflikt selbst, unter Berücksichtigung der UN-Seerechtskonvention und der Standpunkte beider beteiligter Staaten. Kapitel 4 befasst sich mit verschiedenen Lösungsansätzen für den Konflikt.
Wie wird der Seegrenzkonflikt rechtlich betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Anwendung der UN-Seerechtskonvention, insbesondere die Definition der AWZ und des Festlandsockels. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen dieser Definitionen durch China und Japan, die Problematik fehlender konkreter Abgrenzungsnormen und die Rolle des Prinzips der natürlichen Verlängerung des Festlandsockels sowie der Äquidistanzlinie.
Welche Rolle spielen die Diaoyu/Senkaku-Inseln?
Die Diaoyu/Senkaku-Inseln spielen eine zentrale Rolle im Konflikt, da ihre Zugehörigkeit die Abgrenzung des Festlandsockels maßgeblich beeinflusst und die Ansprüche beider Staaten in diesem Gebiet beeinflusst.
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Lösungsansätze, darunter eine juristische Lösung vor dem Internationalen Seegerichtshof, diplomatische Verhandlungen und Kompromisse. Konkrete Abgrenzungsalternativen wie zwei separate Grenzlinien oder eine komplexe Grenzlinie nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, sowie die Möglichkeit einer gemeinsamen Erschließung von Ressourcen in der Konfliktzone werden erörtert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Seegrenzkonflikt, Ostchinesisches Meer, VR China, Japan, UN-Seerechtskonvention, Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ), Festlandsockel, natürliche Verlängerung, Äquidistanzlinie, Billigkeitsprinzip, Diaoyu/Senkaku-Inseln, Energiehunger, Ressourcenkonflikt, politische Lösung, diplomatische Verhandlungen, gemeinsame Erschließung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass eine friedliche Lösung des Konflikts über diplomatische Verhandlungen und Kompromisse angestrebt werden sollte. Die verschiedenen Lösungsansätze werden abgewogen und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
- Citar trabajo
- Anlai Raab (Autor), 2007, Seegrenzkonflikt im Ostchinesischen Meer zwischen VR China und Japan, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157460