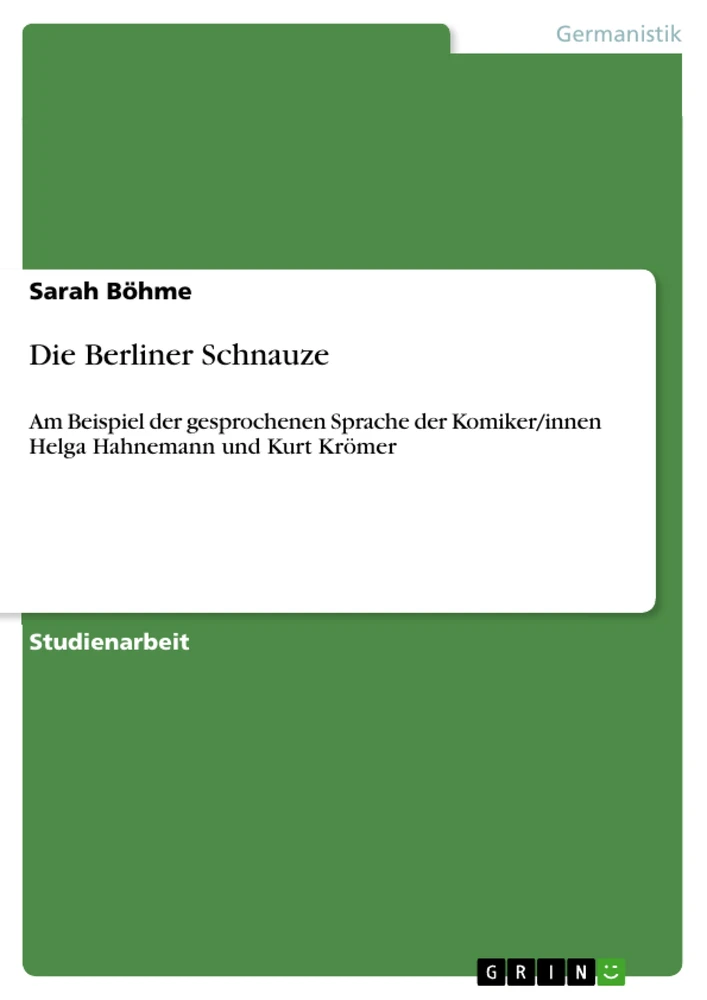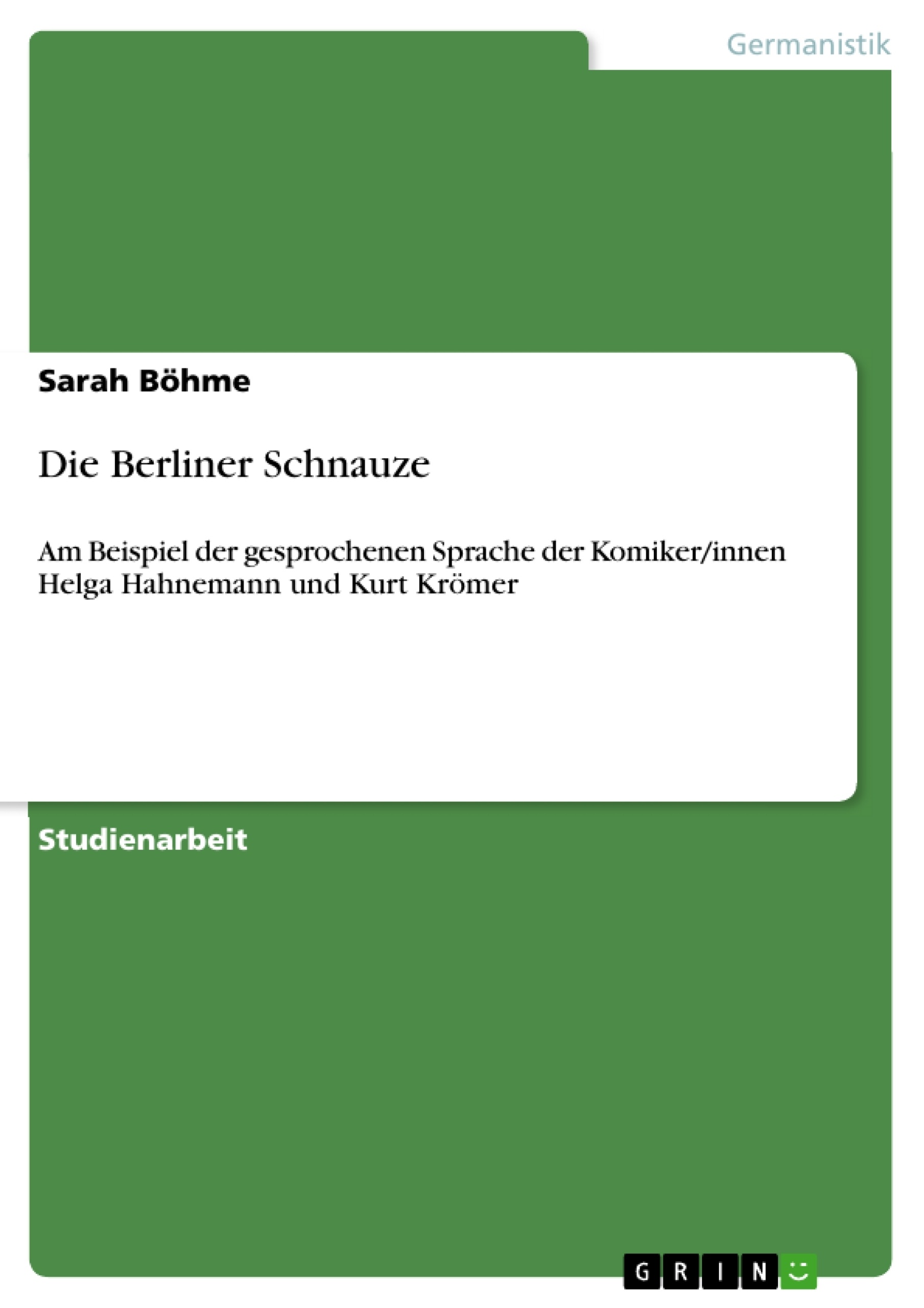Dem Berliner wird seit Jahrzehnten ein ganz spezieller, derber Humor zugesprochen, der nicht erst seit Zille und Tucholsky bekannt ist, durch sie aber seine Verbreitung in weiten Teilen Deutschlands fand. Auch heute noch ist die berühmt-berüchtigte ‚Berliner Schnauze‘ anzutreffen und – nicht nur in der Hauptstadt – beliebt, was die derzeit sehr erfolgreichen Komiker Mario Barth, Kurt Krömer oder Cindy aus Marzahn, die sich der „schnoddrigen Lustigkeit“ bedienen, belegen. Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich die so genannte ‚Berliner Schnauze‘ sowie den ihr anhaftenden Humor eingehender untersuchen. Hierzu werde ich im ersten Teil der Arbeit eine knappe Einführung in das Berlinische geben und dabei auch kurz auf die Zeit der Teilung Berlins zurückblicken und deren Auswirkung auf die Sprache knapp erläutern. Im Anschluss soll die ‚Berliner Schnauze‘ genauer betrachtet und dargelegt werden, was sie im Einzelnen ausmacht. Hieran anschließend folgt der Analyse-Teil der Arbeit, in dem ich anhand von transkribierten Videosequenzen von Liveauftritten der verstorbenen DDR-Komikerin Helga Hahnemann und des derzeit erfolgreichen Neuköllner Komikers Kurt Krömer die Besonderheiten
des Berlinischen aufzeigen und feststellen möchte, ob in deren Sprechweise die ‚Berliner Schnauze‘ nachzuweisen ist und ob eventuell Unterschiede bzgl. Ihrer Herkunft herauszufiltern sind.
Für die Erstellung dieser Hausarbeit habe ich mich hauptsächlich auf SCHLOBINSKI, DITTMAR und SCHÖNFELD gestützt, deren Studien aus den 80er und 90er Jahren die Basis des Forschungsgebietes ‚Berlinisch‘ waren und sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist 'Berlinisch'?
- Sprachliche Einflüsse auf das Berlinische
- Berlinisch in Ost und West
- Bewertung und Gebrauch des Berlinischen in Ost und West
- Was ist die 'Berliner Schnauze'?
- Die 'Berliner Schnauze' und die Theorie des Witzes
- Die 'Berliner Schnauze' als sprachschöpferisches Instrument
- Analyse
- Vorgehensweise
- „Icke, dette, kieke mal, Oogen, Fleesch und Beene. Die Berliner allzumal sprechen jar zu scheene“ – Die Lautung des Berlinischen
- „Ick liebe dir, ick liebe dich, wie't richtig heißt, dit weeß ick nich“ – Die Grammatik des Berlinischen
- Die Lexik des Berlinischen und die 'Berliner Schnauze‘
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Berliner Schnauze“ und ihren zugehörigen Humor. Zunächst wird das Berlinische als Sprachform eingeführt, inklusive eines kurzen Blicks auf die Auswirkungen der Berliner Teilung. Im Anschluss wird die „Berliner Schnauze“ genauer definiert und analysiert, anhand von Transkripten von Helga Hahnemann und Kurt Krömer.
- Definition und Charakterisierung des Berlinischen
- Einfluss der Berliner Teilung auf die Sprache
- Analyse der „Berliner Schnauze“ als sprachliches und kulturelles Phänomen
- Vergleichende Betrachtung der Sprechweise von Helga Hahnemann und Kurt Krömer
- Untersuchung der sprachlichen Besonderheiten im Kontext von Humor und Schlagfertigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, die „Berliner Schnauze“ und ihren derben Humor zu untersuchen. Sie erwähnt die Popularität der „Berliner Schnauze“ und die ausgewählten Komiker Helga Hahnemann und Kurt Krömer als Analyseobjekte. Die Arbeit stützt sich auf Studien von Schlobinski, Dittmar und Schönfeld.
Was ist 'Berlinisch'?: Dieses Kapitel definiert Berlinisch als die in Berlin vor allem im zwanglosen Gespräch verwendete Umgangssprache, die sich auf allen sprachlichen Ebenen vom Standarddeutschen unterscheidet. Es wird als heterogene Sprachform beschrieben, beeinflusst von Alter, Geschlecht, Wohnbezirk und Bildung der Sprecher. Der Einfluss des städtischen Umlands und ethnischer Diversität wird hervorgehoben. Schönfeld und Schlobinski werden als Quellen genannt.
Sprachliche Einflüsse auf das Berlinische: Hier wird der Einfluss verschiedener Sprachen und Dialekte (Niederdeutsch, Französisch, Jiddisch, Slawisch, Rotwelsch) auf das Berliner Lexikon beschrieben. Die starke Heterogenität der Stadtbevölkerung wird als Ursache für die Variationsbreite genannt.
Berlinisch in Ost und West: Dieses Kapitel behandelt die Auswirkungen der deutschen Teilung auf das Berlinische. Die 40-jährige Trennung der Stadt führte zu Kommunikationsbarrieren und divergierenden Entwicklungen, vor allem im lexikalisch-semantischen Bereich. Politische, ideologische und wirtschaftliche Unterschiede spiegelten sich in der Sprache wider (z.B. „Antifaschistischer Schutzwall“ vs. „Mauer“).
Bewertung und Gebrauch des Berlinischen in Ost und West: Eine Studie vergleicht die Sprachentwicklung in Zehlendorf, Wedding und Prenzlauer Berg. Es wird festgestellt, dass Berlinisch in Ost-Berlin häufiger verwendet und positiver bewertet wird als in West-Berlin, wo ein Dialektschwund zu beobachten ist.
Was ist die 'Berliner Schnauze'?: Dieses Kapitel definiert die „Berliner Schnauze“ nach Dittmar als regionalen Sprechstil mit spezifischen phonetischen, lexikalischen, morphosyntaktischen, pragmatischen und rhetorischen Merkmalen. Neben sprachlichen Eigenheiten werden derb-schnoddriger Humor, Schlagfertigkeit, Scharfsinn, Ironie und eine gewisse Grobheit als charakteristisch genannt. Der Erwerb der „Berliner Schnauze“ wird als schwieriger dargestellt als das Erlernen berlinischer Begriffe.
Schlüsselwörter
Berlinisch, Berliner Schnauze, Umgangssprache, Dialekt, Sprachentwicklung, Sprachvariation, Ost-Berlin, West-Berlin, deutsche Teilung, Humor, Schlagfertigkeit, Helga Hahnemann, Kurt Krömer, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Die Berliner Schnauze"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die „Berliner Schnauze“ und ihren zugehörigen Humor. Sie analysiert das Berlinische als Sprachform und beleuchtet den Einfluss der Berliner Teilung auf die Sprachentwicklung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der „Berliner Schnauze“ als sprachliches und kulturelles Phänomen, unter anderem anhand der Sprechweisen von Helga Hahnemann und Kurt Krömer.
Was ist unter "Berlinisch" zu verstehen?
Berlinisch wird in der Arbeit als die in Berlin vor allem im zwanglosen Gespräch verwendete Umgangssprache definiert, die sich auf allen sprachlichen Ebenen (Lautung, Grammatik, Lexik) vom Standarddeutschen unterscheidet. Es ist eine heterogene Sprachform, beeinflusst von Alter, Geschlecht, Wohnbezirk, Bildung der Sprecher sowie von städtischen Umland und ethnischer Diversität.
Welche sprachlichen Einflüsse werden auf das Berlinisch behandelt?
Die Arbeit beschreibt den Einfluss verschiedener Sprachen und Dialekte auf das Berlinische Lexikon, darunter Niederdeutsch, Französisch, Jiddisch, Slawisch und Rotwelsch. Die starke Heterogenität der Berliner Bevölkerung wird als Ursache für die Variationsbreite des Berlinischen genannt.
Wie hat die Berliner Teilung die Sprache beeinflusst?
Das Kapitel "Berlinisch in Ost und West" behandelt die Auswirkungen der deutschen Teilung auf das Berlinische. Die 40-jährige Trennung führte zu Kommunikationsbarrieren und divergierenden Entwicklungen, besonders im lexikalisch-semantischen Bereich. Politische, ideologische und wirtschaftliche Unterschiede spiegelten sich in der Sprache wider (z.B. „Antifaschistischer Schutzwall“ vs. „Mauer“).
Wie wird das Berlinische in Ost- und West-Berlin bewertet und verwendet?
Eine Studie, auf die die Arbeit Bezug nimmt, vergleicht die Sprachentwicklung in verschiedenen Berliner Bezirken (Zehlendorf, Wedding, Prenzlauer Berg). Es wird festgestellt, dass Berlinisch in Ost-Berlin häufiger verwendet und positiver bewertet wird als in West-Berlin, wo ein Dialektschwund zu beobachten ist.
Was ist die "Berliner Schnauze"?
Die „Berliner Schnauze“ wird nach Dittmar als regionaler Sprechstil mit spezifischen phonetischen, lexikalischen, morphosyntaktischen, pragmatischen und rhetorischen Merkmalen definiert. Neben sprachlichen Eigenheiten werden derb-schnoddriger Humor, Schlagfertigkeit, Scharfsinn, Ironie und eine gewisse Grobheit als charakteristisch genannt. Der Erwerb der „Berliner Schnauze“ wird als schwieriger als das Erlernen berlinischer Begriffe dargestellt.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert die „Berliner Schnauze“ anhand von Transkripten von Helga Hahnemann und Kurt Krömer. Sie stützt sich auf Studien von Schlobinski, Dittmar und Schönfeld und untersucht die sprachlichen Besonderheiten im Kontext von Humor und Schlagfertigkeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berlinisch, Berliner Schnauze, Umgangssprache, Dialekt, Sprachentwicklung, Sprachvariation, Ost-Berlin, West-Berlin, deutsche Teilung, Humor, Schlagfertigkeit, Helga Hahnemann, Kurt Krömer, Soziolinguistik.
- Quote paper
- Sarah Böhme (Author), 2009, Die Berliner Schnauze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157351