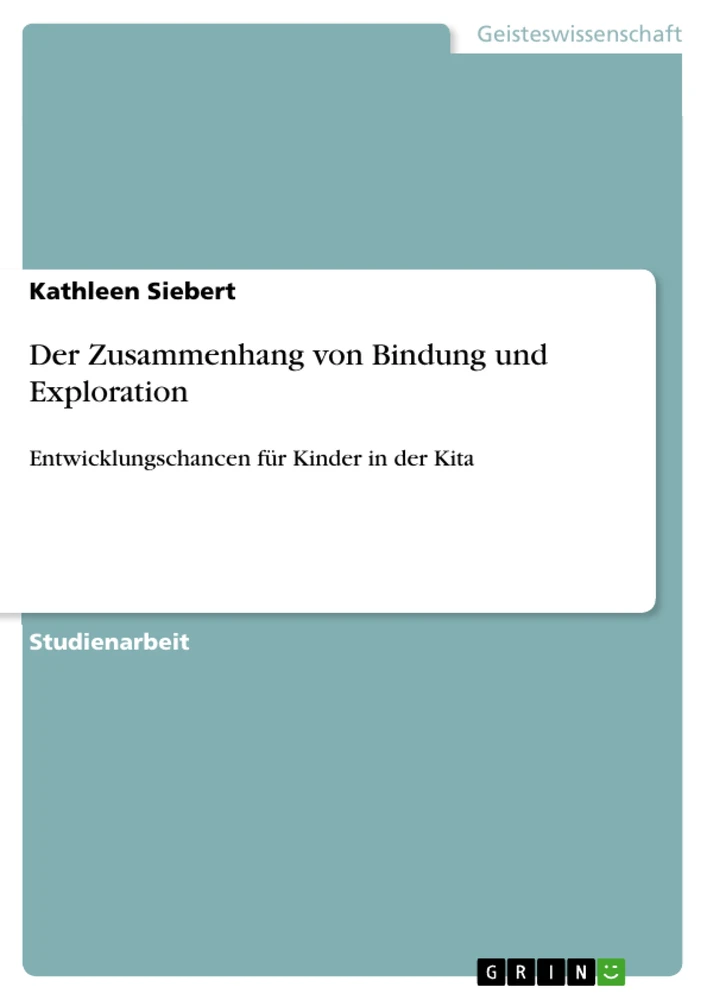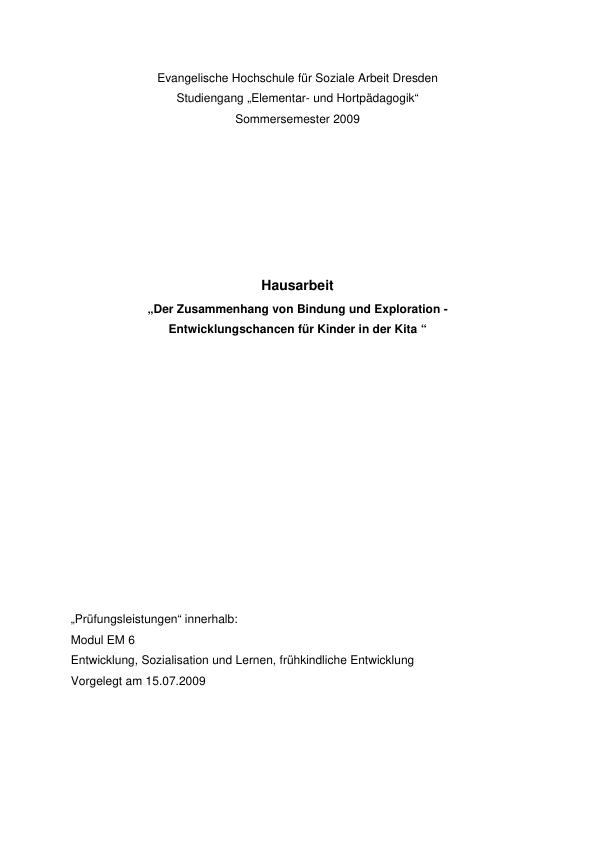Kennen Sie das aus Ihrer pädagogischen Praxis - „Julian kann überhaupt nicht spielen, rennt den ganzen Tag durch das Zimmer und räumt nur alles raus. Kontakt zu anderen Kindern findet er nicht. Aber ist ja auch kein Wunder, mit ihm beschäftigt sich ja auch keiner zu Hause.“ „Paula spielt nicht. Den ganzen Tag steht sie neben mir, verfolgt mich wie ein Schatten und findet keinen Kontakt zu anderen Kindern. Ist ja auch kein Wunder, zu Hause wird sie von allen bespielt.“
Diese zwei Aussagen, getroffen von Erzieherinnen beschreiben beobachtetes, unterschiedliches Spielverhalten zweier Kinder, dass vom „normalen“ alterstypischen Spielverhalten abzuweichen scheint. Die Abweichungen sind verschieden. Gleich ist bei beiden Beobachtungen, dass die Kinder sich nicht konzentriert und intensiv einer Sache hingeben können, soziale Kontakte zu anderen Kindern und gemeinsames Explorieren eingeschränkt sind und Verhaltensauffälligkeiten beobachtet werden.
Geht man davon aus, dass sich Kinder im Vorschulalter ihre Welt im Spiel erschließen, so sind die Entwicklungsmöglichkeiten von Julian und Paula eingeschränkt.
Die alltagstheoretischen Schlussfolgerungen der Erzieherinnen liefern keine hinreichende Begründung für ihr Verhalten. Was könnte die mögliche Ursache dafür sein, dass sie nicht neugierig und interessiert im Spiel mit anderen Kindern ihre Welt erforschen?
Nach Largo/Benz kann ein Kind nur spielen, wenn es sich wohl und geborgen fühlt. (vgl. Largo/Benz, 2003, 58) Warum fühlen diese Kinder sich nicht wohl und geborgen? Mögliche Ursachen werden in der vorliegenden Hausarbeit aus bindungstheoretischer Sicht dargestellt und Konsequenzen für die pädagogische Praxis abgeleitet.
Kapitel eins stellt die Grundannahmen der Bindungstheorie nach John Bowlby und die Erkenntnisse der Bindungsforschung Mary Ainsworths dar. Weiterhin wird auf die Entwicklung von Bindungsbeziehungen im Vorschulalter eingegangen.
In Kapitel zwei werden Bedeutung und Besonderheit von Exploration im Vorschulalter und der Zusammenhang zur Bindung dargestellt. Kapitel drei beschäftigt sich abschließend mit möglichen Konsequenzen für die pädagogische Praxis, um Kindern wie Julian und Paula breitere Entwicklungschancen eröffnen zu können.
Leider wird in Anbetracht des zur Verfügung stehenden Umfangs der Hausarbeit vieles nur angerissen und kurz erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Grundannahmen der Bindungstheorie
- 1.1 Bindungstheorie nach John Bowlby
- 1.2 Bindungsforschung Mary Ainsworths
- 1.3 Muster von Bindungsverhalten
- 1.3.1 Muster „Sicher gebunden“
- 1.3.2 Muster „Unsicher vermeidend gebunden“
- 1.3.3 Muster „Unsicher ambivalent gebunden“
- 1.3.4 Muster „Desorganisiert gebunden“
- 1.4 Bedingungen für die individuelle Entwicklung von Bindungsqualität
- 1.5 Bindungsbeziehungen im Verlauf der Entwicklung bis zum sechsten Lebensjahr
- 1.5.1 Bindungsentwicklung im Vorschulalter
- 1.5.2 Aufbau außerfamiliärer Bindungsbeziehungen – die Erzieherin-Kind Bindung
- 2 Exploration im Vorschulalter
- 2.1 Exploration als Voraussetzung für die Aneignung von Welt
- 2.2 Zusammenhang von Bindung und Exploration
- 2.3 Explorationsverhalten im Hinblick auf Bindungsmuster
- 2.3.1 Exploration sicher gebundener Kinder
- 2.3.2 Exploration unsicher vermeidend gebundener Kinder
- 2.3.3 Exploration unsicher-ambivalent gebundener Kinder
- 2.3.4 Exploration desorganisiert gebundener Kinder
- 3 Konsequenzen für die pädagogische Arbeit
- 3.1 Auswirkungen der unterschiedlichen Bindungsmuster auf die Entwicklung der Kinder
- 3.2 Entwicklungschancen durch Beachtung bindungstheoretischer Aspekte in der pädagogischen Arbeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bindung und Exploration im Vorschulalter und dessen Bedeutung für die Entwicklung von Kindern. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Entwicklung von Bindungsbeziehungen im Kontext der Kita zu erlangen und die Auswirkungen unterschiedlicher Bindungsmuster auf das Explorationsverhalten von Kindern zu beleuchten.
- Die Bedeutung der Bindungstheorie nach Bowlby für das Verständnis frühkindlicher Entwicklung
- Die verschiedenen Bindungsmuster und ihre Auswirkungen auf das Explorationsverhalten von Kindern
- Der Einfluss der Bindungsqualität auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen und die Fähigkeit zur emotionalen Regulation
- Die Bedeutung der Bindungsbeziehung zwischen Erzieherin und Kind für die Entwicklung von Kindern im Kita-Kontext
- Praktische Implikationen der Bindungstheorie für die pädagogische Arbeit in der Kita
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Grundannahmen der Bindungstheorie nach John Bowlby und die Erkenntnisse der Bindungsforschung Mary Ainsworths. Hier werden die verschiedenen Bindungsmuster und ihre Entstehung sowie die Bedeutung von sicheren und unsicheren Bindungsbeziehungen für die Entwicklung des Kindes dargestellt.
Das zweite Kapitel fokussiert auf die Bedeutung von Exploration im Vorschulalter und deren enge Verbindung zur Bindung. Es zeigt auf, wie die Exploration als Voraussetzung für die Aneignung von Welt gesehen werden kann und wie unterschiedliche Bindungsmuster das Explorationsverhalten von Kindern beeinflussen.
Das dritte Kapitel widmet sich den Konsequenzen der bindungstheoretischen Erkenntnisse für die pädagogische Praxis. Es wird verdeutlicht, wie die Berücksichtigung der Bindungsbedürfnisse von Kindern in der Kita zu einer optimalen Entwicklung beitragen kann.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, John Bowlby, Mary Ainsworth, Bindungsmuster, Exploration, Vorschulalter, Entwicklung, Kita, Erzieherin-Kind-Bindung, pädagogische Praxis, Entwicklungschancen, Sozialisation, Lernen, frühkindliche Entwicklung
- Quote paper
- Kathleen Siebert (Author), 2009, Der Zusammenhang von Bindung und Exploration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157307