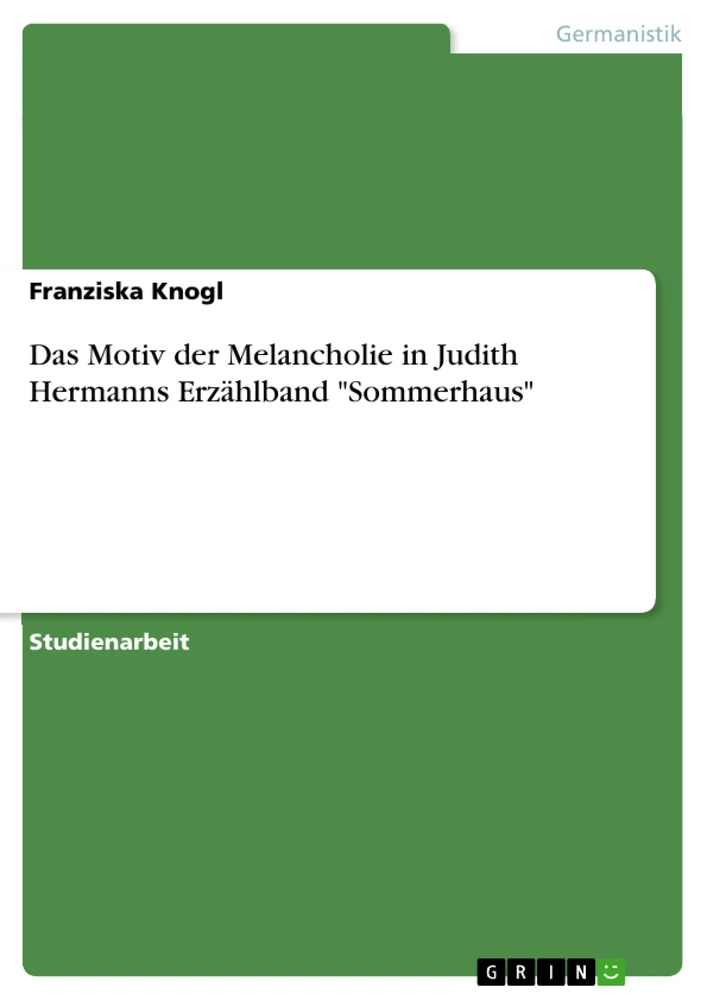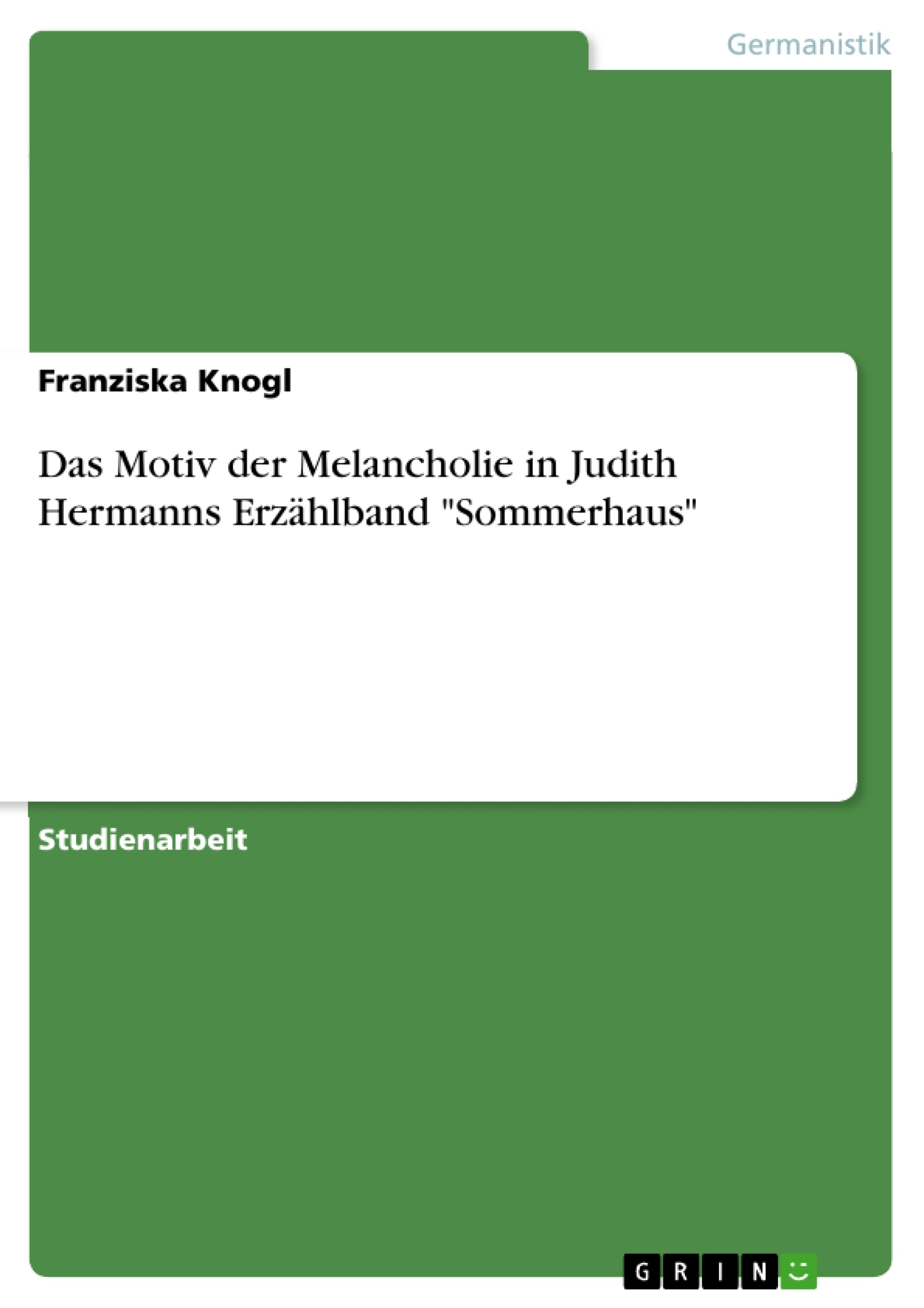Als 1998 der erste Erzählband der jungen Berliner Autorin Judith Hermann erschien, übertrafen sich die Kritiker gegenseitig an Lobeshymnen. „Ein fulminantes Debüt, das Anlass gibt zu großer Hoffnung“, schwärmte zum Beispiel Martin Lüdke im Oktober 1998 in der ,Zeit’ . Roman Bucheli von der ,Neuen Züricher Zeitung’ schrieb von einem „unwiderstehlichem Sog“, den die Erzählungen ausüben und pries die „subtile Kunst der ersten Sätze“, die „große Virtuosität“ und die Leichtigkeit der „hochartistischen“ Texte .
Doch der Durchbruch des Erstlings mit dem Titel ,Sommerhaus, später’ folgte erst einen Monat später, als Marcel Reich-Ranicki das Werk im ,literarischen Quartett’ besprach. Er bezeichnete Hermann als hervorragende Autorin und sagte ihr großen Erfolg voraus . Daraufhin stiegen die Verkaufszahlen explosionsartig an und Judith Hermann stürmte die Bestsellerlisten.
Das einzige Bild, das man zu dieser Zeit von der Autorin kannte, war ein Portraitfoto auf dem Umschlag ihres Buches. Es zeigt ein altertümlich wirkendes Madonnengesicht, eigentümlich schön, das melancholisch ins Leere blickt. Das Foto erregte Aufsehen, einerseits wegen dem ungewöhnlichen Aussehen der Autorin, andererseits, weil die Erzählungen und das Bild Judith Hermanns so eng miteinander verknüpft sind . Die Aura dieses Fotos entspricht exakt der Stimmung des Buches. Für die meisten Leser sahen die weiblichen Figuren der Geschichten aus wie die melancholische junge Frau auf dem Umschlag.
Im Folgenden soll untersucht werden, durch welche Mittel das Gefühl der Melancholie im Text erzeugt wird. Dazu wird es nötig sein, zuerst den Begriffsinhalt der Melancholie genau zu definieren. Daraufhin soll der Erzählband ,Sommerhaus, später’ auf sprachlicher, struktureller und inhaltlicher Ebene untersucht werden, um herauszufinden, wie die melancholische Grundstimmung des Buches entsteht.
Inhaltsverzeichnis
- Die Erfolgsgeschichte melancholischer Erzählungen von Judith Hermann
- Melancholie als Grundstimmung in Judith Hermanns Erzählband ,Sommerhaus, später'
- Allgemeiner Teil: Definition der Melancholie
- Der Ursprung des Begriffs ,Melancholie'
- Historische Ausdifferenzierung des Begriffs
- Der englische Begriff ,blues'
- Spezieller Teil: Analyse der Erzählungen
- Motto
- Sprachstil
- Wiederholungen
- Symbolik
- Wörtliche Rede
- Erzählweise
- Figuren
- Thematik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die melancholische Grundstimmung in Judith Hermanns Erzählband „Sommerhaus, später“. Die Arbeit untersucht, wie die Melancholie durch sprachliche Mittel, strukturelle Besonderheiten und inhaltliche Elemente im Text erzeugt wird.
- Definition der Melancholie und ihre historische Entwicklung
- Analyse des Sprachstils in den Erzählungen
- Untersuchung der Erzählweise und der Figuren
- Identifizierung der zentralen Themen und Motive
- Bedeutung des Mottos und des Titelbildes des Buches
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Erfolgsgeschichte melancholischer Erzählungen von Judith Hermann
- Kapitel 2: Melancholie als Grundstimmung in Judith Hermanns Erzählband „Sommerhaus, später“
- Kapitel 2.1: Allgemeiner Teil: Definition der Melancholie
- Kapitel 2.2: Spezieller Teil: Analyse der Erzählungen
Dieses Kapitel stellt Judith Hermanns Erzählband „Sommerhaus, später“ vor und beschreibt die kritische Rezeption des Werks sowie den Erfolg des Buches nach seiner Rezension im „literarischen Quartett“.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition der Melancholie. Es beleuchtet den Ursprung des Begriffs, seine historische Ausdifferenzierung und den Zusammenhang mit dem englischen Begriff „blues“. Außerdem wird die Rolle der Melancholie als Grundstimmung in Hermanns Werk thematisiert.
In diesem Kapitel werden die sprachlichen Wurzeln des Begriffs „Melancholie“ und seine Bedeutung in der antiken Medizin sowie im Mittelalter untersucht. Die philosophischen und psychoanalytischen Interpretationen der Melancholie im 20. Jahrhundert werden ebenfalls beleuchtet.
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die sprachliche und inhaltliche Analyse der Erzählungen in „Sommerhaus, später“. Es analysiert die Verwendung von Wiederholungen, Symbolen und wörtlicher Rede sowie die Erzählweise, die Figuren und die Thematik der Geschichten.
Schlüsselwörter
Judith Hermann, Erzählband, „Sommerhaus, später“, Melancholie, Sprachstil, Erzählweise, Figuren, Thematik, „blues“, Wiederholungen, Symbolik, wörtliche Rede, Motto.
- Quote paper
- Franziska Knogl (Author), 2004, Das Motiv der Melancholie in Judith Hermanns Erzählband "Sommerhaus", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157295