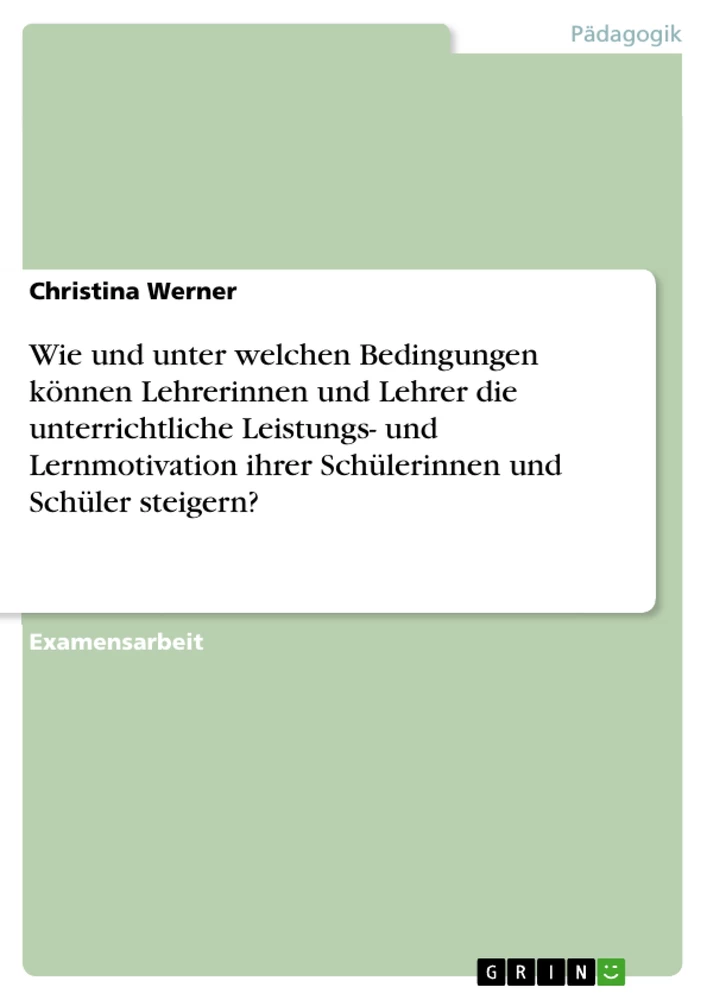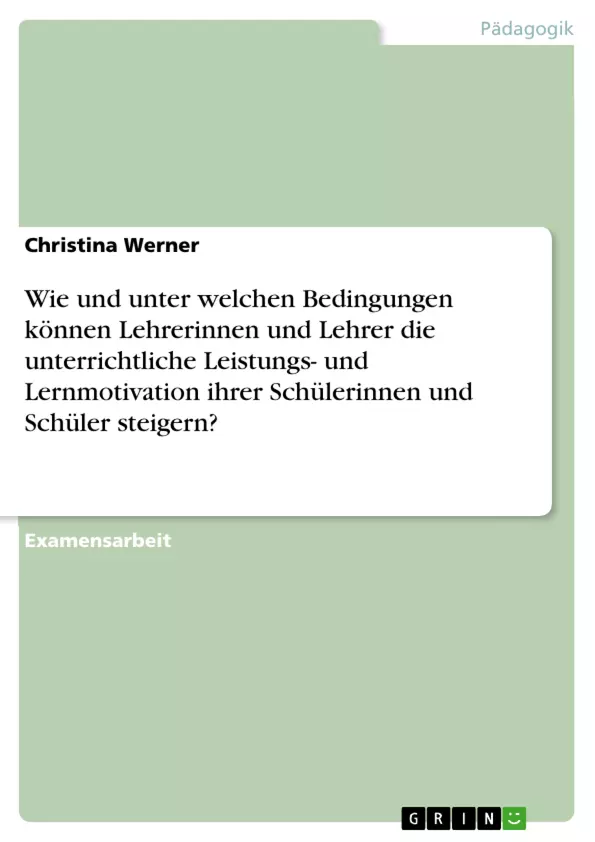„Wie und unter welchen Bedingungen können Lehrerinnen und Lehrer die unterrichtliche Leistungs- und Lernmotivation ihrer Schülerinnen und Schüler steigern?“ - Lösungsansätze.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung: Leistungsmotiv / Leistungsmotivation
- 2.1 Motiv und Motivation
- 2.1.1 Die Bedürfnispyramide nach A.H. Maslow
- 2.2 Leistungsmotiv und Leistungsmotivation
- 2.2.1 Gütemaßstäbe der Leistungsmotivation
- 2.1 Motiv und Motivation
- 3. Überblick über Motivationstheorien
- 3.1 Die Hedonisten
- 3.2 Die operante Konditionierung
- 3.3 Erwartungs-mal-Wert-Theorien
- 3.4 Tiefenpsychologische Vorstellungen nach Freud und Adler
- 4. Modelle der Leistungsmotivation
- 4.1 Die Attributionstheorie nach Weiner
- 4.2 Das Risikowahl-Modell nach Atkinson
- 4.3 Heckhausens Selbstbewertungsmodell
- 5. Die Bedeutung der Motivation für Lernprozesse im Kontext Schule
- 5.1 Extrinsische Motivation
- 5.2 Intrinsische Motivation
- 5.2.1 Das Flow-Erleben
- 5.3 Extrinsische und intrinsische Motivation als aktuelle Zustandsvariablen
- 5.4 Extrinsische und intrinsische Motivation im schulischen Kontext
- 5.5 Die Korrumpierungshypothese oder: Ist extrinsische Motivation schädlich?
- 6. Maßnahmen zur motivationalen Optimierung von Unterricht
- 6.1 Die Bedeutung von Zielen, Zieltransparenz und Zielaktivierung als Bedingung von Motivation im Lern- und Leistungskontext
- 6.2 Lernen am Modell (Imitationslernen)
- 6.3 Interesse und dessen Erweckung
- 6.3.1 Lernstrategien
- 6.3.1.1 Kognitive Lernstrategien
- 6.3.1.2 Metakognitive Lernstrategien
- 6.3.1.3 Ressourcenmanagement
- 6.3.1 Lernstrategien
- 6.4 Verstärkungstheorien – Motivation durch Belohnung und Bestrafung
- 6.5 Innere Differenzierung und die Schaffung von Selbstbildern durch Attributionen hinsichtlich der Bezugsnormorientierung des Lehrers
- 6.6 Curriculare Maßnahmen
- 6.7 Unterstützung des Leistungsklimas
- 6.8 Leistungsbewertung und Motivation
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, wie Lehrer die Lern- und Leistungsmotivation ihrer Schüler steigern können. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Motivation, analysiert verschiedene Motivationstheorien und betrachtet Modelle der Leistungsmotivation im Kontext der Lernpsychologie. Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung und dem Zusammenspiel von intrinsischer und extrinsischer Motivation im schulischen Umfeld.
- Theoretische Grundlagen der Motivation
- Analyse verschiedener Motivationstheorien
- Modelle der Leistungsmotivation (Attributionstheorie, Risikowahl-Modell, Selbstbewertungsmodell)
- Intrinsische und extrinsische Motivation im Unterricht
- Maßnahmen zur Steigerung der Lernmotivation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einer Anekdote über einen Jungen, der sich weigert, das Alphabet zu lernen, um die Komplexität von Motivation zu verdeutlichen. Sie führt in das Thema der Motivationsforschung ein und stellt die zentrale Forschungsfrage: Wie können Lehrer die Lern- und Leistungsmotivation ihrer Schüler steigern? Die Arbeit gliedert sich in die theoretische Auseinandersetzung mit Motivation und die Vorstellung praktischer Maßnahmen zur Motivationsförderung im Unterricht.
2. Begriffsbestimmung: Leistungsmotiv / Leistungsmotivation: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Motiv" und "Motivation". Es unterscheidet zwischen Motiven als Beweggründe des Handelns und Motivation als dem Gesamt der in einer Situation wirksamen Motive. Es werden verschiedene Arten von personenbezogenen Faktoren erläutert, die Motive beeinflussen, wie universelle Bedürfnisse und individuelle Motivdispositionen. Die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation wird vorbereitet.
3. Überblick über Motivationstheorien: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Motivationstheorien. Es werden Ansätze wie der Hedonismus, die operante Konditionierung, Erwartungs-mal-Wert-Theorien und tiefenpsychologische Sichtweisen nach Freud und Adler vorgestellt. Der Überblick dient dazu, das breite Spektrum an Erklärungsansätzen für menschliches Handeln aufzuzeigen und den Kontext für die im folgenden Kapitel vorgestellten Modelle der Leistungsmotivation zu bilden.
4. Modelle der Leistungsmotivation: Hier werden ausgewählte kognitive Modelle der Leistungsmotivation, nämlich die Attributionstheorie nach Weiner, das Risikowahl-Modell nach Atkinson und das Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen, detailliert beschrieben. Die Kapitel erläutern die jeweiligen theoretischen Grundlagen und zeigen deren Relevanz für die Erklärung von Lernprozessen auf. Die Auswahl dieser Modelle konzentriert sich auf ihren praktischen Nutzen für das Verständnis und die Beeinflussung von Lernmotivation im schulischen Kontext.
5. Die Bedeutung der Motivation für Lernprozesse im Kontext Schule: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Motivation im schulischen Kontext. Es differenziert zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation und untersucht deren Einfluss auf den Lernerfolg. Der Einfluss von extrinsischen Belohnungen auf intrinsische Motivation und die damit verbundene Korrumpierungshypothese wird diskutiert. Das Kapitel legt den Grundstein für die im folgenden Kapitel beschriebenen Maßnahmen zur Motivationsförderung.
6. Maßnahmen zur motivationalen Optimierung von Unterricht: In diesem Kapitel werden konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Lernmotivation im Unterricht vorgestellt und erläutert. Es werden unter anderem die Bedeutung von Zielen, Lernen am Modell, die Förderung von Interesse, Lernstrategien, Verstärkungstheorien, innere Differenzierung, die Gestaltung des Leistungsklimas und die Leistungsbewertung als entscheidende Faktoren für die Motivation der Schüler behandelt. Die Maßnahmen sollen Lehrkräften praktische Hilfestellungen zur Gestaltung eines motivierenden Unterrichts geben.
Schlüsselwörter
Leistungsmotivation, Motivationstheorien, Attributionstheorie, Risikowahl-Modell, Selbstbewertungsmodell, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Lernprozesse, Unterricht, Schülermotivation, Motivationsförderung, Lernstrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Leistungsmotivation im Unterricht"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik der Leistungsmotivation im schulischen Kontext. Er beinhaltet eine Einleitung, eine genaue Begriffsbestimmung von Motiv und Motivation, einen Überblick über verschiedene Motivationstheorien, detaillierte Beschreibungen relevanter Modelle der Leistungsmotivation (Attributionstheorie, Risikowahl-Modell, Selbstbewertungsmodell), eine eingehende Auseinandersetzung mit intrinsischer und extrinsischer Motivation sowie konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Lernmotivation im Unterricht. Zusätzlich enthält er ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Motivationstheorien werden behandelt?
Der Text behandelt eine breite Palette an Motivationstheorien, darunter Hedonismus, operante Konditionierung, Erwartungs-mal-Wert-Theorien und tiefenpsychologische Ansätze nach Freud und Adler. Der Fokus liegt jedoch auf kognitiven Modellen der Leistungsmotivation.
Welche Modelle der Leistungsmotivation werden erklärt?
Der Text erläutert detailliert drei wichtige Modelle der Leistungsmotivation: die Attributionstheorie nach Weiner, das Risikowahl-Modell nach Atkinson und das Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen. Diese Modelle werden im Kontext von Lernprozessen und deren Beeinflussung erklärt.
Wie wird intrinsische und extrinsische Motivation unterschieden?
Der Text unterscheidet klar zwischen intrinsischer Motivation (innerer Antrieb, Freude am Lernen) und extrinsischer Motivation (außerer Antrieb, z.B. Noten, Belohnungen). Er analysiert deren Zusammenspiel und den Einfluss extrinsischer Belohnungen auf intrinsische Motivation (Korrumpierungshypothese).
Welche konkreten Maßnahmen zur Steigerung der Lernmotivation werden vorgeschlagen?
Der Text schlägt zahlreiche Maßnahmen zur Motivationsförderung im Unterricht vor, darunter die klare Definition von Zielen, Lernen am Modell, die Förderung von Interesse durch geeignete Lernstrategien (kognitive, metakognitive, Ressourcenmanagement), Verstärkungstheorien, innere Differenzierung, Gestaltung eines positiven Leistungsklimas und eine motivierende Leistungsbewertung. Die Bedeutung von Zieltransparenz und Zielaktivierung wird ebenfalls hervorgehoben.
Worum geht es in der Einleitung und im Fazit?
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage: Wie können Lehrer die Lern- und Leistungsmotivation ihrer Schüler steigern? Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und bietet einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter sind: Leistungsmotivation, Motivationstheorien, Attributionstheorie, Risikowahl-Modell, Selbstbewertungsmodell, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Lernprozesse, Unterricht, Schülermotivation, Motivationsförderung, Lernstrategien.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text richtet sich primär an Lehrer, Lehramtsstudenten und alle, die sich mit der Thematik der Lern- und Leistungsmotivation im schulischen Kontext auseinandersetzen möchten. Er bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungshinweise.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Motivationstheorien und Modellen?
Der Text bietet einen Überblick über die wichtigsten Motivationstheorien und Modelle. Für detailliertere Informationen empfiehlt es sich, die im Text genannten Autoren und deren Werke direkt zu konsultieren.
Wie kann ich die im Text genannten Maßnahmen in meinem Unterricht umsetzen?
Der Text bietet konkrete Tipps und Hinweise zur Umsetzung der Maßnahmen. Eine individuelle Anpassung an die jeweilige Lerngruppe und den Unterrichtsstil ist jedoch unerlässlich. Eine Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis und die Berücksichtigung der individuellen Schülerbedürfnisse sind von großer Bedeutung.
- Citar trabajo
- Christina Werner (Autor), 2008, Wie und unter welchen Bedingungen können Lehrerinnen und Lehrer die unterrichtliche Leistungs- und Lernmotivation ihrer Schülerinnen und Schüler steigern?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157181