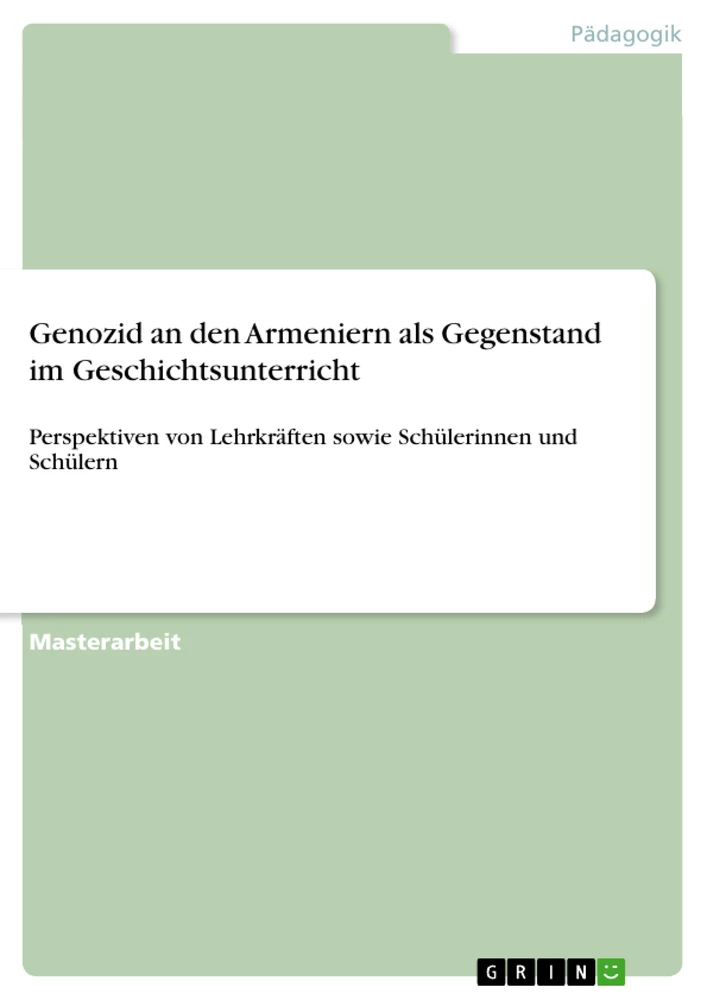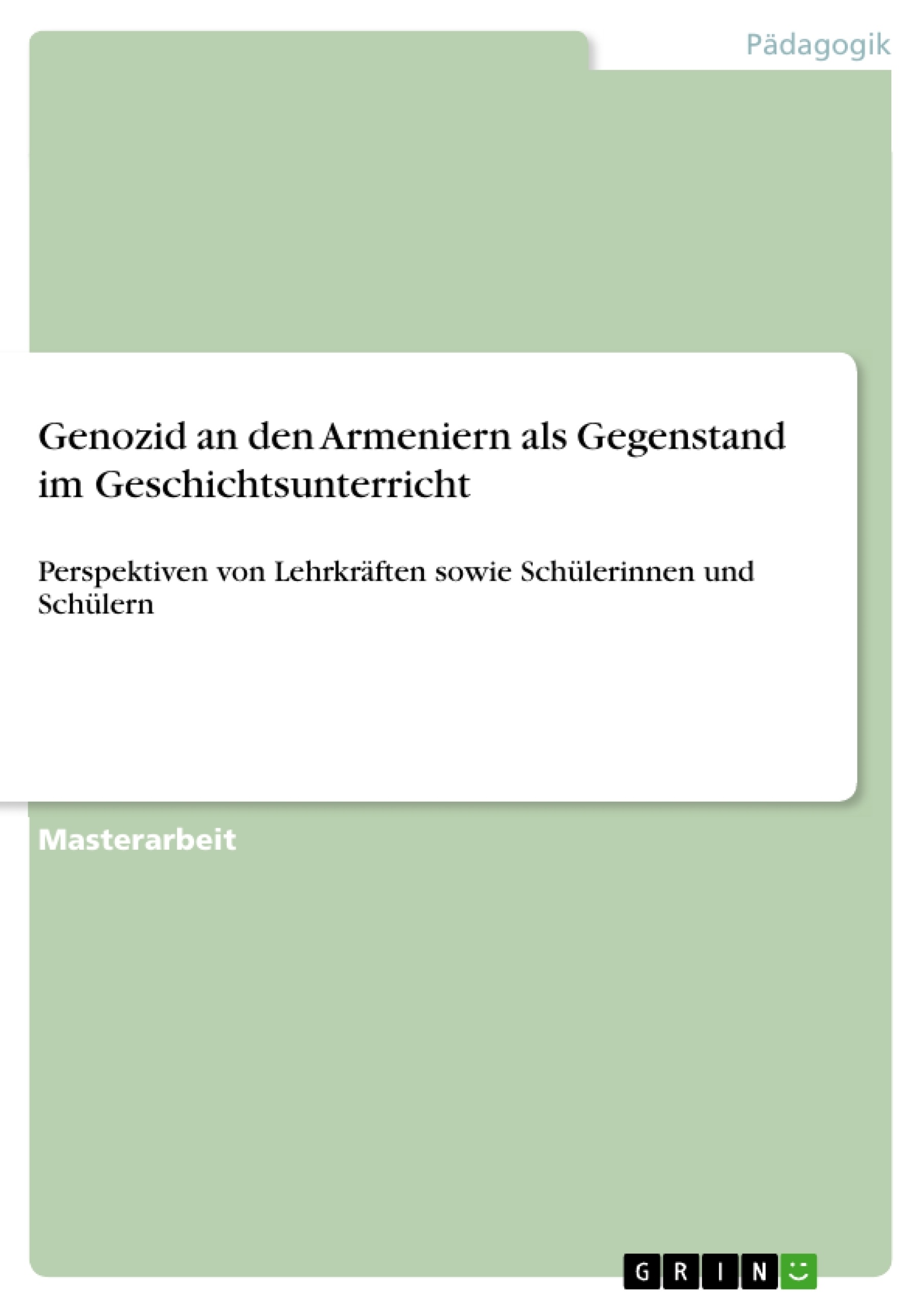Die Thematisierung des Genozids an den Armeniern erfordert ein tiefgreifendes Verständnis über den historischen Kontext, da die Durchführung des Völkermordes sich aus einem jahrhundertelangen historischen Prozess innerhalb des Osmanischen Reiches entwickelte. Dies wird nicht im Schulunterricht behandelt und kann ebenfalls in der universitären Ausbildung der Lehrkräfte, je nach Wahl der Kurse, ausbleiben. So ist es möglich den Werdegang einer Lehrkraft zu vollenden, ohne jemals von dem Genozid an den Armeniern gehört, geschweige denn ihn thematisiert zu haben, wie es später im Verlauf der Arbeit dargelegt wird.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufbauend auf den Forschungsergebnissen eines zuvor angefertigten Studienprojekts, mithilfe wohldurchdachter, methodischer Modifikationen einen Beitrag zur historischen Bildung zu leisten. Das vorausgegangene Studienprojekt, welches als Pretest fungiert, illustriert erhebliche Wissenslücken und unterschiedliche Positionierungen zur “Genozid-Debatte“. Die Lücken im Forschungsstand begründen nicht nur die Legitimierung des zuvor durchgeführten Studienprojekts, sondern fungierten a posteriori als Impulsgeber für eine Fortsetzung und Vertiefung im Rahmen dieser Arbeit. Ziel ist es, mit den erzielten Ergebnissen Impulse und Ansätze für den künftigen Forschungsdiskurs zu schaffen und den Mangel an Daten in diesem Bereich schrittweise zu verringern. Gleichzeitig sollen Denkanstöße zur Erinnerungskultur des Armenozids angeregt und das Bewusstsein für die Rolle der Schule in dieser Konstellation geschärft werden. Zusätzlich soll hervorgehoben werden, wie eine fehlende Pönalisierung, Anerkennung und Aufarbeitung der “Täter“ sowie die Umdeutung der Ereignisse eine Ideologie begünstigen könnte, die eine Gewalt gegen Minderheiten und die gewaltsame Schaffung eines homogenen Nationalstaates im gesellschaftlichen Diskurs “legitimer“ und umsetzbar erscheinen ließ. Hieraus wurde eine prägende Botschaft an die nachfolgenden Generationen vermittelt, was nicht minder die Erinnerungskultur am Geschehen nachhaltig formte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Bedeutung und Aktualität des Themas
- 1.2 Zielsetzung und Forschungsinteresse
- 2. Der Genozid an den Armeniern im Geschichtsunterricht: Forschungstand und gesellschaftlicher Diskurs
- 3. Historischer Kontext des Armenozids – Relevanz für den Geschichtsunterricht
- 3.1 Europäische Einflüsse und die Nationsbildung im Osmanischen Reich – Der Weg zum Genozid im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts
- 3.2 Der „Orient“ in der Außenpolitik des Deutschen Reiches
- 3.3 Das Erbe des deutsch-osmanischen Bündnisses und die Bedeutsamkeit einer fehlenden Aufarbeitung respektive Anerkennung eines Genozids
- 4. Vermittlung im Unterricht - Analyse bestehender Unterrichtsmaterialien
- 5. Darstellung der empirischen Erhebung
- 5.1 Methodische Vorgehensweise und Auswahlkriterien
- 5.2 Konzeption des Fragebogens
- 5.2.1 Begründung der Befragungskriterien und Durchführung der Befragung
- 5.2.2 Auswertungsverfahren des Fragebogens
- 5.3 Konzeption des Interviewleitfadens
- 5.3.1 Durchführung des Interviews
- 5.3.2 Auswertungsverfahren der Interviews
- 6. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
- 6.1 Perspektiven der Schülerinnen und Schüler
- 6.2 Perspektiven der Lehrkräfte
- 6.3 Gesamtauswertung und Implikationen für den Geschichtsunterricht
- 6.4 Reflektion der methodischen Vorgehensweisen
- 7. Politische- und schulische Reaktionen auf Lehrmaterialien und die Thematisierung des Genozids
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Wahrnehmung des Genozids an den Armeniern durch Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler und deren Perspektiven bezüglich der Thematisierung im Geschichtsunterricht. Sie baut auf einem vorherigen Studienprojekt auf und erweitert dieses durch methodische Modifikationen. Ziel ist es, historische Bildung zu fördern, Wissenslücken aufzuzeigen und Impulse für den Forschungsdiskurs zu liefern. Die Arbeit beleuchtet die Erinnerungskultur des Armenozids und die Rolle der Schule darin.
- Wissensstand und Wahrnehmung des Armeniergenozids bei Schülerinnen und Schülern
- Perspektiven von Lehrkräften zur Thematisierung des Genozids im Unterricht
- Der Einfluss der türkischen Leugnungskampagne auf die Wahrnehmung des Themas
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Vermittlung des Themas im Geschichtsunterricht
- Der historische Kontext des Genozids und seine Relevanz für den Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung und Aktualität des Themas des Armeniergenozids im deutschen Geschichtsunterricht heraus. Sie unterstreicht die unzureichende Kenntnis in der deutschen Gesellschaft und die anhaltende Leugnungskampagne der Türkei. Die Arbeit fokussiert sich auf die Perspektiven von Lehrkräften und Schülern und zielt darauf ab, die bisherige Vernachlässigung der Thematik aufzuzeigen und Ansätze für eine stärkere Integration im Unterricht zu entwickeln.
2. Der Genozid an den Armeniern im Geschichtsunterricht: Forschungstand und gesellschaftlicher Diskurs: Dieses Kapitel analysiert den bestehenden Forschungsstand zum Thema Armeniergenozid im Geschichtsunterricht. Es zeigt die wissenschaftliche Übereinstimmung über den Genozid und die fehlende bundesweite Thematisierung im Unterricht auf. Der Kapitel analysiert relevante Veröffentlichungen und Beiträge, die die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Thematisierung hervorheben und deren gegenwärtige Auswirkungen auf die Erinnerungskultur darstellen. Es beleuchtet auch den Einfluss von Stefan Ihrigs Arbeit zur Legitimierung des Völkermords in Deutschland in den 1930er Jahren und dessen möglicher Verbindung zum Holocaust.
3. Historischer Kontext des Armenozids – Relevanz für den Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen historischen Kontext des Armeniergenozids. Es untersucht die europäischen Einflüsse auf die Nationsbildung im Osmanischen Reich, die Rolle des Deutschen Reiches in der Außenpolitik des Osmanischen Reichs und das Erbe des deutsch-osmanischen Bündnisses. Es wird deutlich gemacht wie eine fehlende Aufarbeitung und Anerkennung des Genozids bis heute die Erinnerungskultur beeinflusst.
4. Vermittlung im Unterricht - Analyse bestehender Unterrichtsmaterialien: Das Kapitel analysiert die vorhandenen Unterrichtsmaterialien zum Armeniergenozid. Es zeigt die unterschiedlichen Ansätze und die begrenzte Verfügbarkeit von Materialien auf, besonders in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeit beschreibt verschiedene Initiativen zur Bereitstellung von Materialien wie dem Lepsiushaus und dem Institut für Diaspora- und Genozidforschung (IDG) an der Ruhr-Universität Bochum. Die kontrastierenden Lehrpläne Deutschlands und der Türkei werden im Hinblick auf die Thematisierung des Genozids verglichen.
5. Darstellung der empirischen Erhebung: In diesem Kapitel wird die methodische Vorgehensweise der empirischen Untersuchung beschrieben. Es werden die verwendeten Methoden (Mixed-Methods-Ansatz mit Fragebögen und Experteninterviews) und die Auswahlkriterien der Teilnehmer detailliert erklärt. Das Kapitel beschreibt die Konzeption der Fragebögen und des Interviewleitfadens, sowie die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.
6. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert die Ergebnisse der empirischen Erhebung. Es werden die Perspektiven der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte separat dargestellt und analysiert. Die Ergebnisse werden im Kontext der Forschungsfragen und Hypothesen interpretiert und diskutiert. Die Kapitel umfasst die Auswertung der Fragebögen und Interviews, einschließlich einer detaillierten Analyse der quantitativen und qualitativen Daten.
7. Politische- und schulische Reaktionen auf Lehrmaterialien und die Thematisierung des Genozids: Dieses Kapitel untersucht die politischen und schulischen Reaktionen auf die Thematisierung des Armeniergenozids und die damit verbundenen Lehrmaterialien, insbesondere in Bezug auf die Handreichung für Sachsen-Anhalt. Es wird die politische Brisanz des Themas und die internationalen Interessenskonflikte beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Armeniergenozid, Geschichtsunterricht, Erinnerungskultur, Leugnung, Türkei, Deutsches Reich, Mixed-Methods, Empirische Forschung, Schulbücher, Lehrpläne, politische Kontroverse, nationalistische Ideologie, Holocaust, Vergleichende Geschichtsforschung, Schülerperspektiven, Lehrerperspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält eine umfassende Sprachvorschau zu einer Masterarbeit über den Genozid an den Armeniern im Geschichtsunterricht. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselwörter.
Was ist das Ziel der Masterarbeit, die in der Sprachvorschau beschrieben wird?
Die Masterarbeit untersucht die Wahrnehmung des Genozids an den Armeniern durch Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler und deren Perspektiven bezüglich der Thematisierung im Geschichtsunterricht. Sie zielt darauf ab, historische Bildung zu fördern, Wissenslücken aufzuzeigen und Impulse für den Forschungsdiskurs zu liefern.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Masterarbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen den Wissensstand und die Wahrnehmung des Armeniergenozids bei Schülerinnen und Schülern, die Perspektiven von Lehrkräften zur Thematisierung des Genozids im Unterricht, den Einfluss der türkischen Leugnungskampagne auf die Wahrnehmung des Themas, Herausforderungen und Möglichkeiten der Vermittlung des Themas im Geschichtsunterricht sowie den historischen Kontext des Genozids und seine Relevanz für den Geschichtsunterricht.
Welche Kapitel beinhaltet die Masterarbeit?
Die Masterarbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung; Der Genozid an den Armeniern im Geschichtsunterricht: Forschungstand und gesellschaftlicher Diskurs; Historischer Kontext des Armenozids – Relevanz für den Geschichtsunterricht; Vermittlung im Unterricht - Analyse bestehender Unterrichtsmaterialien; Darstellung der empirischen Erhebung; Darstellung und Diskussion der Ergebnisse; Politische- und schulische Reaktionen auf Lehrmaterialien und die Thematisierung des Genozids.
Welche methodische Vorgehensweise wird in der Masterarbeit verwendet?
Die Masterarbeit verwendet einen Mixed-Methods-Ansatz mit Fragebögen und Experteninterviews. Die empirische Erhebung wird detailliert beschrieben, einschließlich der Auswahlkriterien der Teilnehmer, der Konzeption der Fragebögen und des Interviewleitfadens sowie der Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.
Welche Schlüsselwörter sind mit der Masterarbeit verbunden?
Die Schlüsselwörter umfassen Armeniergenozid, Geschichtsunterricht, Erinnerungskultur, Leugnung, Türkei, Deutsches Reich, Mixed-Methods, Empirische Forschung, Schulbücher, Lehrpläne, politische Kontroverse, nationalistische Ideologie, Holocaust, Vergleichende Geschichtsforschung, Schülerperspektiven, Lehrerperspektiven.
Was wird in den Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel behandelt?
Die Zusammenfassungen der Kapitel geben einen Überblick über die zentralen Inhalte und Fragestellungen jedes Kapitels. Sie umfassen die Bedeutung und Aktualität des Themas, den Forschungsstand, den historischen Kontext, die Analyse von Unterrichtsmaterialien, die methodische Vorgehensweise, die Ergebnisse der empirischen Erhebung sowie die politischen und schulischen Reaktionen auf die Thematisierung des Genozids.
Worauf konzentriert sich die Analyse der Unterrichtsmaterialien?
Die Analyse der Unterrichtsmaterialien konzentriert sich auf die Verfügbarkeit und die unterschiedlichen Ansätze zur Vermittlung des Armeniergenozids im Unterricht, insbesondere in Deutschland und im Vergleich zu den Lehrplänen der Türkei. Es werden Initiativen zur Bereitstellung von Materialien und die Herausforderungen bei der Thematisierung des Themas beleuchtet.
Welche Bedeutung hat das deutsch-osmanische Bündnis im Kontext der Arbeit?
Das Erbe des deutsch-osmanischen Bündnisses und die fehlende Aufarbeitung bzw. Anerkennung des Genozids werden als wichtige Faktoren für die heutige Erinnerungskultur betrachtet. Die Arbeit untersucht die Rolle des Deutschen Reiches in der Außenpolitik des Osmanischen Reichs und die Auswirkungen auf die Thematisierung des Genozids.
- Citar trabajo
- Anónimo,, 2025, Genozid an den Armeniern als Gegenstand im Geschichtsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1571474