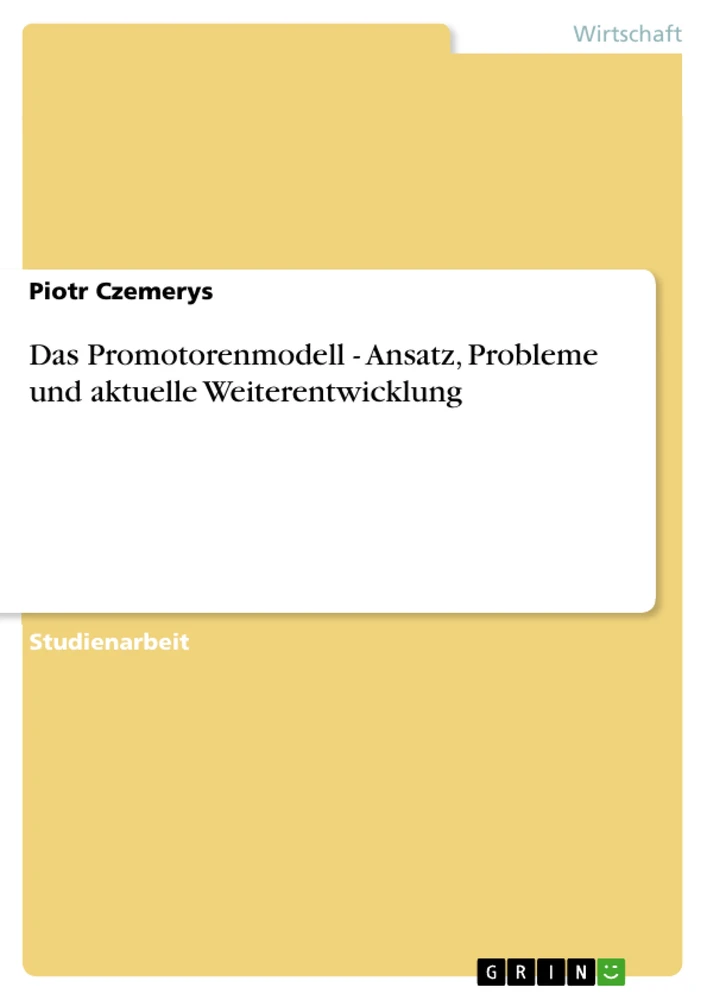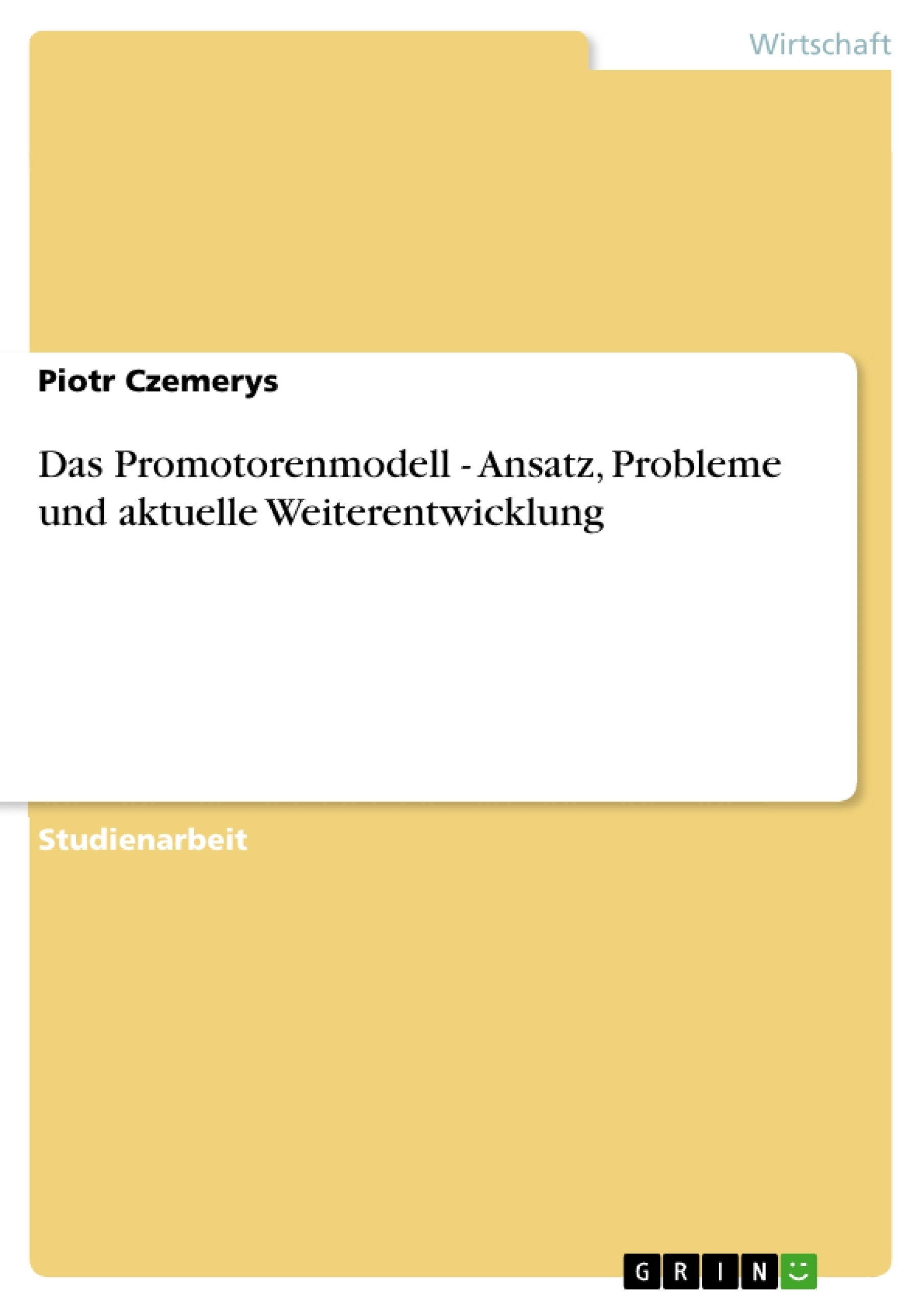Gegenwärtig werden Innovationen in der Managementlehre als organisatorische Veränderungen beziehungsweise neue Leistungen angesehen, aus denen sich zukünftig ein Wettbewerbsvorteil generieren lässt. Eine Invention ist hingegen das Ergebnis einer Ideenfindung und ist demnach als eine notwendige Vorstufe einer jeden Innovation zu verstehen. Somit lässt sich schlussfolgern, dass die Innovation die tatsächliche Verwirklichung der Invention sowie ihre erstmalige wirtschaftliche Nutzung ist.
„Die Innovationsprozesse entziehen sich als Entscheidungs- und Durchsetzungsprozesse traditioneller betriebswirtschaftlicher Überlegungen“. Die Komplexität, Unsicherheit und Angst vor Innovationen erfordert die Suche und Erforschung neuer Modelle und Strategien. Auf Grundlage empirischer Untersuchungen ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass die klassischen Managementtechniken im Bereich der Innovationsprozesse versagen. So stellen sich Unternehmen unterdessen nicht mehr die Frage, ob Innovationen getätigt werden sollten, sondern vielmehr, wie schnell und effizient eine Innovation durchgeführt werden kann.
Die Forschung bezieht sich diesbezüglich gerne auf die Great-Man-Theory.
Dies legt die Vermutung nahe, dass sich die Forschung seit jeher hinsichtlich der Erfolgszuschreibung einer Innovation auf ein bestimmtes Individuum leicht getan hat. So belegen auch empirische Untersuchungen, dass der „Champion“ der wichtigste Erfolgsfaktor im Innovationsprozess ist.
Es kristallisieren sich jedoch gänzlich unabhängig von der Betrachtungsebene, ob es sich um einen Champion oder mehrere Innovationsmanager handelt, zwei wichtige Merkmale hinsichtlich der Bedeutung dieser Personen heraus: Zum einen sind Innovationen Arbeitsprozesse, in denen die partizipierenden Akteure bestimmte Leistungsbeiträge erbringen. Zum anderen greifen sie dabei auf bestimmte Machtquellen zu.
Mit der ausführlichen Darstellung dieses Konzepts befasst sich nun der Hauptteil der vorliegenden Arbeit zum Promotorenmodell. Dazu wird in einem ersten Schritt auf die Barrieren und Opponenten von Innovationen eingegangen. Anschließend wir das Modell vorgestellt. Im letzten Teil dieser Seminararbeit werden die sich skizzierenden Probleme dargestellt sowie auf Weiterentwicklungen des Promotorenmodells eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Innovationen und Perspektiven der Innovationsforschung
- Die Entstehungsgeschichte des Promotorenmodells
- Barrieren und Widerstände gegen Innovationen
- Willensbarrieren
- Fähigkeitsbarrieren
- Barriere des Nicht-Dürfens
- Das Promotorenmodell
- Allgemeine Darstellung
- Der Fachpromotor
- Der Machtpromotor
- Der Prozesspromotor
- Der Beziehungspromotor
- Promotorenstrukturen
- Theoretische Konzepte des Promotorenmodells
- Probleme und Weiterentwicklung des Promotorenmodells
- Hindernisse und Opponenten des Modells
- Weiterentwicklungen und Wandel des Modells
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Promotorenmodell als Konzept zur Bewältigung von Barrieren und Widerständen gegen Innovationen. Sie analysiert den Ansatz, beleuchtet Probleme und diskutiert aktuelle Weiterentwicklungen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein tiefes Verständnis für die Funktionsweise des Promotorenmodells zu vermitteln und seine Relevanz für die Praxis zu beleuchten.
- Die Bedeutung von Innovationen in der modernen Wirtschaft
- Die Entstehung des Promotorenmodells als Antwort auf die Komplexität von Innovationsprozessen
- Die Rolle von Promotoren bei der Überwindung von Widerständen gegen Innovationen
- Die verschiedenen Arten von Promotoren und ihre jeweiligen Funktionen
- Die Herausforderungen und Weiterentwicklungen des Promotorenmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Innovationen und die Entstehung des Promotorenmodells ein. Sie beleuchtet die Komplexität von Innovationsprozessen und die Notwendigkeit neuer Modelle für die erfolgreiche Umsetzung von Innovationen.
Das Kapitel "Barrieren und Widerstände gegen Innovationen" analysiert die verschiedenen Hindernisse, die Innovationen begegnen können. Dabei werden Willensbarrieren, Fähigkeitsbarrieren und die Barriere des Nicht-Dürfens detailliert betrachtet.
Das Kapitel "Das Promotorenmodell" stellt das Modell als Konzept zur Bewältigung dieser Barrieren vor. Es beschreibt die verschiedenen Arten von Promotoren - Fach-, Macht-, Prozess- und Beziehungspromotor - und ihre Funktionen im Innovationsprozess.
Schlüsselwörter
Innovationen, Promotorenmodell, Innovationsprozess, Barrieren, Widerstände, Willensbarrieren, Fähigkeitsbarrieren, Barriere des Nicht-Dürfens, Fachpromotor, Machtpromotor, Prozesspromotor, Beziehungspromotor.
- Quote paper
- Piotr Czemerys (Author), 2010, Das Promotorenmodell - Ansatz, Probleme und aktuelle Weiterentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156951