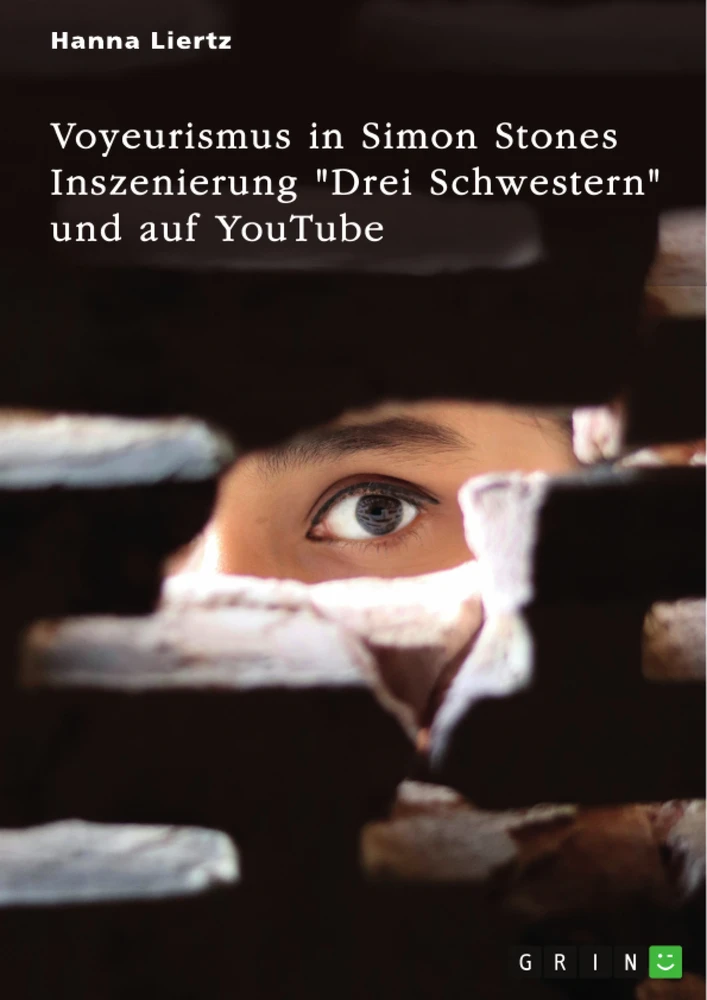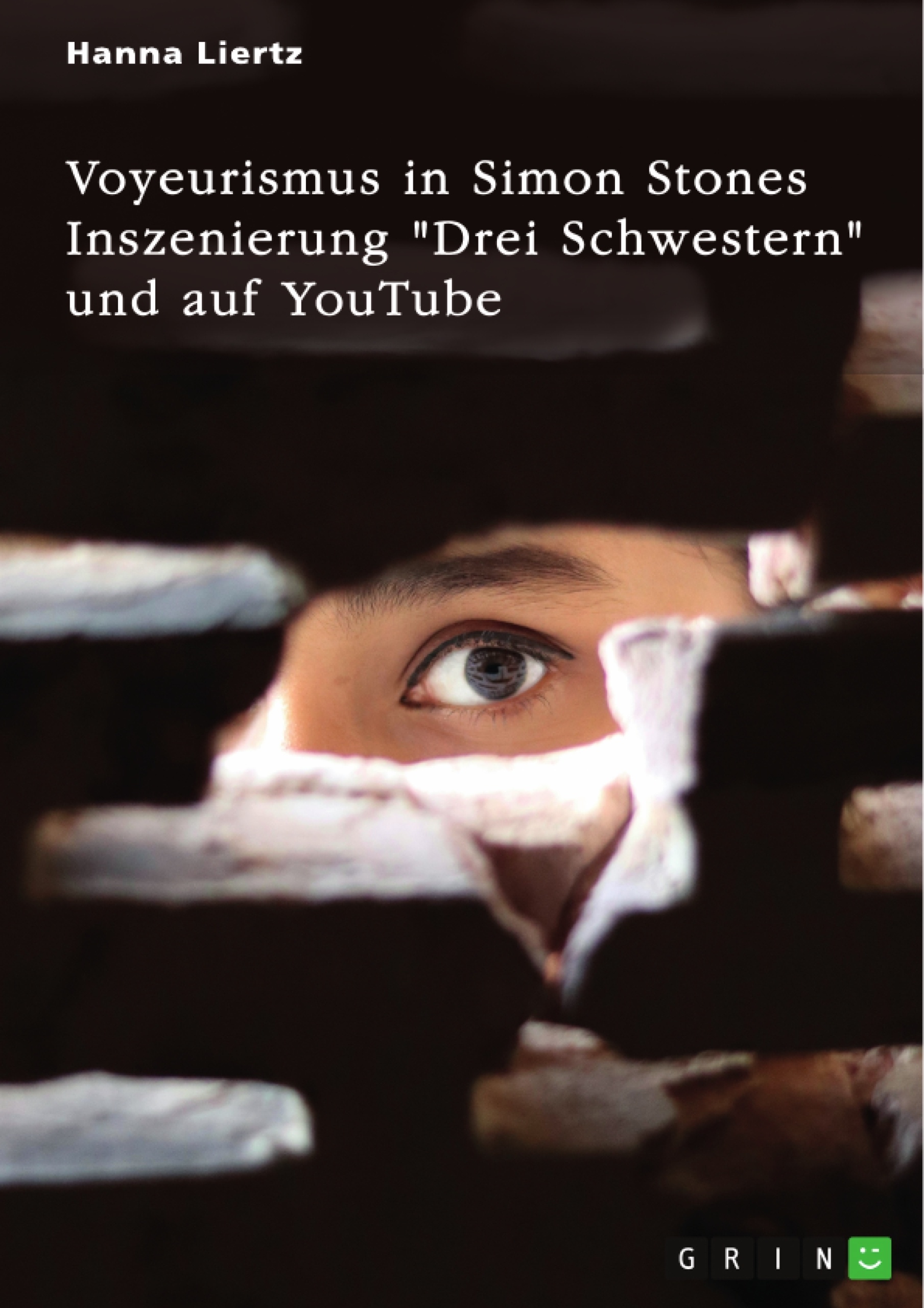In dieser Arbeit wird untersucht, mit welchen Methoden Simon Stones Inszenierung "Drei Schwestern", die am Theater Basel und am Residenztheater München zu sehen gewesen ist, den Voyeurismus des Publikums herausfordert. Im nächsten Schritt werden ähnliche Methoden auf der Video-Plattform YouTube beleuchtet, bevor ein Vergleich zwischen dem Voyeurismus in "Drei Schwestern" und auf YouTube gezogen werden kann. Im Vordergrund steht die Frage, wie Stone und professionelle YouTuberInnen den Umstand, dass sich Menschen für das Privatleben Fremder interessieren, für ihren Erfolg im Theater bzw. auf YouTube nutzen. Dabei wird die These aufgestellt, dass in der Inszenierung Mechanismen verwendet werden, die aktuell vermehrt auf YouTube zu beobachten sind und sich großer Beliebtheit erfreuen.
In dieser Arbeit wird zunächst die psychologische Definition von Voyeurismus unter die Lupe genommen, um im Anschluss zur Bedeutung von Voyeurismus in der darstellenden Kunst zu gelangen. Gerade im Theater, das auf der Kopräsenz von ZuschauerInnen und SchauspielerInnen und damit auf dem Beobachten von ‚echten‘ Körpern fußt, erhält der Blick einen Sonderstatus. Dennoch gibt es bisher kaum theaterwissenschaftliche Forschungen zum Prozess des Blickens und der Wirkung des Blicks auf die beständige Konstituierung der ZuschauerIn als kulturell geprägtes Subjekt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Neugierde des Menschen
- 2. Zum Begriff des Voyeurismus
- 2.1 Bedeutung von Voyeurismus in der Psychologie
- 2.2 Voyeurismus in der darstellenden Kunst
- 3. Voyeurismus in Simon Stones Inszenierung Drei Schwestern
- 3.2 Versetzung des klassischen Stoffes ins Heute
- 3.3 Szenographie
- 3.3.1 Das gläserne Haus und sein Inventar
- 3.3.2 Verwendung von Mikroports
- 3.4 Dramatische Handlung
- 3.4.1 Darstellung von privaten Alltagshandlungen
- 3.4.2 Aufgreifen von Tabus
- 3.4.3 Serielles Erzählen
- 4. Voyeurismus auf YouTube
- 4.1 Verbindung von YouTube und Voyeurismus
- 4.2 Das Phänomen „Vlogging“
- 4.2.1 Blick in fremde Wohnungen
- 4.2.2 Mitverfolgen des Alltags
- 4.2.3 Vlogs als unendliche Serie?
- 4.3 Tabuisierte Themen in „Story Time-Videos“
- 5. Vergleich der Drei Schwestern mit aktuellen YouTube-Phänomenen
- 5.1 Private Einblicke
- 5.1.1 Öffnung von Wohnung und Alltag für das Publikum
- 5.1.2 Verhandlung von Tabus
- 5.2 Serialität als Mittel zur Publikumsbindung
- 5.1 Private Einblicke
- 6. Voyeurismus als Erfolgsrezept
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Inszenierung von Voyeurismus in Simon Stones Inszenierung von Tschechows "Drei Schwestern" und vergleicht sie mit dem Phänomen des Voyeurismus auf YouTube. Ziel ist es, die Strategien aufzuzeigen, mit denen sowohl Stone als auch YouTuber die Neugier des Publikums auf das Privatleben anderer für ihren Erfolg nutzen. Die Arbeit beleuchtet die psychologische Bedeutung von Voyeurismus, seine Darstellung in der Kunst und die spezifischen Mechanismen, die in beiden untersuchten Kontexten zum Einsatz kommen.
- Psychologische Grundlagen des Voyeurismus
- Voyeurismus in der darstellenden Kunst, insbesondere im Theater
- Analyse von Simon Stones Inszenierung "Drei Schwestern" hinsichtlich des Voyeurismus
- Voyeurismus auf YouTube und dessen Ausprägungen (Vlogging etc.)
- Vergleich und Gegenüberstellung beider Phänomene
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Neugierde des Menschen: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die inhärente menschliche Neugierde und den damit verbundenen Wunsch nach Beobachtung und dem "Angeschautwerden" beleuchtet. Es wird argumentiert, dass Voyeurismus, trotz seines oft negativen Kontexts, ein integraler Bestandteil menschlicher Sozialisation und Entwicklung ist und dass das Beobachten von anderen essentiell für das Verständnis der Welt ist. Die Autorin stellt die Ambivalenz der Neugier heraus, die gleichermaßen wichtig wie moralisch fragwürdig sein kann.
2. Zum Begriff des Voyeurismus: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Begriff des Voyeurismus. Zunächst wird die psychologische Definition beleuchtet, bevor der Fokus auf die Darstellung von Voyeurismus in der darstellenden Kunst gelegt wird. Es wird auf die besondere Rolle des Blicks im Theater hingewiesen, wo die Kopräsenz von Zuschauern und Schauspielern eine zentrale Bedeutung hat und der Blick selbst zum Objekt der Betrachtung wird. Das Kapitel unterstreicht den Mangel an theaterwissenschaftlicher Forschung zu diesem Aspekt und begründet damit die Relevanz der vorliegenden Arbeit.
3. Voyeurismus in Simon Stones Inszenierung Drei Schwestern: Dieses Kapitel analysiert Simon Stones Inszenierung von Tschechows "Drei Schwestern" im Hinblick auf die Inszenierung von Voyeurismus. Es werden die szenografischen Elemente, die dramatische Handlung und die inszenatorischen Strategien untersucht, die dazu beitragen, das Publikum in die Rolle des Voyeurs zu versetzen. Die Autorin beschreibt beispielsweise die Verwendung eines "gläsernen Hauses", um die Privatsphäre der Figuren zu durchbrechen und dem Publikum ungeschminkte Einblicke in deren Leben zu ermöglichen.
4. Voyeurismus auf YouTube: Das Kapitel untersucht den Voyeurismus im Kontext der Videoplattform YouTube. Es beleuchtet das Phänomen des Vloggings und analysiert, wie YouTuber durch die Präsentation ihres Privatlebens ein Publikum gewinnen und binden. Die Autorin betrachtet verschiedene Aspekte des Vloggings, wie z.B. Einblicke in fremde Wohnungen und den alltäglichen Ablauf, sowie die Verwendung von „Story Time-Videos“ zur Erörterung tabuisierter Themen. Der Fokus liegt auf den Mechanismen, die auf YouTube zum Einsatz kommen, um die Neugier der Zuschauer zu befriedigen und zu einem wiederholten Konsum anzuregen.
5. Vergleich der Drei Schwestern mit aktuellen YouTube-Phänomenen: Hier werden die zuvor analysierten Phänomene von Voyeurismus in Stones Inszenierung und auf YouTube miteinander verglichen und in Beziehung gesetzt. Die Autorin untersucht Parallelen zwischen beiden Kontexten, beispielsweise die Offenlegung von Privatleben für das Publikum und die Präsentation tabuisierter Themen, sowie die Nutzung von Serialität zur Publikumsbindung. Dies verdeutlicht die Aktualität und Relevanz der in Stones Inszenierung verwendeten Mittel.
Schlüsselwörter
Voyeurismus, Theaterwissenschaft, Simon Stone, Drei Schwestern, YouTube, Vlogging, Privatleben, Beobachtung, Blick, Inszenierung, Serialität, Tabus, Psychologie, Medien, ZuschauerIn.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Inszenierung von Voyeurismus in Simon Stones Inszenierung von Tschechows "Drei Schwestern" und vergleicht diese mit dem Phänomen des Voyeurismus auf YouTube. Sie analysiert, wie sowohl Stone als auch YouTuber die Neugier des Publikums auf das Privatleben anderer nutzen, um Erfolg zu haben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den psychologischen Grundlagen des Voyeurismus, seiner Darstellung in der Kunst (insbesondere im Theater), der Analyse von Simon Stones Inszenierung "Drei Schwestern", dem Voyeurismus auf YouTube (Vlogging etc.) und einem Vergleich dieser Phänomene.
Was wird im Kapitel "Die Neugierde des Menschen" behandelt?
Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die menschliche Neugierde und den Wunsch nach Beobachtung beleuchtet. Es wird argumentiert, dass Voyeurismus ein integraler Bestandteil menschlicher Sozialisation ist.
Was wird im Kapitel "Zum Begriff des Voyeurismus" erläutert?
Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Begriff Voyeurismus, sowohl aus psychologischer Sicht als auch in Bezug auf seine Darstellung in der darstellenden Kunst. Die besondere Rolle des Blicks im Theater wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel "Voyeurismus in Simon Stones Inszenierung Drei Schwestern" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert Simon Stones Inszenierung von Tschechows "Drei Schwestern" im Hinblick auf die Inszenierung von Voyeurismus, einschließlich szenografischer Elemente, dramatischer Handlung und inszenatorischer Strategien.
Was wird im Kapitel "Voyeurismus auf YouTube" untersucht?
Das Kapitel untersucht den Voyeurismus im Kontext von YouTube, insbesondere das Phänomen des Vloggings. Es analysiert, wie YouTuber durch die Präsentation ihres Privatlebens ein Publikum gewinnen und binden.
Was wird im Kapitel "Vergleich der Drei Schwestern mit aktuellen YouTube-Phänomenen" verglichen?
Hier werden die zuvor analysierten Phänomene von Voyeurismus in Stones Inszenierung und auf YouTube miteinander verglichen, wobei Parallelen in Bezug auf Offenlegung von Privatleben, Präsentation tabuisierter Themen und Nutzung von Serialität zur Publikumsbindung untersucht werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Voyeurismus, Theaterwissenschaft, Simon Stone, Drei Schwestern, YouTube, Vlogging, Privatleben, Beobachtung, Blick, Inszenierung, Serialität, Tabus, Psychologie, Medien, ZuschauerIn.
- Quote paper
- Hanna Liertz (Author), 2020, Voyeurismus in Simon Stones Inszenierung "Drei Schwestern" und auf YouTube, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1569360