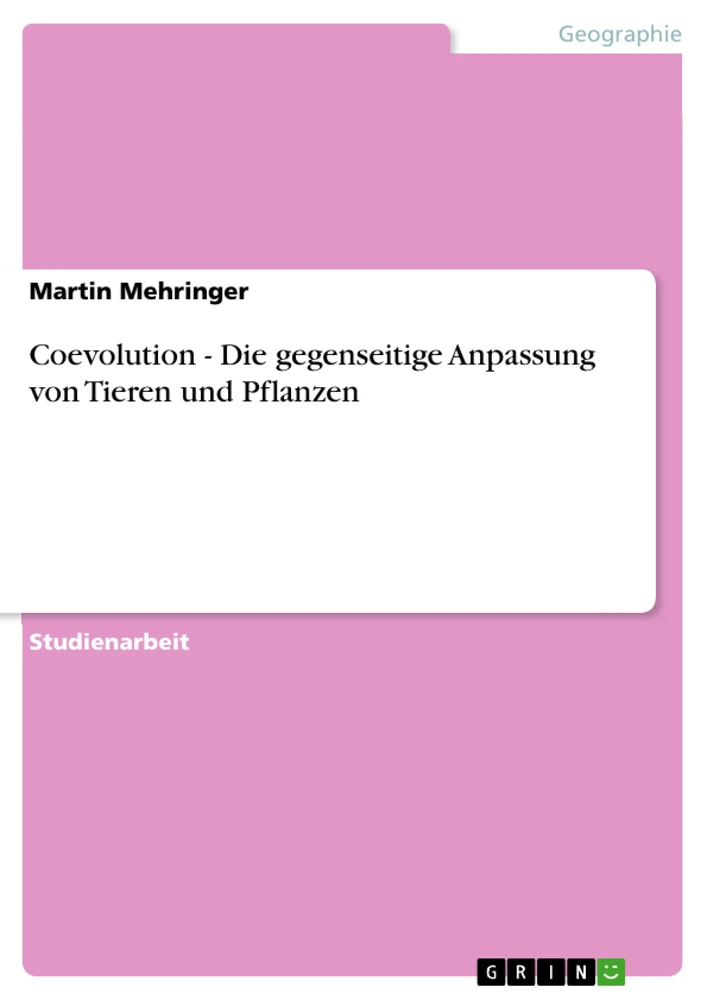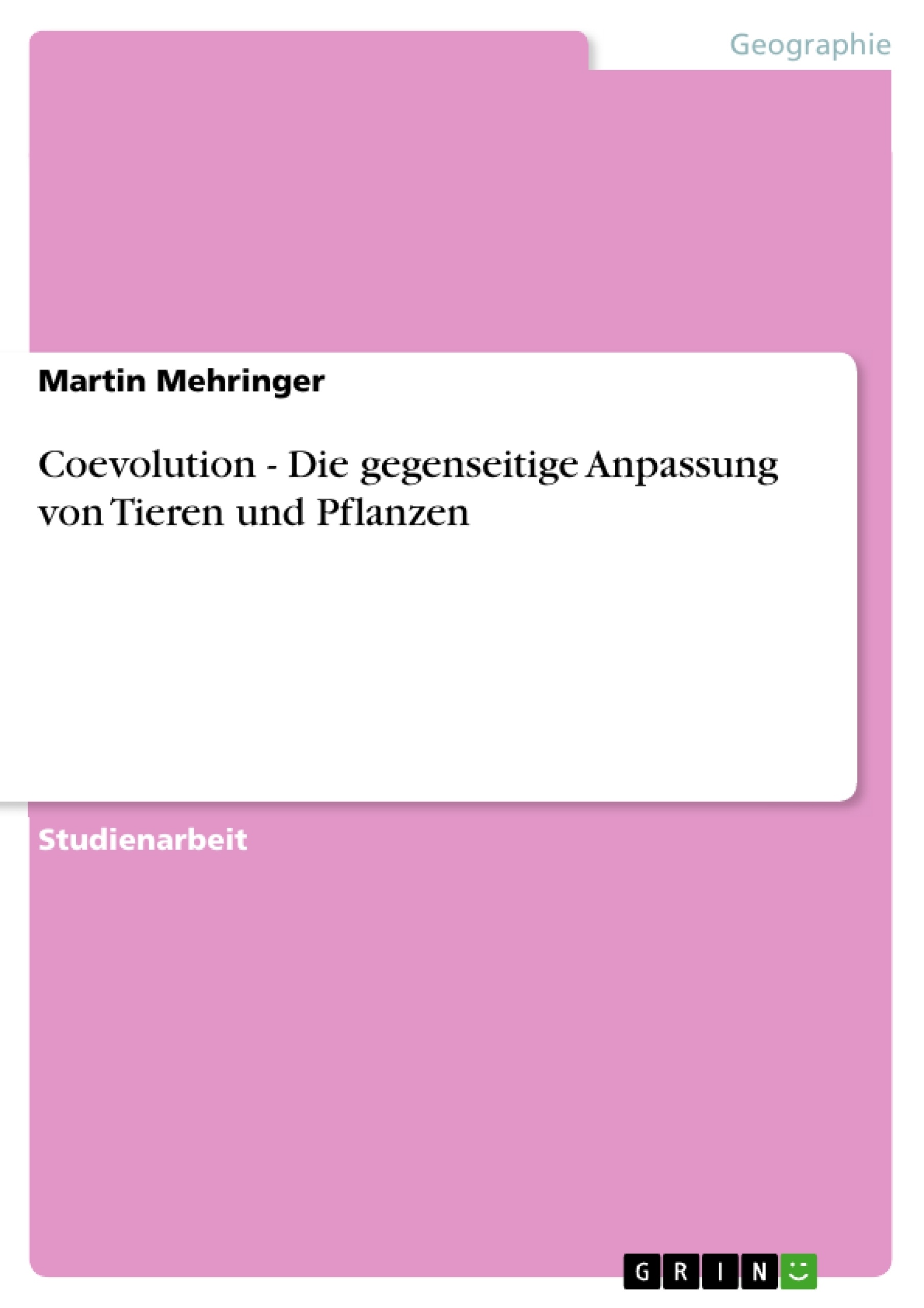Koevolution ist ein „Evolutionsschritt einer Eigenschaft der Individuen einer Population als Antwort auf eine Eigenschaft der Individuen einer zweiten Population, gefolgt von einer evolutiven Antwort der zweiten Population auf die Veränderung in der ersten Population.“(Benz, G. 1999, S. 14)
Diese enge Definition von Koevolution stammt von Janzen (1980). Es ist jedoch nicht die Einzige. Es gibt auch viel allgemeinere Definitionen, so dass sie eigentlich der Definition der Evolution gleich gesetzt werden müssten (vgl. Futuyma, D. & Slatkin, M. 1983, S. 2). Wie auch Futuyma und Slatkin am Ende ihrer Einführung in ihr Buch „Coevolution“ zu dem Ergebnis kommen, dass eine Synthese der Erforschung von Koevolution nicht möglich ist, weil es ein zu breites Spektrum an Forschungsansätzen, Zielen, Definitionen und Feldern gibt, so soll diese Arbeit nur einen Überblick und einen Einstieg in die Thematik geben um ein Verständnis für diesen Gegenstand zu fördern.
Der Begriff Koevolution selbst, wird das erste Mal von Ehrlich und Raven in ihrer Arbeit „Butterflies and plants- a study in coevolution“(1964) gebraucht, wobei schon Darwin 1859 Überlegungen dazu anstellte: „Thus I can understand how a flower and a bee might slowly become, either simultaneously or one after the other, modified and adapted in the most perfect manner to each other“ (nach Darwin in Futuyma, D. & Slatkin, M. 1983 S. 3). Unter die Evolutionsökologie, welche „erforscht, wie sich Arten an ihre Umwelt anpassen“ (Howe, H. & Westley, L. 1993, S. 28) und der Ökologie, welche die „Beziehungen der Tiere und Pflanzen zu ihrer unbelebten und belebten Umwelt“ (Howe & Westley 1993, S. 28) untersucht, kann man die Erforschung der Koevolution einreihen.
Wichtig ist es, bei allen phylogenetischen (Stammbaumforschung), genetischen, oder anderen Betrachtungsweisen, niemals den Blick auf die Umwelt zu vernachlässigen. Sie bestimmt in großem Maße die natürliche Auslese, Selektionsdruck und auch die Fitness einzelner Populationen, die sich dann wiederum auf andere Arten auswirken. (vgl. Benz, G. 1999 S. 86)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Begriffsklärungen
- 2. Arten der Koevolution
- 3. Paarweise Koevolution
- 3.1 Blüten-Pollinatoren-Koevolution
- 3.1.1 Biene – Salbei
- 3.1.2 Feige – Feigenwespe
- 3.1.3 Fledermäuse in Südamerika
- 3.1.4 Kolibris
- 3.2 Pflanzengifte gegen Herbivoren
- 3.2.1 Karminbär
- 3.2.2 Induzierte Resistenz
- 3.2.3 Lärche-Lärchenwickler
- 3.3 Mutualismus
- 3.3.1 Yuccapalme-Yuccamotte
- 3.4 Symbiosen
- 3.4.1 Mykorrhizza
- 3.4.2 Flechten
- 3.4.3 Die Endosymbiontentheorie
- 3.4.4 Termiten
- 3.4.5 Kuh
- 3.5 Parasitismus
- 3.5.1 Parasitenhypothese
- 3.5.2 Weitere Beispiele für Parasitismus
- 3.5.2.1 Großer Leberegel
- 3.5.2.2 Gallenbildende Insekten
- 3.1 Blüten-Pollinatoren-Koevolution
- 4. Schlussfolgerung und Aussicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über das Phänomen der Koevolution. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis dieses komplexen Bereichs der Evolutionsökologie zu vermitteln und verschiedene Arten und Beispiele von Koevolution zu beleuchten.
- Definition und Arten der Koevolution
- Paarweise Koevolution zwischen Blüten und Pollinatoren
- Koevolutionäre Anpassungen von Pflanzen gegen Herbivoren
- Mutualistische Beziehungen und Symbiosen
- Parasitismus und Koevolution
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Begriffsklärungen: Die Einleitung definiert Koevolution nach verschiedenen Autoren und verdeutlicht die Bandbreite des Forschungsfeldes. Sie betont die Bedeutung der Umwelt für die natürliche Selektion und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Blickwinkels, der phylogenetische, genetische und ökologische Aspekte berücksichtigt.
2. Arten der Koevolution: Dieses Kapitel differenziert zwischen paarweiser, diffuser und asymmetrischer Koevolution. Es erläutert die unterschiedlichen Anpassungsmechanismen und Interaktionsmuster zwischen Artengruppen und die Herausforderungen bei der Erforschung diffuser Koevolution aufgrund der Vielzahl möglicher Interaktionen.
3. Paarweise Koevolution: Dieses Kapitel untersucht detailliert die vielfältigen Beispiele paarweiser Koevolution, beginnend mit der Blüten-Pollinatoren-Koevolution. Es analysiert verschiedene Mechanismen zur Vermeidung von Selbstbestäubung und die gegenseitigen Anpassungen von Blüten und ihren Bestäubern, unter anderem an den Beispielen von Salbei und Bienen, Feigen und Feigenwespen, Fledermäusen und südamerikanischen Blütenpflanzen, sowie Kolibris und ihren spezifischen Blüten. Weiterhin wird die Koevolution von Pflanzen und Herbivoren, einschließlich der Entwicklung von Pflanzengiften und induzierter Resistenz, beispielsweise am Karminbär und Lärche-Lärchenwickler-System, beleuchtet.
3.3 Mutualismus: Dieses Kapitel konzentriert sich auf mutualistische Beziehungen und die Koevolution als Grundlage dieser Interaktionen. Es werden unterschiedliche Mutualismen erklärt und die Begriffe obligate und fakultative Mutualisten definiert. Das Beispiel der Yuccapalme und Yuccamotte veranschaulicht eine obligate mutualistische Beziehung mit den jeweiligen "Investitionen" beider Seiten.
3.4 Symbiosen: Das Kapitel beschreibt verschiedene Symbiosen, darunter Mykorrhizza, Flechten, und die Endosymbiontentheorie als Grundlage der Entstehung eukaryotischer Zellen. Weiterhin werden die symbiotischen Beziehungen bei Termiten und Wiederkäuern, insbesondere bei Kühen, detailliert dargestellt.
3.5 Parasitismus: Dieses Kapitel behandelt den Parasitismus als eine Form der Koevolution, mit der Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroparasiten. Es erläutert die Anpassungen von Parasiten an ihre Wirte und deren Lebenszyklen, wobei der Große Leberegel und gallenbildende Insekten als Beispiele dienen. Die Parasitenhypothese wird im Kontext von Koevolution und sexueller Selektion diskutiert.
Schlüsselwörter
Koevolution, paarweise Koevolution, diffuse Koevolution, asymmetrische Koevolution, Blüten-Pollinatoren-Koevolution, Pflanzengifte, Herbivoren, induzierte Resistenz, Mutualismus, Symbiose, Endosymbiontentheorie, Parasitismus, Selektionsdruck, Anpassung, Evolutionsökologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Koevolution: Ein Überblick"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Koevolution. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf verschiedenen Arten der Koevolution, mit detaillierten Beispielen aus der Pflanzen- und Tierwelt.
Welche Arten der Koevolution werden behandelt?
Der Text beschreibt paarweise, diffuse und asymmetrische Koevolution. Besonders detailliert wird die paarweise Koevolution anhand verschiedener Beispiele wie Blüten-Pollinatoren-Koevolution (Bienen und Salbei, Feigen und Feigenwespen, Fledermäuse und Kolibris), der Koevolution von Pflanzen und Herbivoren (mit Beispielen wie dem Karminbär und dem Lärchenwickler), Mutualismus (Yuccapalme und Yuccamotte), Symbiosen (Mykorrhiza, Flechten, Termiten, Wiederkäuer) und Parasitismus (Großer Leberegel, gallenbildende Insekten) erläutert.
Welche Beispiele für paarweise Koevolution werden genannt?
Der Text nennt zahlreiche Beispiele für paarweise Koevolution. Im Bereich der Blüten-Pollinatoren-Koevolution werden Bienen und Salbei, Feigen und Feigenwespen, Fledermäuse in Südamerika und Kolibris detailliert beschrieben. Bei der Koevolution von Pflanzen und Herbivoren werden der Karminbär und das Lärchen-Lärchenwickler-System als Beispiele genannt. Mutualistische Beziehungen werden anhand der Yuccapalme und Yuccamotte veranschaulicht.
Welche Symbiosen werden im Text behandelt?
Der Text beschreibt verschiedene Symbiosen, inklusive Mykorrhizza, Flechten und die Endosymbiontentheorie als Grundlage der Entstehung eukaryotischer Zellen. Zusätzlich werden die symbiotischen Beziehungen bei Termiten und Wiederkäuern (beispielsweise Kühen) detailliert dargestellt.
Was wird unter Parasitismus im Kontext der Koevolution verstanden?
Der Text behandelt den Parasitismus als eine Form der Koevolution. Es wird zwischen Mikro- und Makroparasiten unterschieden, und die Anpassungen von Parasiten an ihre Wirte und deren Lebenszyklen werden erläutert, mit Beispielen wie dem Großen Leberegel und gallenbildenden Insekten. Die Parasitenhypothese wird im Kontext von Koevolution und sexueller Selektion diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Zu den Schlüsselbegriffen gehören Koevolution, paarweise Koevolution, diffuse Koevolution, asymmetrische Koevolution, Blüten-Pollinatoren-Koevolution, Pflanzengifte, Herbivoren, induzierte Resistenz, Mutualismus, Symbiose, Endosymbiontentheorie, Parasitismus, Selektionsdruck und Anpassung.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist für alle gedacht, die sich einen Überblick über das Thema Koevolution verschaffen möchten. Das Verständnis der grundlegenden Konzepte der Evolutionsökologie wird vorausgesetzt. Der Text ist auf akademisches Publikum ausgerichtet.
Welche Kapitel beinhaltet der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Arten der Koevolution und ein ausführliches Kapitel zu paarweiser Koevolution mit Unterkapiteln zu Blüten-Pollinatoren-Koevolution, Pflanzengiften gegen Herbivoren, Mutualismus, Symbiosen und Parasitismus. Der Text endet mit einer Schlussfolgerung.
- Quote paper
- Martin Mehringer (Author), 2009, Coevolution - Die gegenseitige Anpassung von Tieren und Pflanzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156629