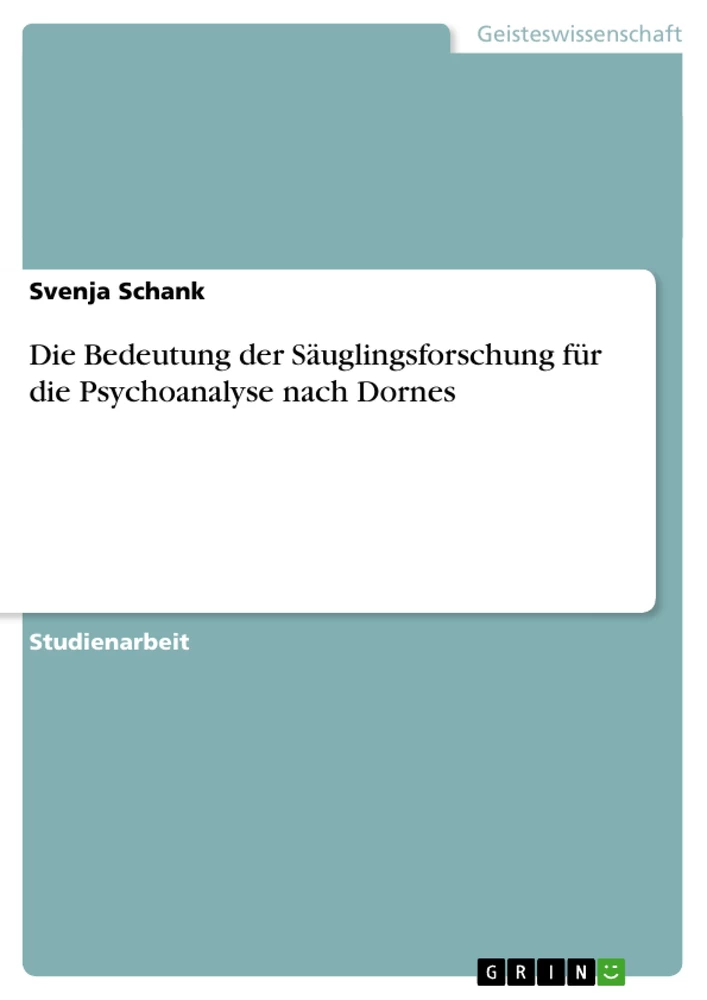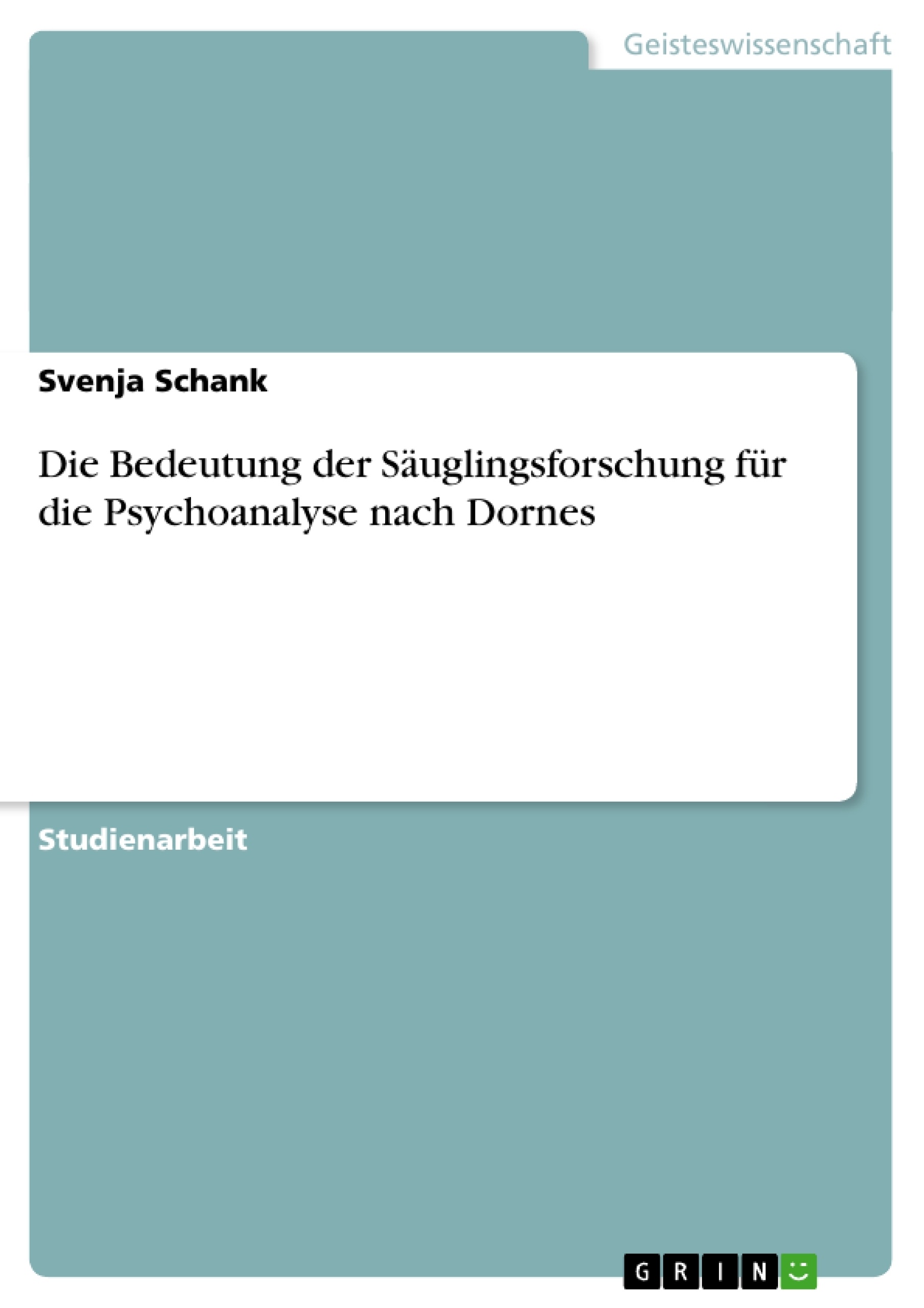Dies ist eine Literaturrezeption, die die zentralen Aspekte der Einflussnahme bzw. der möglichen Einflussnahme von Säuglingsforschung auf die Psychoanalytische Theorie heraus stellt. Dornes' Haltung ist deutlich: Die Psychoanalyse sollte einige Theoreme dem aktuellen Forschungsstand der Entwicklungspsychologie anpassen. - Ein Plädoyer für die Annäherung der Psychoanalyse und ihrer Nachbardisziplinen.
Trotz beeindruckender Forschung auf dem Gebiet wird der Säugling in der psychoanalytischen Theorie nicht gut genug verstanden. Er wird für passiv, hilflos, abhängig, undifferenziert, seinen Trieben ausgeliefert gehalten. - Diese Sichtweise gibt einen Teil der Säuglingserfahrung als ihr Ganzes aus.
Das Ergebnis eines neuen Blicks auf den Säugling ist, dass dieser ein "kompetenter Säugling" (Stone et al. 1973) ist, mit Fähigkeiten und Emotionen, die die Psychoanalyse nicht für möglich hielt. Deshalb haben Psychoanalytiker Anfang der 1980er Jahre mit einer systematischen textlichen Verarbeitung dieser Forschungsergebnisse begonnen.
Martin Dornes erläutert in "Die frühe Kindheit - Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre" neue Befunde auf dem Gebiet der Bedeutung von Säuglingszeit für die Persönlichkeitsentwicklung, sowie deren Anwendungsmöglichkeiten in der Psychoanalyse. Des Weiteren beschreibt er einige Klassiker der Entwicklungspsychologie und analysiert sie kritisch.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Martin Dornes
- Die Debatte zwischen Säuglingsforschung und Psychoanalyse
- Das rekonstruierte und das reale Kind
- Autismus und Symbiose
- Das Krankheitsbild der Symbiose
- Borderline
- Affekte
- Affekte und Triebtheorie
- Das präsymbolische Denken
- Introjektion und projektive Identifizierung beim Säugling
- Die Entstehung von Phantasie
- Piaget und Lichtenberg über die Entstehung des inneren Bildes
- Symbolisches Spiel
- Freie und bedingte Evokation
- Empirische und hypothetische Repräsentation
- Unbewußte Phantasien
- Postpiagetsche Befunde
- Objektpermanenz und die Entstehung des inneren Bildes
- Interaktion und ihre Repräsentierung
- Sterns Theorie des Denkens
- Interaktion und Anerkennung von Bedürfnissen
- Interaktion und reziproke Anerkennung
- Interaktion und primäre und sekundäre Intersubjektivität
- Frühkindliche Entwicklung und ihre Bedeutung für die Neurosenpsychologie
- Die Wahrnehmung des Säuglings
- Die Gefühle des Säuglings
- Symbolisierte und nicht-symbolisierte Gefühle
- Phantasie als Grund für Neurosen und als Antriebskraft der Entwicklung
- Averbale Kommunikation und Interaktion
- Projektive Identifizierung als nicht-intentionale Kommunikation
- Die averbale Kommunikation abgewehrter Affekte
- Die Reaktion des Säuglings auf die Depressivität seiner Mutter
- Kritik
- Zusammenfassung
- Reflexion
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit von Martin Dornes in "Die frühe Kindheit" zielt darauf ab, die Bedeutung der Säuglingsforschung für die Psychoanalyse zu beleuchten und die Kluft zwischen beiden Disziplinen zu überbrücken. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Erkenntnisse der Säuglingsforschung zur Erweiterung und Neubestimmung der psychoanalytischen Theorie beitragen können.
- Die Relevanz der Säuglingsforschung für die Psychoanalyse
- Die Entstehung und Bedeutung der Phantasie in der frühen Kindheit
- Die Rolle von Interaktion und Intersubjektivität in der Säuglingsentwicklung
- Die Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung für die Entstehung von Neurosen
- Kritik an der traditionellen Triebtheorie in der Psychoanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Zielsetzung des Buches darstellt. Anschließend wird der Autor Martin Dornes vorgestellt und seine wissenschaftliche Expertise beleuchtet.
Im dritten Kapitel wird die Debatte zwischen Säuglingsforschung und Psychoanalyse aufgezeigt. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf den Säugling und dessen Fähigkeiten diskutiert. Das Kapitel beleuchtet zudem die Rolle von Autismus, Borderline, Affekten und präsymbolischem Denken in diesem Zusammenhang.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung von Phantasie beim Kleinkind. Dabei werden die Theorien von Piaget und Lichtenberg zur Entwicklung des inneren Bildes und die Bedeutung des symbolischen Spiels vorgestellt. Die Kapitel diskutieren ebenfalls die Konzepte von freier und bedingter Evokation sowie empirischer und hypothetischer Repräsentation.
Im fünften Kapitel werden postpiagetsche Befunde über Objektpermanenz und Interaktionsrepräsentierung beim Säugling behandelt. Es werden die Theorien von Stern über das Denken sowie die Rolle von Interaktion und Anerkennung von Bedürfnissen diskutiert.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der frühkindlichen Entwicklung und deren Bedeutung für die Neurosenpsychologie. Es werden die Wahrnehmung und die Gefühle des Säuglings sowie die Rolle der Phantasie als Grund für Neurosen analysiert. Die averbale Kommunikation und Interaktion sowie die projektive Identifizierung werden in diesem Zusammenhang untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit umfassen Säuglingsforschung, Psychoanalyse, Entwicklungspsychologie, Phantasie, Interaktion, Intersubjektivität, Neurosenpsychologie, Triebtheorie, Objektpermanenz, Symbolisierung, Averbale Kommunikation und Projektive Identifizierung.
- Quote paper
- Svenja Schank (Author), 2003, Die Bedeutung der Säuglingsforschung für die Psychoanalyse nach Dornes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15655