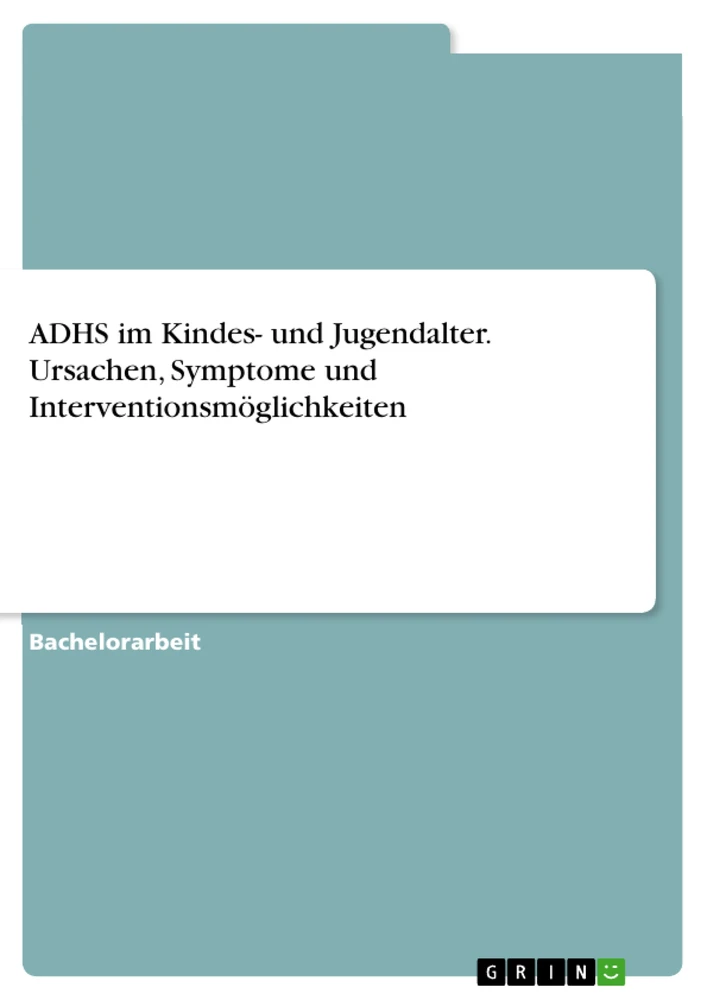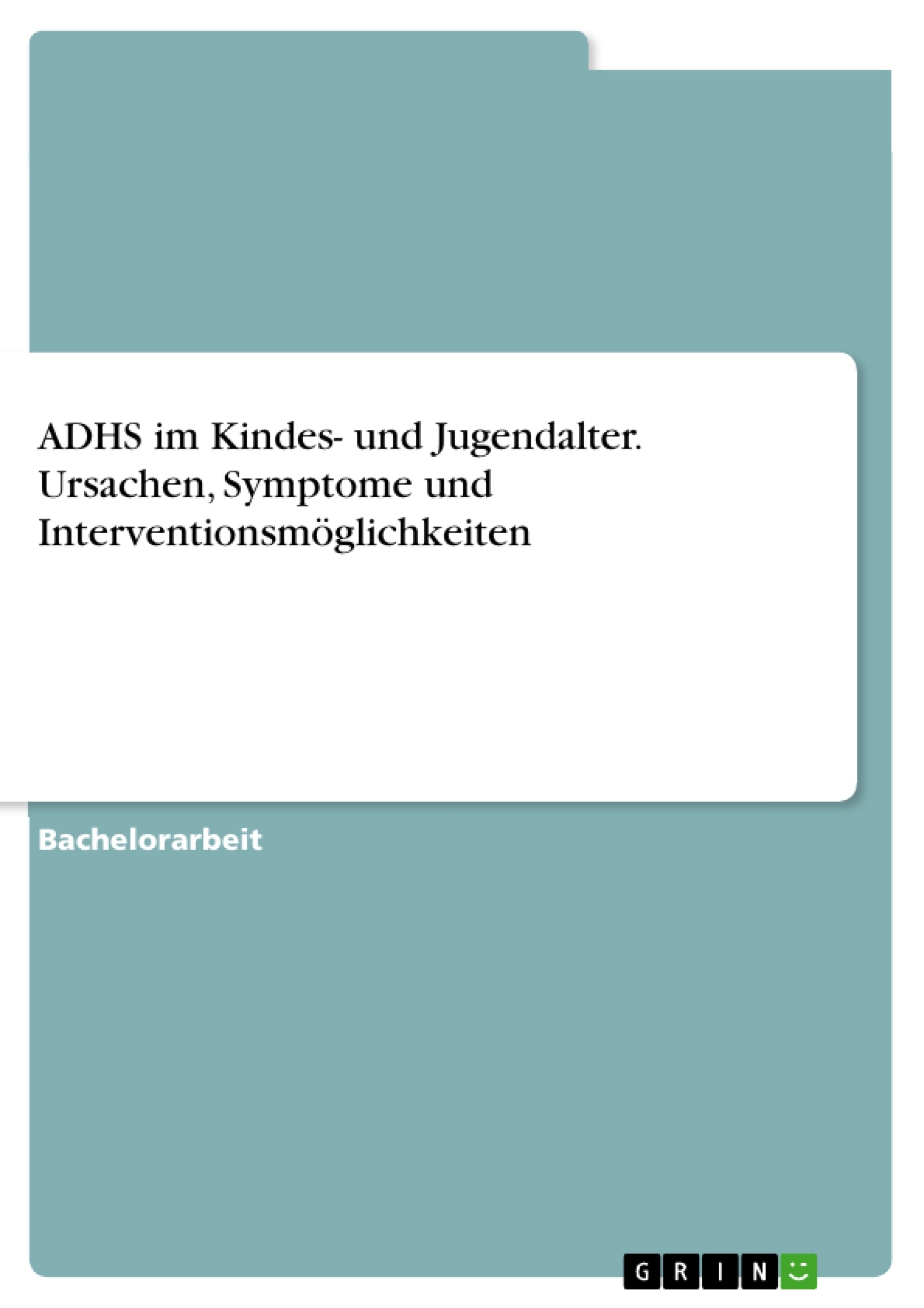Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema AD(H)S und fokussiert sich auf Kinder und Jugendliche, die von Aufmerksamkeitsschwäche, Impulsivität und/oder Hyperaktivität betroffen sind. Demnach werden die Ursachen, Symptome und Interventionsmöglichkeiten von AD(H)S im Kindes- und Jugendalter in dieser Arbeit elaboriert.
Ziel dieser Arbeit ist es, stärker auf AD(H)S bei Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen und verschiedene Ansätze zu erörtern, wie das Leid von Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose AD(H)S durch Unterstützung von Eltern, LehrerInnen und TherapeutInnen und weiteren Fachkräften verringert werden kann, sodass die Kinder und Jugendlichen eine erfolgreiche und glückliche Schulzeit haben können, ohne wegen ihrer Diagnose verurteilt zu werden.
Zudem ist es in dieser Arbeit von großer Bedeutung, aufzuzeigen, dass AD(H)S eine reale Störung ist, welche ernst genommen werden muss und dass Handlungsbedarf seitens therapeutischer und pädagogischer Fachkräfte sowie auch seitens der Angehörigen, insbesondere der Eltern, besteht.
Höchstwahrscheinlich sind wir alle mit einem Kind oder einem Jugendlichen, welches beziehungsweise welcher von der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung - folglich mit AD(H)S abgekürzt - betroffen war, in Kontakt gekommen. Dies kann aufgrund der hohen Vorbereitung von AD(H)S als MitschülerIn in der Schule, als Geschwisterkind oder Elternteil eines betroffenen Menschen, als PädagogIn im Kontext Kindertagesstätte oder Schule oder auch als Betroffene oder Betroffener von AD(H)S selbst der Fall sein.
„Hinter ADHS verbirgt sich eine der häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Man nimmt an, dass etwa 2 bis 6 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter krankhaften Störungen der Aufmerksamkeit und an motorischer Unruhe leiden“ (www.Bundesministerium für Gesundheit: 2023).
Der Aussage des Bundesministeriums für Gesundheit ist zu entnehmen, dass das Thema Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung stets aktuell ist. Es bedarf grundlegende Kenntnisse seitens pädagogischer und therapeutischer Fachkräfte sowie Angehöriger, um auf das Leid der Betroffenen aufmerksam zu machen, ihren Bedürfnissen gerecht zu
werden und ihnen somit die Chance auf ein glückliches und erfolgreiches Leben frei von Vorurteilen zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Exkurs
- 3. Diskussionsarena AD(H)S
- 3.1. Begriffsklärung
- 3.2. Klassifikationsmöglichkeiten
- 3.2.1. Klassifikation nach ICD-10
- 3.2.2. Klassifikation nach DSM-5
- 3.3. Epidemiologie
- 4. Symptomatik
- 4.1. Unaufmerksamkeit
- 4.2. Hyperaktivität
- 4.3. Impulsivität
- 4.4. Stärken und Ressourcen
- 4.5. Komorbide Erkrankungen
- 4.5.1. AD(H)S und externalisierende Störungen
- 4.5.2. AD(H)S und internalisierende Störungen
- 4.5.3. AD(H)S und Lern- und Leistungsstörungen
- 4.5.4. Weitere Komorbiditäten
- 4.6. Auswirkungen
- 5. Ursachen
- 5.1. Neurobiologische Faktoren
- 5.2. Genetische Faktoren
- 5.3. Psychosoziale Faktoren
- 6. Diagnostik
- 6.1. Befragung
- 6.2. Verhaltensbeobachtung
- 6.3. Fragebögen
- 6.4. Untersuchung
- 7. Interventionsmöglichkeiten
- 7.1. Medikamentöse Behandlung mit Ritalin
- 7.2. Therapeutische Behandlung
- 7.3. Implikationen für die Erziehungspraxis
- 7.3.1. Implikationen für Eltern
- 7.3.2. Implikationen für Lehrkräfte
- 7.4. Praxisfeld Soziale Arbeit
- 8. Verallgemeinerung der Erkenntnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit zielt darauf ab, das Verständnis von AD(H)S im Kindes- und Jugendalter zu verbessern und Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen. Sie beleuchtet die Ursachen, Symptome und Auswirkungen der Störung und diskutiert verschiedene Ansätze zur Unterstützung betroffener Kinder und Jugendlicher sowie deren Umfeld.
- Historisches Verständnis von AD(H)S
- Klassifikation und Epidemiologie von AD(H)S
- Symptome, Stärken und Komorbiditäten von AD(H)S
- Ursachen von AD(H)S (neurobiologisch, genetisch, psychosozial)
- Diagnostik und Interventionsmöglichkeiten von AD(H)S
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema AD(H)S bei Kindern und Jugendlichen ein und betont die hohe Relevanz der Störung. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit eines besseren Verständnisses von AD(H)S und die Bedeutung von Unterstützung für Betroffene und deren Angehörige. Das Ziel der Arbeit wird als Sensibilisierung für AD(H)S und die Erörterung von Unterstützungsmöglichkeiten formuliert, um betroffenen Kindern und Jugendlichen eine erfolgreiche und glückliche Entwicklung zu ermöglichen. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, AD(H)S als ernstzunehmende Störung zu betrachten und Handlungsbedarf seitens Fachkräfte und Angehöriger zu betonen.
2. Historischer Exkurs: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von AD(H)S, beginnend mit dem Begriff „Zappelphilipp“ bis hin zur heutigen medizinischen Diagnose. Es verfolgt die Veränderungen in der Wahrnehmung und Behandlung der Störung im Laufe der Zeit nach.
3. Diskussionsarena AD(H)S: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Begriff AD(H)S, seinen Klassifikationsmöglichkeiten nach ICD-10 und DSM-5, sowie mit der Epidemiologie der Störung. Es vergleicht die beiden Klassifizierungssysteme und analysiert ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Abschnitt zur Epidemiologie präsentiert Daten zur Verbreitung von AD(H)S bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
4. Symptomatik: Kapitel 4 beschreibt detailliert die Symptomatik von AD(H)S, wobei sowohl die Defizite als auch die Stärken und Ressourcen betroffener Kinder und Jugendlicher berücksichtigt werden. Es werden häufige Komorbiditäten wie Lese-Rechtschreibschwäche oder Angststörungen erläutert und die Auswirkungen der Symptomatik im familiären und schulischen Kontext analysiert.
5. Ursachen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Ursachen von AD(H)S. Es werden neurobiologische, genetische und psychosoziale Faktoren untersucht, die die Entwicklung der Störung begünstigen oder auslösen können, und beleuchtet deren Zusammenwirken.
6. Diagnostik: Kapitel 6 erläutert die verschiedenen Methoden zur Diagnose von AD(H)S. Es werden Befragungen, Verhaltensbeobachtungen, der Einsatz von Fragebögen und die Durchführung von Untersuchungen detailliert beschrieben, die zur Erstellung einer Diagnose beitragen.
7. Interventionsmöglichkeiten: Dieses Kapitel stellt verschiedene Interventionsmöglichkeiten vor, die zur Behandlung von AD(H)S eingesetzt werden. Es behandelt sowohl medikamentöse Behandlungen (z.B. mit Ritalin) als auch therapeutische Ansätze. Der Fokus liegt auf Implikationen für die Erziehungspraxis sowohl für Eltern als auch für Lehrkräfte und die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit AD(H)S.
Schlüsselwörter
AD(H)S, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Kinder, Jugendliche, Symptome, Ursachen, Diagnostik, Interventionsmöglichkeiten, Neurobiologie, Genetik, Psychosoziale Faktoren, Komorbidität, Therapie, Erziehung, Schule, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema AD(H)S (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) im Kindes- und Jugendalter.
Welche Ziele verfolgt diese Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis von AD(H)S zu verbessern, Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen und die Ursachen, Symptome und Auswirkungen der Störung zu beleuchten. Sie diskutiert verschiedene Ansätze zur Unterstützung betroffener Kinder und Jugendlicher sowie deren Umfeld.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen: das historische Verständnis von AD(H)S, Klassifikation und Epidemiologie, Symptome, Stärken und Komorbiditäten, Ursachen (neurobiologisch, genetisch, psychosozial), sowie Diagnostik und Interventionsmöglichkeiten.
Was beinhaltet die Einleitung?
Die Einleitung führt in das Thema AD(H)S ein, betont die Relevanz der Störung und die Notwendigkeit eines besseren Verständnisses. Sie verdeutlicht das Ziel der Arbeit: Sensibilisierung und Erörterung von Unterstützungsmöglichkeiten.
Was wird im historischen Exkurs beleuchtet?
Der historische Exkurs verfolgt die Entwicklung des Verständnisses von AD(H)S von frühen Beschreibungen bis zur heutigen medizinischen Diagnose.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Diskussionsarena AD(H)S"?
Dieses Kapitel bietet eine Auseinandersetzung mit dem Begriff AD(H)S, seinen Klassifikationsmöglichkeiten nach ICD-10 und DSM-5, sowie mit der Epidemiologie der Störung.
Welche Symptome werden detailliert beschrieben?
Die Symptomatik von AD(H)S wird detailliert beschrieben, wobei sowohl Defizite als auch Stärken und Ressourcen berücksichtigt werden. Häufige Komorbiditäten und Auswirkungen im familiären und schulischen Kontext werden analysiert.
Welche Ursachen werden untersucht?
Es werden neurobiologische, genetische und psychosoziale Faktoren untersucht, die die Entwicklung von AD(H)S begünstigen oder auslösen können, sowie deren Zusammenwirken.
Welche diagnostischen Methoden werden erläutert?
Es werden Befragungen, Verhaltensbeobachtungen, der Einsatz von Fragebögen und die Durchführung von Untersuchungen detailliert beschrieben, die zur Erstellung einer Diagnose beitragen.
Welche Interventionsmöglichkeiten werden vorgestellt?
Es werden medikamentöse Behandlungen (z.B. mit Ritalin) als auch therapeutische Ansätze vorgestellt. Der Fokus liegt auf Implikationen für die Erziehungspraxis (Eltern und Lehrkräfte) und die Rolle der Sozialen Arbeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: AD(H)S, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Kinder, Jugendliche, Symptome, Ursachen, Diagnostik, Interventionsmöglichkeiten, Neurobiologie, Genetik, Psychosoziale Faktoren, Komorbidität, Therapie, Erziehung, Schule, Soziale Arbeit.
- Citar trabajo
- Anónimo,, 2023, ADHS im Kindes- und Jugendalter. Ursachen, Symptome und Interventionsmöglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1565147