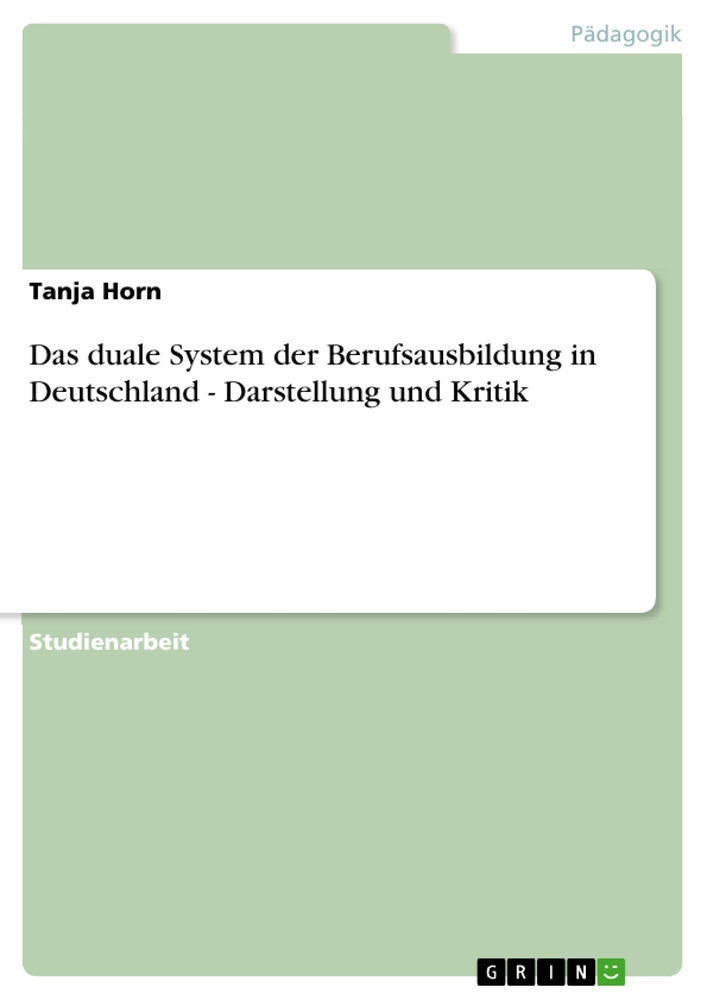In der heutigen „Wissensgesellschaft“ nimmt neben der allgemeinen Ausbildung die Berufsausbildung für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes eine immer bedeutendere Rolle ein, denn diese Faktoren bestimmen nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitnehmern/innen auf den angespannten Arbeitsmärkten, sondern auch die zukünftigen Chancen der Unternehmen im Wettbewerb.
Auf Grund der zunehmenden Bedeutsamkeit der beruflichen Bildung habe ich mich in meiner hier vorliegenden Arbeit für diesen Themenbereich entschieden und das duale System der Berufsausbildung in Deutschland als Schwerpunkt gewählt.
Das duale System, welches durch das Zusammenwirken von betrieblicher und schulischer Ausbildung gekennzeichnet ist, stellt nicht nur das vorherrschende Berufsausbildungssystem in Deutschland dar, sondern genießt auch international sehr hohes Ansehen, was sicherlich nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass hochqualifizierte Arbeitskräfte aus der Ausbildung hervorgehen, die anschließend dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig wird in öffentlichen Diskussionen aber auch Kritik am dualen System geübt und die Frage gestellt, inwieweit es den Anforderungen an eine qualitativ hochstehende und zukunftsträchtige Berufsausbildung (noch) gerecht wird.
Zur Darstellung des dualen Systems werde ich im Folgenden zunächst auf dessen Definition sowie auf die historische Entwicklung eingehen, anschließend Funktionselemente sowie Lernorte des dualen Systems beleuchten und mich als letzten Punkt meiner Hausarbeit der Kritik zuwenden, die diesem System entgegengebracht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des dualen Systems der Berufsausbildung
- Die historische Entwicklung
- Gründungsphase (1870 – 1920)
- Stabilisierungsphase (1920 – 1970)
- Funktionselemente der dualen Berufsausbildung
- Ausbildungsmarkt
- Berufsbildungsrecht
- Die Lernorte
- Definition Lernort
- Lernort „Betrieb“
- Lernort „Überbetriebliche Berufsbildungsstätte“ (ÜBS)
- Lernort „Berufsschule“
- Kritik
- Zur Fragwürdigkeit des Berufsprinzips
- Gesamtwirtschaftlicher Qualifikationsbedarf
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das duale System der Berufsausbildung in Deutschland. Ziel ist es, das System zu definieren, seine historische Entwicklung nachzuzeichnen und seine zentralen Elemente zu beleuchten. Abschließend wird die Kritik am dualen System diskutiert.
- Definition und Charakteristika des dualen Systems
- Historische Entwicklung des dualen Systems
- Schlüsselkomponenten des dualen Systems (Betrieb, Berufsschule, Recht)
- Aktuelle Kritikpunkte am dualen System
- Zukünftige Herausforderungen für das duale System
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung der Berufsausbildung in der Wissensgesellschaft und die damit verbundene Relevanz des dualen Systems in Deutschland. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition, die historische Entwicklung, die Funktionselemente und die Kritik am dualen System umfasst. Die Einleitung verweist auf die hohe internationale Anerkennung des Systems, gleichzeitig aber auch auf öffentliche Kritikpunkte, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
Definition des dualen Systems der Berufsausbildung: Dieses Kapitel definiert das duale System gemäß dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) als Zusammenspiel von Betrieb und Berufsschule zur beruflichen Qualifizierung. Es hebt die Aufgabenverteilung zwischen praktischer Ausbildung im Betrieb und theoretischer Ausbildung in der Berufsschule hervor, wobei die Grenzen zwischen Praxis und Theorie in der Realität fließend sind. Der freie Zugang zur dualen Ausbildung ohne vorgeschriebenen Schulabschluss wird ebenfalls erläutert, ebenso wie die übliche Ausbildungsdauer.
Die historische Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des dualen Systems, beginnend mit der Gründungsphase (1870-1920). Die "Große Depression" und die industrielle Revolution führten zu Veränderungen im Handwerk und der Notwendigkeit einer Neuregelung des Lehrlingswesens. Die Gewerbeordnung von 1869, das Handwerkerschutzgesetz von 1897 und der "Kleine Befähigungsnachweis" von 1908 werden als wichtige Meilensteine in der Entwicklung des dualen Systems hervorgehoben. Die Entstehung allgemeiner Fortbildungsschulen zur Schließung der Erziehungslücke zwischen Volksschulabschluss und Militärdienst wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Duales System, Berufsausbildung, Deutschland, Betrieb, Berufsschule, Berufsbildungsgesetz (BBiG), historische Entwicklung, Kritik, Qualifikation, Wissensgesellschaft, Ausbildungsmarkt, Berufsbildungsrecht.
FAQ: Duales System der Berufsausbildung in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das duale System der Berufsausbildung in Deutschland. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie eine Liste wichtiger Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition, der historischen Entwicklung, den zentralen Elementen und der Kritik an diesem Ausbildungssystem.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen sind die Definition und Charakteristika des dualen Systems, seine historische Entwicklung (einschließlich Gründungsphase und Stabilisierungsphase), die Schlüsselkomponenten (Betrieb, Berufsschule, Berufsbildungsrecht), aktuelle Kritikpunkte und zukünftige Herausforderungen.
Wie ist das duale System definiert?
Das duale System wird gemäß dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) als die Zusammenarbeit von Betrieb und Berufsschule zur beruflichen Qualifizierung definiert. Die praktische Ausbildung findet im Betrieb statt, die theoretische Ausbildung in der Berufsschule. Die Grenzen zwischen Praxis und Theorie sind fließend. Der Zugang ist frei, ein bestimmter Schulabschluss ist nicht zwingend erforderlich.
Welche historischen Phasen werden behandelt?
Das Dokument beschreibt die Entwicklung des dualen Systems in zwei Hauptphasen: die Gründungsphase (1870-1920) und die Stabilisierungsphase (1920-1970). Wichtige Meilensteine wie die Gewerbeordnung von 1869, das Handwerkerschutzgesetz von 1897 und der "Kleine Befähigungsnachweis" von 1908 werden erläutert.
Welche Lernorte werden im dualen System unterschieden?
Das Dokument unterscheidet die Lernorte Betrieb, überbetriebliche Berufsbildungsstätte (ÜBS) und Berufsschule. Jeder Lernort wird separat definiert und seine Rolle im Ausbildungsprozess beschrieben.
Welche Kritikpunkte am dualen System werden angesprochen?
Die Kritikpunkte umfassen die Fragwürdigkeit des Berufsprinzips und den gesamtwirtschaftlichen Qualifikationsbedarf. Diese Aspekte werden im Dokument näher beleuchtet, ohne konkrete Lösungsansätze zu präsentieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des dualen Systems?
Die Schlüsselwörter umfassen: Duales System, Berufsausbildung, Deutschland, Betrieb, Berufsschule, Berufsbildungsgesetz (BBiG), historische Entwicklung, Kritik, Qualifikation, Wissensgesellschaft, Ausbildungsmarkt, Berufsbildungsrecht.
Wo finde ich mehr Informationen zum dualen System?
Das Dokument selbst liefert einen guten Überblick. Für detailliertere Informationen kann man sich an weiterführende Literatur zum Berufsbildungsgesetz (BBiG) und zur deutschen Berufsausbildung wenden. Auch offizielle Webseiten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) können hilfreiche Informationen bieten.
- Citation du texte
- Tanja Horn (Auteur), 2006, Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland - Darstellung und Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156328