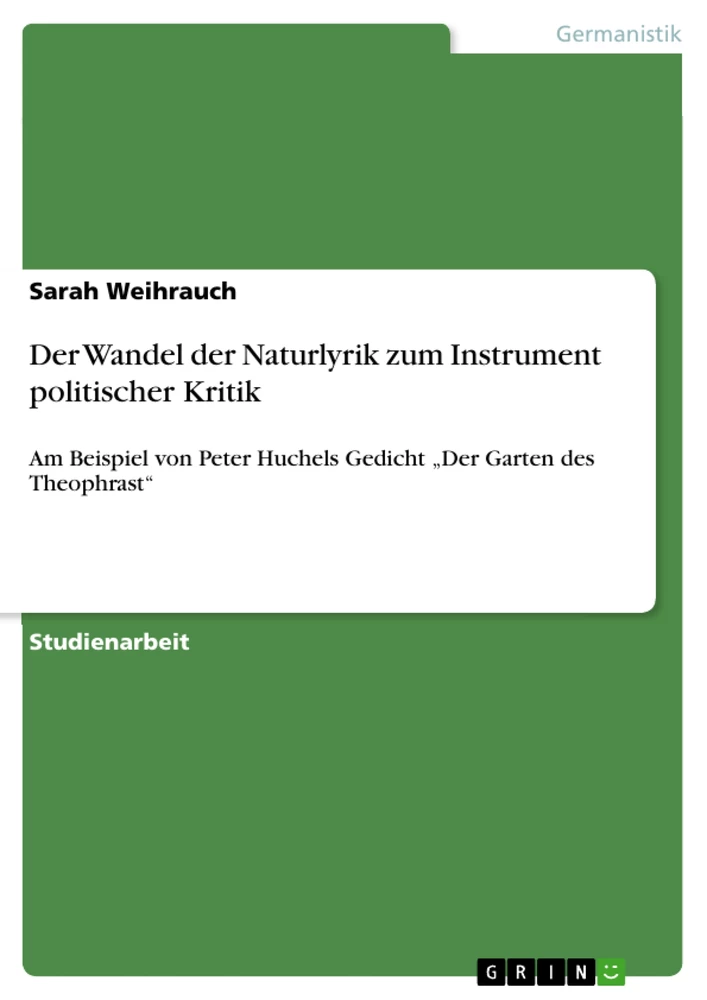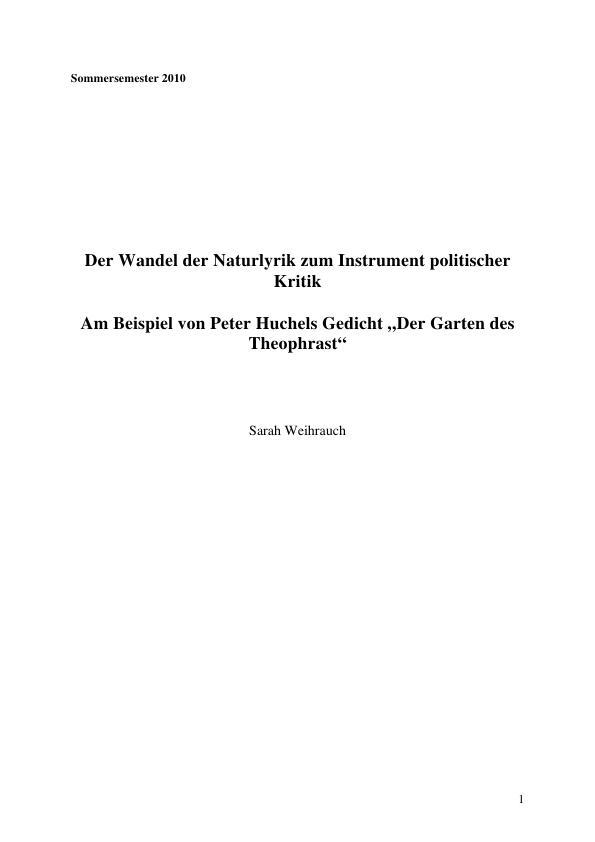In historischer und systematischer Perspektive können sehr verschiedenartige Typen der Beziehung des Menschen zur Natur ausgemacht werden. „Natur erscheint erkenntnistheoretisch als Chamäleon, jeweils die Farbe der Prädispositionen, auch der ideologischen Brille des Betrachters annehmend.“
Mythische, religiöse, philosophische, wissenschaftliche und technische Einstellungen treffen hier zusammen, welche in sich selbst noch weitere differenzierte Eigenarten vorweisen. Eine reine zeitliche Abfolge zum Wandel der Einstellungen des Menschen zur Natur, und damit auch eine wandelnde Einstellung zum Thema Natur in der Lyrik, kann nicht exakt festgestellt werden, da es zu jeder Zeit mitunter zu viele Auffassungen, Überlagerungen und Mischbildungen gegeben hat.
Dennoch stelle ich die These auf, dass sich im Laufe der Jahrhunderte zumindest die Tendenz ausmachen lässt, dass sich das lyrische Verständnis von Natur gewandelt hat, die Naturgedichte somit heutzutage eine andere gesellschaftliche Bedeutung als früher erfüllen.
Zunächst einmal werde ich, beginnend beim Mittelalter, die historische Beziehung des Menschen zur Natur darlegen. Dies wird über den Zugang literarischer Texte und verschiedenen Autoren erreicht. Es soll gezeigt werden, dass der Mensch sich im Laufe der Jahrhunderte von der ursprünglich christlich geprägten Schöpfernatur emanzipiert hat und einen neuen Umgang zur Natur pflegt, diese zum Teil auch für weitere Zwecke lyrisch instrumentalisiert.
Danach folgt die Analyse des Naturgedichtes „Der Garten des Theophrast“ von Peter Huchel, einem deutschen Lyriker und Redakteur. Dieses Gedicht wird besonders daraufhin untersucht, inwiefern Huchel das Naturmotiv instrumentalisiert, um neue Bedeutungsebenen zu erschließen. Auch wird versucht, über die Biografie Huchels einen Zugang zum Gedicht zu finden.
Als Abschluss meiner Arbeit werde ich noch ein Fazit ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Naturlyrik im Wandel: Von Schöpferverehrung zum Instrument politischer Kritik
- Peter Huchel: Chausseen, Chausseen (V.): Der Garten des Theophrast
- Gedichtinterpretation „Der Garten des Theophrast“
- Formales
- Interpretation
- Naturmotive im Gedicht als Ausdruck politischer Kritik- Die Verschmelzung von Natur und Kultur im 20. Jahrhundert
- Gedichtinterpretation „Der Garten des Theophrast“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Naturlyrik von der Schöpferverehrung hin zu einem Instrument politischer Kritik. Sie analysiert das Gedicht „Der Garten des Theophrast“ von Peter Huchel als Beispiel für diese Entwicklung. Die Arbeit beleuchtet den Wandel des Verhältnisses des Menschen zur Natur im Laufe der Geschichte und die daraus resultierende Veränderung der Naturlyrik.
- Historische Entwicklung der Naturlyrik
- Wandel des Menschenbildes und Naturverständnisses
- Interpretation des Gedichts „Der Garten des Theophrast“
- Verwendung von Naturmotiven als politische Kritik
- Die Beziehung zwischen Natur und Kultur im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die These auf, dass sich das lyrische Verständnis von Natur im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat und Naturgedichte heute eine andere gesellschaftliche Bedeutung haben als früher. Es wird der historische Wandel der Beziehung des Menschen zur Natur skizziert und die Methodik der Analyse des Gedichts „Der Garten des Theophrast“ von Peter Huchel erläutert. Der Fokus liegt auf der Instrumentalisierung des Naturmotivs zur Erschließung neuer Bedeutungsebenen und der Betrachtung von Huchels Biografie im Kontext des Gedichts.
Naturlyrik im Wandel: Von Schöpferverehrung zum Instrument politischer Kritik: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die historische Wandlung der Naturlyrik. Es zeigt, wie die Natur im Mittelalter und Barock als Schöpfung Gottes verstanden und verehrt wurde, wenngleich bereits im Barock ambivalente Sichtweisen auftauchten. Das Kapitel verfolgt die Entwicklung vom Schöpfungslob im 18. Jahrhundert hin zu einer eigenständigen, personifizierten Natur, die sich von den biblischen Glaubensvorstellungen löst. Der Prozess der Emanzipation des Menschen von Gott und „seiner Natur“ wird im Kontext der Industrialisierung beschrieben, wobei der Begriff „Umwelt“ als Ersatz für „Natur“ eingeführt wird, um die vom Menschen veränderte Schöpfung zu beschreiben. Das Kapitel endet mit der Vorstellung der kritischen Auseinandersetzung moderner Lyriker mit dem Wandel der Natur im 20. Jahrhundert.
Peter Huchel: Chausseen, Chausseen (V.): Der Garten des Theophrast: Dieses Kapitel beinhaltet die detaillierte Analyse des Gedichts „Der Garten des Theophrast“ von Peter Huchel, mit besonderem Augenmerk auf die Instrumentalisierung des Naturmotivs und der Erschließung neuer Bedeutungsebenen. Es wird sowohl die formale Struktur des Gedichts untersucht als auch seine inhaltliche Interpretation im Kontext von Huchels Biografie und der gesellschaftlich-politischen Situation seiner Zeit beleuchtet. Die Verschmelzung von Natur und Kultur im 20. Jahrhundert wird als zentrales Thema diskutiert, wobei das Gedicht als Spiegel dieser Verschmelzung fungiert.
Schlüsselwörter
Naturlyrik, politische Kritik, Peter Huchel, „Der Garten des Theophrast“, Naturverständnis, Industrialisierung, Umwelt, Schöpferverehrung, Moderne Lyrik, Gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen zu: Naturlyrik im Wandel: Von Schöpferverehrung zum Instrument politischer Kritik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Naturlyrik von der Schöpferverehrung hin zu einem Instrument politischer Kritik. Sie analysiert das Gedicht „Der Garten des Theophrast“ von Peter Huchel als Fallbeispiel für diesen Wandel und beleuchtet die Veränderung des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur im Laufe der Geschichte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Naturlyrik, den Wandel des Menschenbildes und Naturverständnisses, die Interpretation des Gedichts „Der Garten des Theophrast“, die Verwendung von Naturmotiven als politische Kritik und die Beziehung zwischen Natur und Kultur im 20. Jahrhundert.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über die Entwicklung der Naturlyrik, ein Kapitel zur detaillierten Analyse von Peter Huchels Gedicht „Der Garten des Theophrast“ und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die These der Arbeit und die Methodik. Das Kapitel zur Naturlyrik beschreibt deren Wandel von der Schöpferverehrung zur politischen Kritik. Das Kapitel zu Huchels Gedicht analysiert dessen formale Struktur und inhaltliche Bedeutung im Kontext von Huchels Biografie und der politischen Situation seiner Zeit.
Wie wird das Gedicht „Der Garten des Theophrast“ analysiert?
Das Gedicht „Der Garten des Theophrast“ wird detailliert analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf die Instrumentalisierung des Naturmotivs und die Erschließung neuer Bedeutungsebenen gelegt wird. Sowohl die formale Struktur als auch die inhaltliche Interpretation im Kontext von Huchels Biografie und der gesellschaftlich-politischen Situation werden beleuchtet. Die Verschmelzung von Natur und Kultur im 20. Jahrhundert wird als zentrales Thema diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Naturlyrik, politische Kritik, Peter Huchel, „Der Garten des Theophrast“, Naturverständnis, Industrialisierung, Umwelt, Schöpferverehrung, Moderne Lyrik, Gesellschaftlicher Wandel.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit vertritt die These, dass sich das lyrische Verständnis von Natur im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat und Naturgedichte heute eine andere gesellschaftliche Bedeutung haben als früher. Der Fokus liegt auf der Instrumentalisierung des Naturmotivs zur Erschließung neuer Bedeutungsebenen und der Betrachtung von Huchels Biografie im Kontext seines Gedichts.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit wendet eine literaturwissenschaftliche Methode an, die sowohl die formale Analyse des Gedichts als auch dessen Interpretation im historischen und biographischen Kontext beinhaltet. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Beziehung zwischen Natur und Kultur und der Rolle der Naturlyrik in der gesellschaftlichen und politischen Kritik.
- Quote paper
- Sarah Weihrauch (Author), 2010, Der Wandel der Naturlyrik zum Instrument politischer Kritik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156270