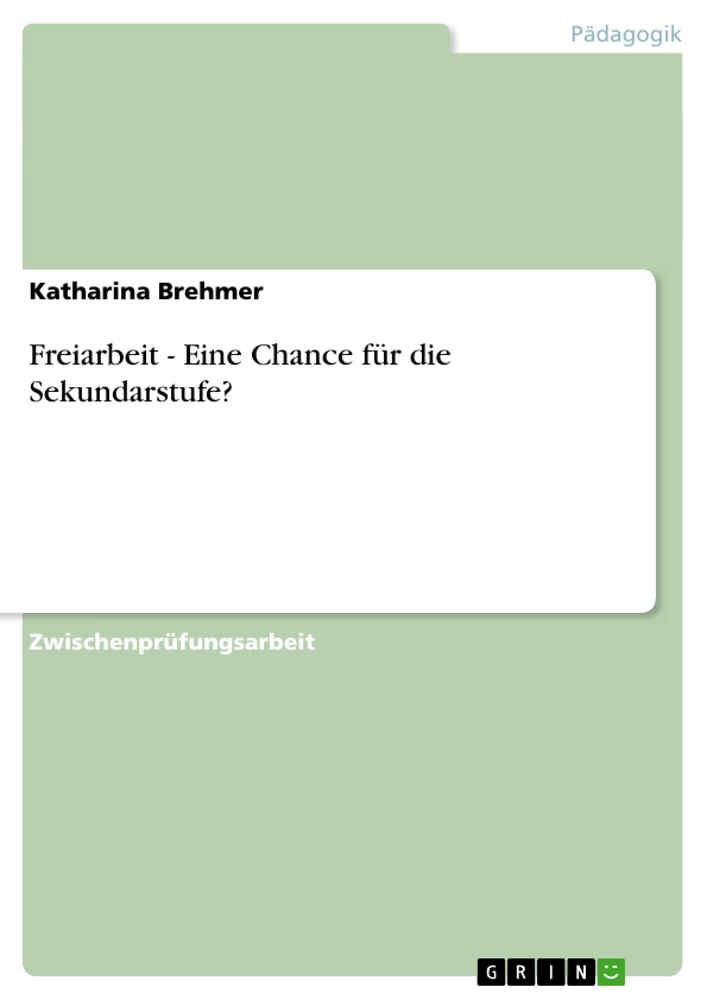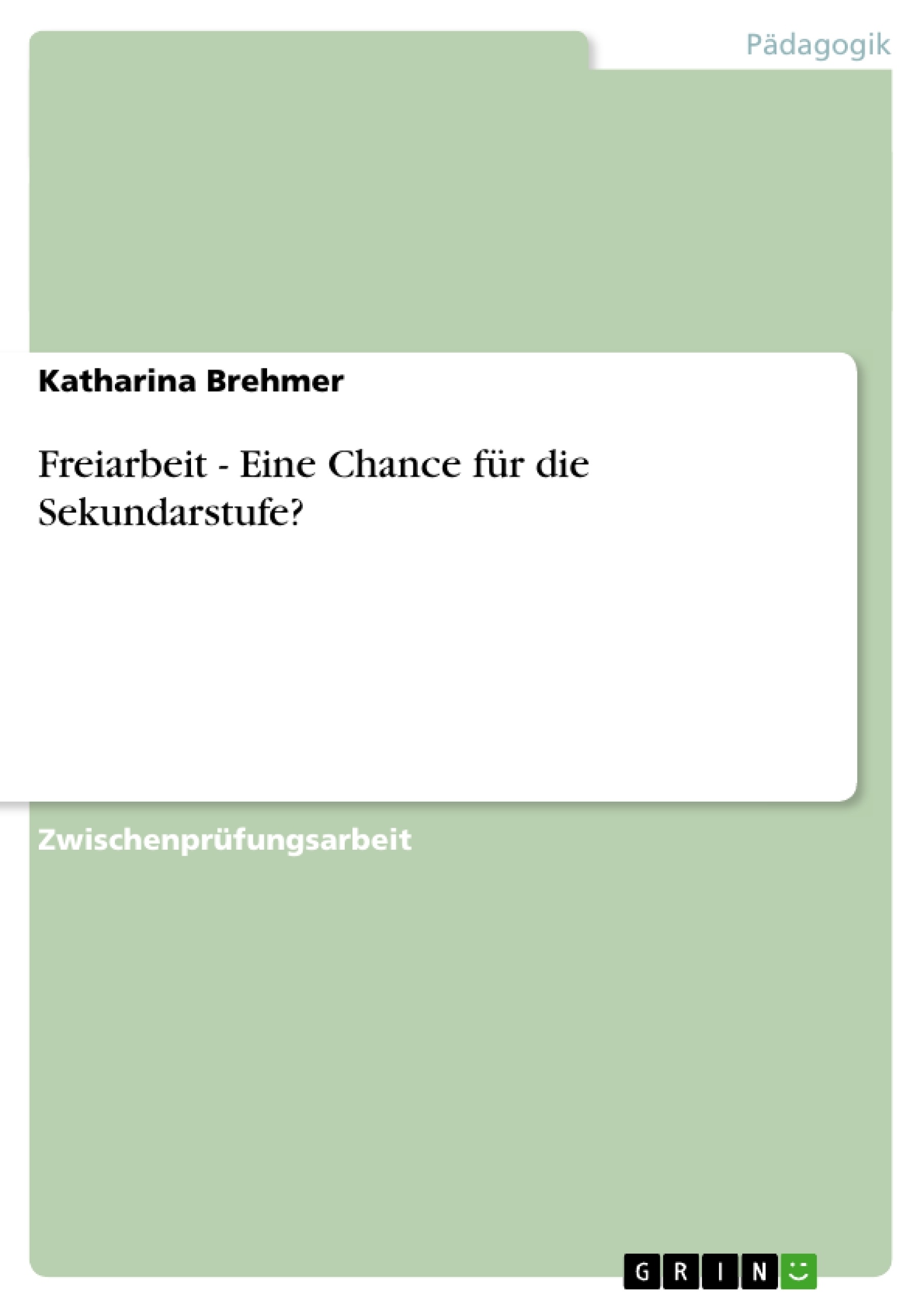Nachdem ich mit der Problematik der Methodenvielfalt in dem Seminar „Methodenvielfalt im
Unterricht“ vertraut gemacht wurde, möchte ich in dieser Arbeit den Begriff der Freiarbeit,
als eine Möglichkeit des Offenen Unterrichts genauer betrachten. Wie bereits der Titel verrät,
sollen im Zentrum meiner Überlegungen die Möglichkeiten und Potenzen der Realisierung
von Freiarbeit in der Sekundarstufe, insbesondere am Gymnasium1, stehen.
Aus der zahlreichen Literatur, die sich mit der Freiarbeit auseinandersetzt, wurde mir deutlich,
dass der Begriff des Freien Arbeitens bis vor einigen Jahren hauptsächlich im Zusammenhang
mit der Grundschule verbunden wurde, wo es mittlerweile als Methode durchaus akzeptiert ist
und verhältnismäßig häufig angewendet wird. Betrachtet man aber den
Sekundarstufenbereich, muss man feststellen, dass dieser kaum Beachtung fand oder dass
offenere Unterrichtsformen wie Freiarbeit hier weitaus weniger anerkannt waren. Offener
Unterricht fand, wenn überhaupt, meist außerhalb des schulinternen Unterrichts statt, wie z.B.
in Projektwochen oder Studienfahrten.2 Daran hat sich bis heute nicht wirklich viel geändert.
Doch zeigt die neuere Literatur, dass es im Zuge der Reformbewegung immer wieder
Bestrebungen gab und gibt, Freiarbeit auch in den Sekundarstufenbereich zu integrieren. Dazu
sollen „Brückenschläge von der Grundschule her zu den weiterführenden Schulen hin“ (Groß
1992: 41) gezogen werden3, denn hier herrscht eine Kluft.
Anfangs wurde oft versucht, Methoden der Grundschule auch in den Sekundarstufenbereich
zu übernehmen. Doch mittlerweile gibt es immer mehr Literatur mit speziellen
Handlungsanweisungen und -hilfen zum erfolgreichen Umgang mit Freiarbeit in der
Sekundarstufe.
Einer der Autoren, der sich speziell mit diesem Thema beschäftigt hat, ist Claus C. Krieger.
Er vertritt die Meinung, dass Freiarbeit sowohl in der Grundschule als auch in der
Sekundarstufe absolut sinnvoll sei. Sie könne die bis heute „bestehende Kluft zwischen
Schulwirklichkeit und schülerorientierten Intentionen der Bildungspläne“ schließen und sei
ein wesentlicher Beitrag zur „Humanisierung der Schule“ (Krieger 1994: IX). [...]
1 Das Gymnasium findet in meinen Untersuchungen besondere Beachtung, da dieses über die Sek. I hinaus noch über einen
zweiten Sekundarstufenbereich verfügt.
2 Siehe hierzu auch die Ausführungen von C.G. Krieger (1994 : IX)
3 „Von der Grundschule lernen“ heißt es bei Werner G. Mayer (1992: 14).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arbeitsplan
- Zur Freiarbeit
- Warum Freiarbeit?
- Potenzen und Lernziele der Freiarbeit
- Anforderungen
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Freiarbeit in der Sekundarstufe, insbesondere im Gymnasium. Sie analysiert die historische Entwicklung des Begriffs, erörtert die Gründe für die Implementierung von Freiarbeit, beleuchtet die Potenziale und Lernziele, und betrachtet die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung. Ziel ist es, die Chancen und Grenzen von Freiarbeit in der Sekundarstufe aufzuzeigen und ihre Bedeutung für die pädagogische Praxis zu diskutieren.
- Historische Entwicklung des Begriffs Freiarbeit
- Bedeutung von Freiarbeit in der heutigen Lebenswelt
- Potenziale und Lernziele von Freiarbeit in der Sekundarstufe
- Notwendige Rahmenbedingungen für die Implementierung von Freiarbeit
- Chancen und Grenzen von Freiarbeit in der Sekundarstufe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt eine Einführung in das Thema der Arbeit und erläutert den Fokus auf die Möglichkeiten und Potenziale der Freiarbeit in der Sekundarstufe, insbesondere am Gymnasium. Sie stellt den aktuellen Stand der Forschung dar und hebt die Bedeutung von Freiarbeit für eine schülerorientierte Bildung hervor.
Zur Freiarbeit
Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln und die reformpädagogischen Ansätze der Freiarbeit. Es beleuchtet die Bedeutung von Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung in der Pädagogik und zeigt die Einflüsse von Pädagogen wie Rousseau, Pestalozzi und Fröbel auf.
Warum Freiarbeit?
Dieses Kapitel befasst sich mit den Gründen für die Implementierung von Freiarbeit in der Sekundarstufe. Es analysiert die Bedürfnisse und Lebenswirklichkeiten von Schülern und stellt die aktuellen Probleme der gymnasialen Bildung in den Vordergrund.
Potenzen und Lernziele der Freiarbeit
Dieses Kapitel untersucht die Potenziale und Lernziele von Freiarbeit im Hinblick auf die Sekundarstufe. Es beleuchtet die Bedeutung von Freiarbeit für die Förderung von Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kreativität und analysiert die spezifischen Vorteile für die Sekundarstufen I und II.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Freiarbeit, Offener Unterricht, Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung, Schülerorientierung, Sekundarstufe, Gymnasium, Bildungsziele, Rahmenbedingungen und Schulpraxis.
- Quote paper
- Katharina Brehmer (Author), 2002, Freiarbeit - Eine Chance für die Sekundarstufe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15617