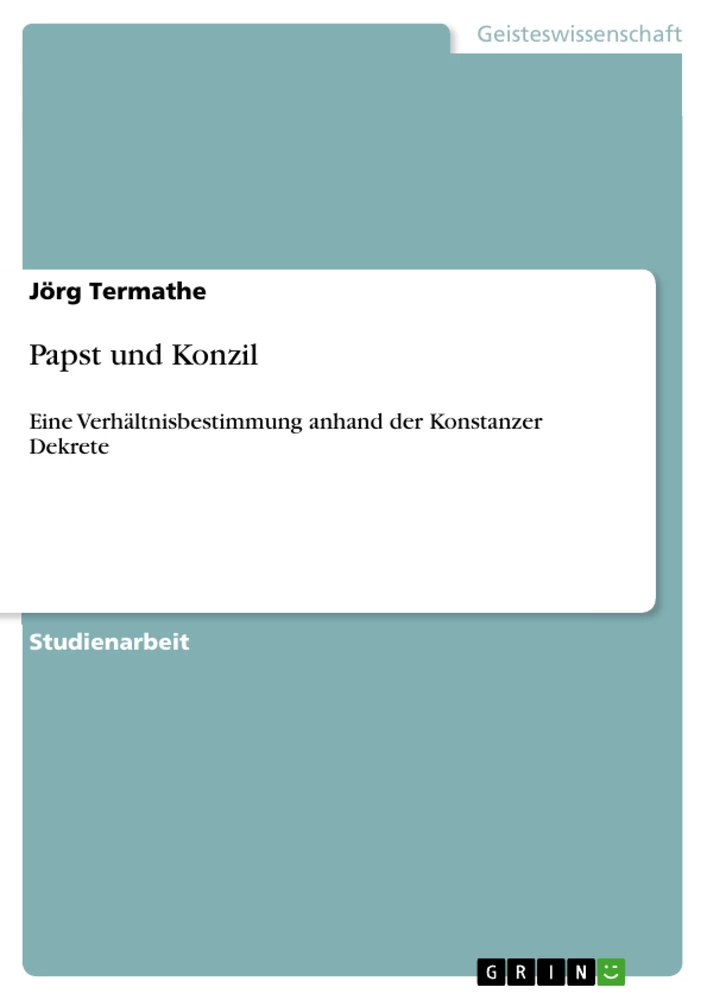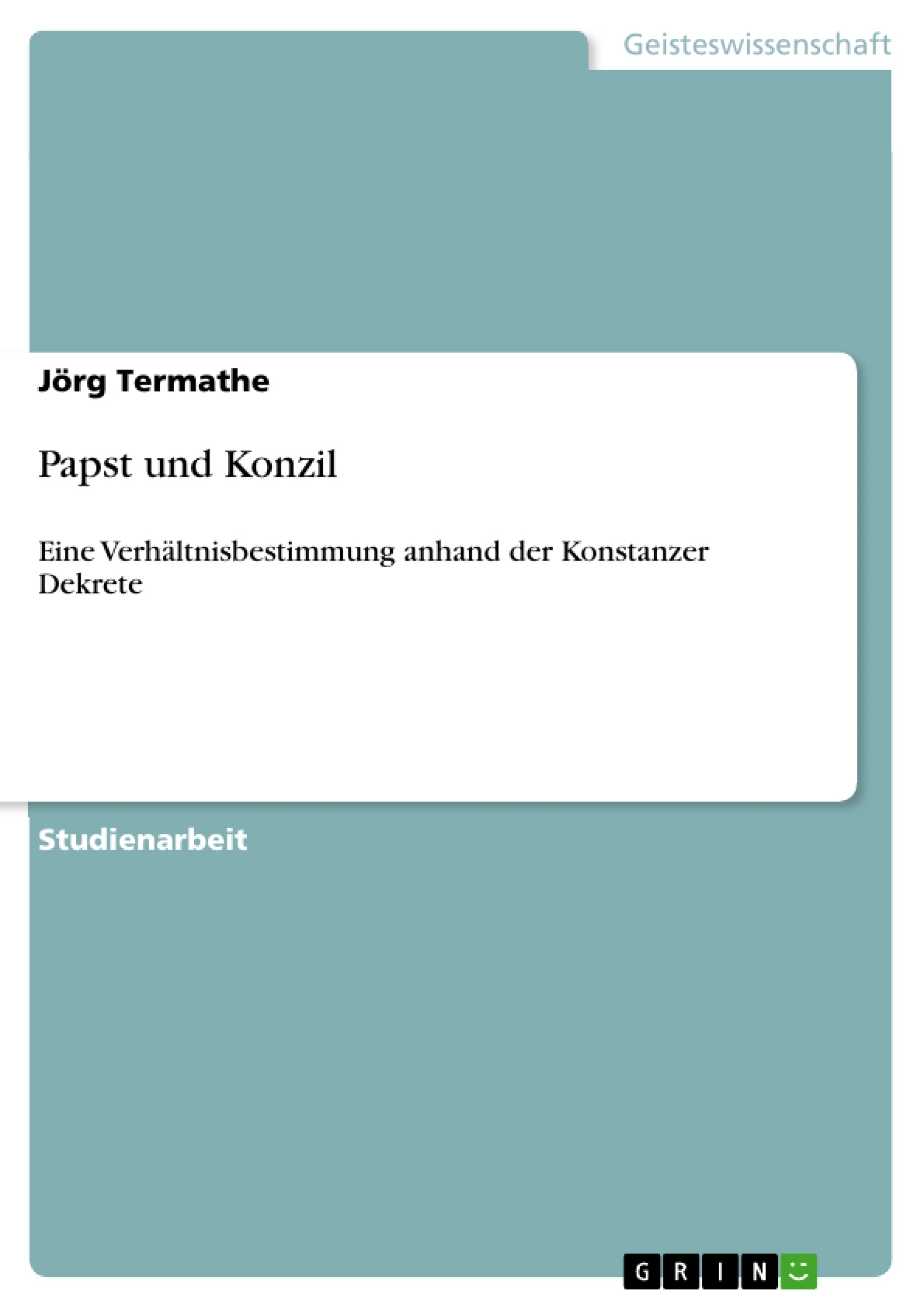Der päpstliche Primat hat bis zu seiner feierlichen Definition auf dem I.Vatikanum in der römisch-katholischen Kirche eine lange Tradition. Bereits Papst DamasusI. (ca. 305-384) interpretierte die Verheißung Jesu „Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“ (Mt 16,18) juristisch und begründete hiermit eine Monopolstellung für den Patriarchen des Abendlandes, den Bischof von Rom.
Dennoch gab es in der Kirchengeschichte auch Zeiten, in denen dieser Primat umstritten war. Besonders während des sogenannten saeculum obscurum wagte niemand, einen solchen Anspruch für den Papst zu formulieren. Auch in der spätere Kirchengeschichte blieb das Papsttum keineswegs von der Immoralität des Klerus der jeweiligen Zeit nicht verschont.
Vor diesem Hintergrund ist auch die Entwicklung der konziliaren Idee zu verstehen, in der dem Konzil ein Vorrang vor dem Papst eingeräumt wurde. Seinen greifbarsten Niederschlag in der kirchlichen Lehre hat diese Theorie wohl in den Dokumenten des ökumenischen Konzils von Konstanz in den Dekreten «Haec Sancta» und «Frequens» , welche aufgrund ihrer Bedeutung allein mit dem Begriff „Konstanzer Dekrete“ bezeichnet werden, gefunden.
Gegenstand dieser Arbeit soll es daher sein auf Grundlage dieser Dokumente zu untersuchen, welche ekklesiologische Vorstellung des Verhältnisse zwischen Konzil und Papst in den Konstanzer Dekreten zum Ausdruck kommt. Hierzu soll zuerst ein Überblick über die damalige kirchliche Situation, damalige Reformbemühungen sowie über die Entstehungsgeschichte der Konstanzer Dekrete gegeben werden.
Darauf folgt deren Analyse.
Hierbei soll das Dekret «Haec Sancta» im Vordergrund der Interpretation stehen, da hierin eine Superioritätsvorstellungen des Konzils über den Papst am deutlichsten zur Sprache zu kommen scheint und ihm in der Diskussion über den Konziliarismus stets die größere Bedeutung zugemessen worden ist. Abschließend werde ich kurz drauf eingehen, welche Einsichten aus dem Konziliarismus von Konstanz für die heutige Ekklesiologie gezogen werden könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Hintergrund
- Das Konzil von Konstanz
- Der Konziliarismus
- Die spätmittelalterliche Reformbewegung
- Die Entstehung der Dekrete «Haec Sancta» und «Frequens»
- Quellenanalyse
- Das Dekret «Haec Sancta»
- Die Frage nach der formalen Verbindlichkeit
- Der Inhalt
- Das Dekret «Frequens»
- Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ekklesiologische Vorstellung des Verhältnisses zwischen Konzil und Papst, wie sie in den Konstanzer Dekreten zum Ausdruck kommt. Die Analyse konzentriert sich auf die damalige kirchliche Situation, die Reformbemühungen und die Entstehungsgeschichte der Dekrete. Im Mittelpunkt steht das Dekret „Haec Sancta“, da hier die Überlegenheit des Konzils über den Papst besonders deutlich wird.
- Das Große Abendländische Schisma und seine Auswirkungen
- Die konziliare Idee und ihre Bedeutung im Spätmittelalter
- Analyse der Konstanzer Dekrete „Haec Sancta“ und „Frequens“
- Die ekklesiologische Position der Konstanzer Dekrete
- Relevanz des Konziliarismus für die heutige Ekklesiologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des päpstlichen Primats ein und erläutert dessen lange Tradition in der römisch-katholischen Kirche. Sie hebt jedoch auch die umstrittenen Phasen in der Kirchengeschichte hervor und erwähnt das sogenannte saeculum obscurum sowie die spätere Entwicklung der konziliaren Idee, in der dem Konzil ein Vorrang vor dem Papst eingeräumt wurde. Die Konstanzer Dekrete „Haec Sancta“ und „Frequens“ werden als zentrale Dokumente dieser Auseinandersetzung vorgestellt, und die Arbeit kündigt an, deren ekklesiologische Vorstellung des Verhältnisses zwischen Konzil und Papst zu untersuchen.
Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Konstanzer Dekrete, beginnend mit dem Großen Abendländischen Schisma (1378-1417). Es beleuchtet die Wahl von Papst Urban VI. und die anschließende Spaltung der Kirche in zwei, später drei, konkurrierende Papstlinien. Das Kapitel beschreibt die Schwierigkeiten, die aus dieser Situation resultierten, wie die Unsicherheit der Gläubigen über die Zugehörigkeit zur "authentischen" Kirche und die Bemühungen um eine Lösung des Schismas. Die politischen und sozialen Faktoren, die zum Schisma beitrugen, werden ebenfalls erörtert, darunter die finanziellen Interessen des Avignoneser Papsttums und die spätmittelalterliche Armutsbewegung. Der Autor legt dar, wie diese Entwicklungen den Boden für die konziliare Bewegung und die Entstehung der Konstanzer Dekrete bereiteten.
Schlüsselwörter
Päpstlicher Primat, Konziliarismus, Konzil von Konstanz, Dekrete „Haec Sancta“ und „Frequens“, Abendländisches Schisma, ekklesiologische Vorstellung, Reformbewegung, Spätmittelalter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu den Konstanzer Dekreten "Haec Sancta" und "Frequens"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ekklesiologische Vorstellung des Verhältnisses zwischen Konzil und Papst, wie sie in den Konstanzer Dekreten "Haec Sancta" und "Frequens" zum Ausdruck kommt. Der Fokus liegt auf der damaligen kirchlichen Situation, den Reformbemühungen und der Entstehungsgeschichte der Dekrete, insbesondere des Dekrets "Haec Sancta", welches die Überlegenheit des Konzils über den Papst betont.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Große Abendländische Schisma und seine Auswirkungen, die konziliare Idee im Spätmittelalter, eine detaillierte Analyse der Konstanzer Dekrete "Haec Sancta" und "Frequens", die ekklesiologische Position dieser Dekrete und deren Relevanz für die heutige Ekklesiologie. Der historische Kontext, inklusive des Konzils von Konstanz, des Konziliarismus und der spätmittelalterlichen Reformbewegung, wird ausführlich beleuchtet.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Hauptquellen der Arbeit sind die Konstanzer Dekrete "Haec Sancta" und "Frequens". Die Analyse umfasst die Untersuchung der formalen Verbindlichkeit und des Inhalts beider Dekrete. Die Arbeit betrachtet auch den historischen Kontext, um die Entstehung und Bedeutung der Dekrete besser zu verstehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Abschnitt zum historischen Hintergrund (inklusive des Großen Abendländischen Schismas, des Konzils von Konstanz und der konziliaren Bewegung), eine Quellenanalyse der Dekrete "Haec Sancta" und "Frequens", und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik des päpstlichen Primats und der konziliaren Idee ein. Der historische Hintergrund erläutert die Entstehung der Dekrete. Die Quellenanalyse untersucht den Inhalt und die Bedeutung der Dekrete. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Päpstlicher Primat, Konziliarismus, Konzil von Konstanz, Dekrete „Haec Sancta“ und „Frequens“, Abendländisches Schisma, ekklesiologische Vorstellung, Reformbewegung, Spätmittelalter.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die ekklesiologische Position der Konstanzer Dekrete zu untersuchen und deren Verhältnis von Konzil und Papst zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung dieser Dekrete im Kontext der damaligen kirchlichen und politischen Situation.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der Kirchengeschichte, der Theologie und der Geschichte des Mittelalters. Sie bietet eine fundierte Analyse der Konstanzer Dekrete und deren Bedeutung für das Verständnis des Verhältnisses zwischen Papst und Konzil.
- Quote paper
- Jörg Termathe (Author), 2010, Papst und Konzil, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156052