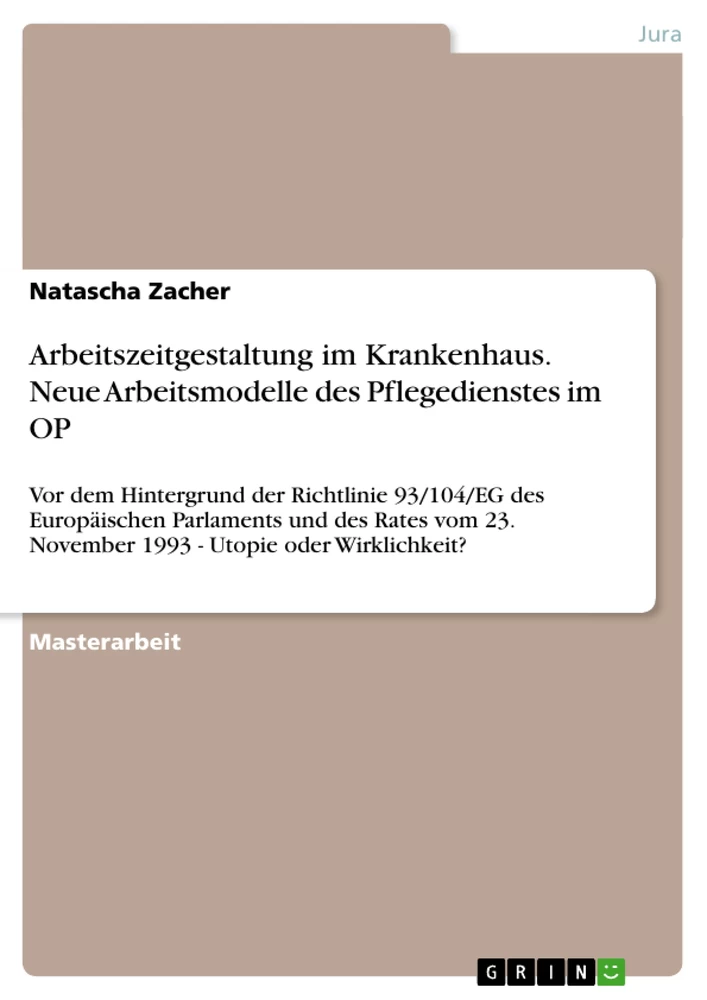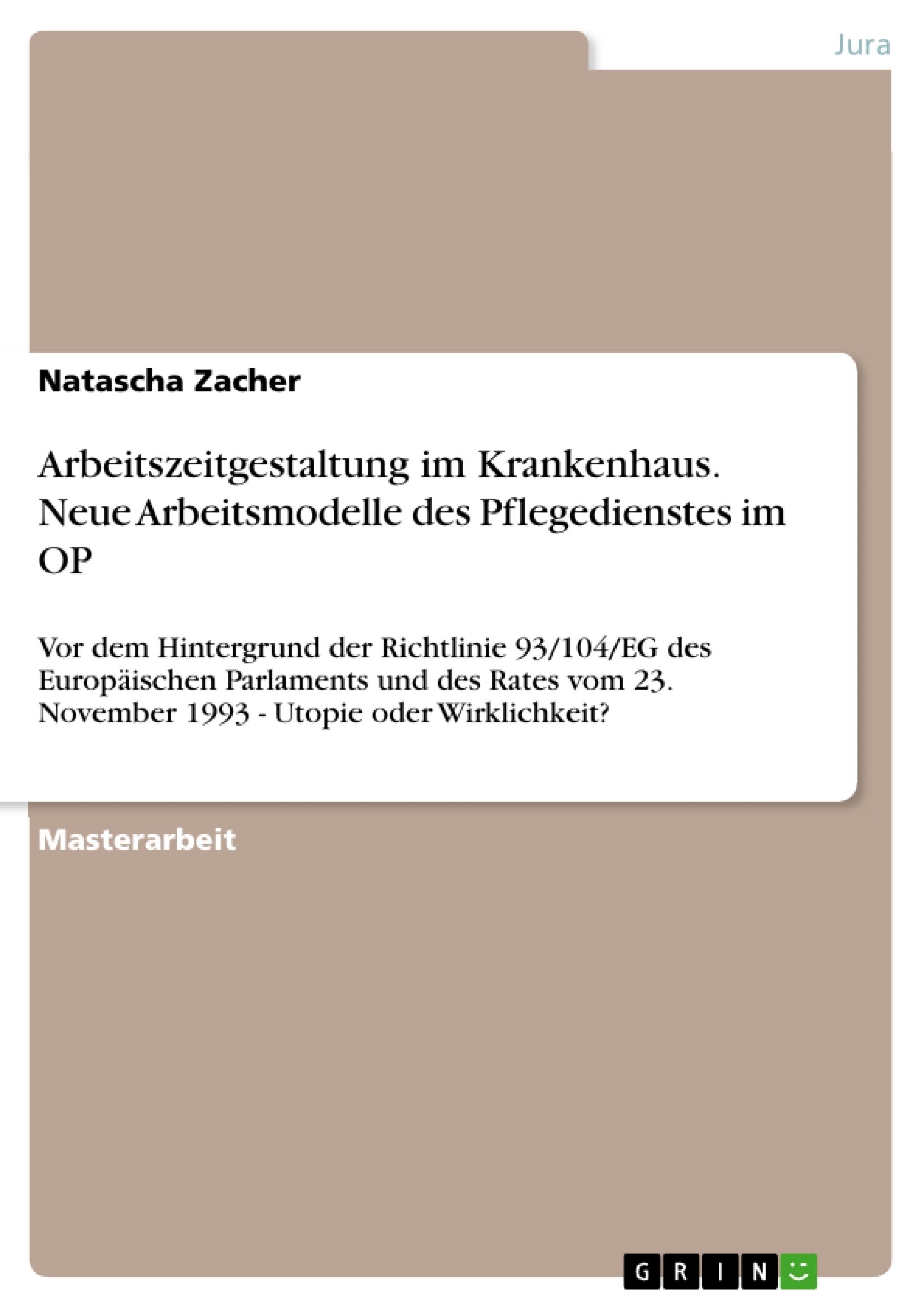Die langen Bereitschaftsdienste des OP-Pflegepersonals in den Krankenhäusern sind seit Oktober 2000 nicht mehr rechtskonform. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bewertet in seinem Urteil vom 3.10.2000 in der Rechtssache SIMAP (C-303/98) die Bereitschaftszeit als Arbeitszeit. Nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz in der geltenden Fassung bis zum 31.12.2003 gehörte der Bereitschaftsdienst zur Ruhezeit. Nur die Zeiten der Inanspruchnahme während des Dienstes wurden als Arbeitszeit bewertet. Mit der Rechtssprechung im Fall Jäger (C-151/02) vom 9.9.2003 stellte der EuGH fest, dass die Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG in Deutschland in unterschiedlichen Punkten keine korrekte Umsetzung fand. Zudem kommt eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, nach der der Bereitschaftsdienst auch dann als Arbeitszeit zu bewerten ist, wenn es dem Arbeitnehmer erlaubt ist, während des Dienstes zu schlafen.
In der deutschen Gesetzgebung wurden die Normen durch das Arbeits-zeitgesetz, Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (ArbZG), implementiert. Die Änderungen sind am 1.1.2004 in Kraft getreten. Das Ziel der Gesetzgebung war, u.a. den Schutz und die Sicherheit des Arbeitnehmers bei der Arbeitsgestaltung sicherzustellen. Trotz der Verlängerung der Übergangsfrist für die Krankenhäuser bis zum Jahre 2007, die eine problemlose Umsetzung des neuen ArbZG ermöglichen sollte, fand das neue Gesetz nur in einigen Krankenhäusern den Einsatz.
Auf Grundlage des novellierten Arbeitszeitgesetzes wurde das Tarifrecht im öffentlichen Dienst den neuen Bedürfnissen sowohl arbeitnehmer- als auch arbeitgeberseitig angepasst.
Notwendige Folge daraus ist die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle in den Krankenhäusern.
Die Krankenhäuser stehen damit vor großen Herausforderungen: Neue Arbeitszeitmodelle, die den aktuellen arbeitsrechtlichen Bedingungen standhalten, müssen entwickelt und implementiert werden. Dabei gilt es nicht nur die aktuelle Gesetzgebung, sondern auch die Interessen und die Bedürfnisse der Mitarbeiter, der Patienten und des Krankenhauses als Unternehmen zu berücksichtigen. Insbesondere ist eine enge Verbindung zwischen der Wertevorstellung und ökonomisches Denken zu schaffen: Oberste Prämisse ist die Ermöglichung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung.
Vor diesem Hintergrund ist es von besonderer Relevanz sich mit der Arbeitszeitgestaltung im Krankenhaus zu beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung der Masterthesis
- Arbeitsrechtlicher Hintergrund
- Verordnung über die Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten
- Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG vom 23.11.1993
- Gesetz zur Vereinheitlichung und Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts
- Die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs
- Rechtssache SIMAP (C-303/98) des EuGH
- Rechtssache Jäger (C-151/02) des EuGH
- Rechtssache Pfeiffer (C-397/01-C-403/01) des EuGH
- Arbeitszeitrichtlinien 2000/34/EG und 2003/88/EG
- Aktualisierung der Arbeitszeitrichtlinie (KOM(2005) 246 endg.)
- Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt
- Definition der Arbeitszeit
- Abgrenzung Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
- Abgrenzung Ruhezeiten und Ruhepausen
- Begriff der Ruhezeit (§5 Abs. 1 ArbZG)
- Gewährung und Lage der Ruhezeit (§5 Abs. 1 ArbZG)
- Verkürzung der Ruhezeit auf 10 Stunden (§5 Abs. 2 ArbZG)
- Verkürzung der Ruhezeit auf 9 Stunden (§7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG)
- Verkürzungen der Ruhezeit bei Rufbereitschaft (§5 Abs. 3 ArbZG)
- Ruhezeit nach verlängerten Arbeitszeit (§7 Abs. 9 ArbZG)
- Gewährung von Ruhepausen (§4 ArbZG)
- Nacht- und Schichtarbeit
- Nachtarbeit, Nachtarbeitnehmer und Wechselschicht (§2 ArbZG)
- Nacht- und Schichtarbeit (§ 6 ArbZG)
- Werktägliche Arbeitszeit
- Gesetzliche Regelarbeitszeit (§3 ArbZG)
- Kollektivvertragliche Verlängerung mit Zeitausgleich (§7 Abs. 1, 2 ArbZG)
- Kollektivvertragliche Verlängerung ohne Zeitausgleich (§7 Abs. 2a ArbZG)
- Übernahme tariflicher Regelungen (§7 Abs. 3 ArbZG)
- Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz in Notfällen (§14 ArbZG)
- Tarifliche Arbeitszeitregelungen im Krankenhausbereich
- Tarifpluralität seit 2006
- Krankenhaus-Tarifverträge
- Arbeitszeitgestaltung in TVÖD-K und TV-L für nicht ärztliches Personal
- Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (§6 TVÖD-K und TV-L)
- Erweiterung durch Bereitschafts- und Rufbereitschaftsdienste (§7.1 TVÖD-K)
- Arbeitszeitkorridor und tägliche Rahmenzeit (§§6 und 10 TVÖD-K)
- Arbeitskonto (§ 10 TVÖD-K)
- Unternehmen Krankenhaus
- Organisatorische Rahmenbedingungen
- Der Krankenhausbegriff gemäß §2 Nr. 1 KHG und §107 Abs. 1 SGB V
- Berufsbild der Pflege im OP
- Neue Arbeitszeitmodelle
- Traditionelles Arbeitszeitmodell im OP
- Mögliche zukünftige Arbeitszeitmodelle
- Spätdienstmodell mit Rufbereitschaft
- 3-Schicht-Modell
- Ein Beispiel aus der Praxis
- Der Weg zum neuen Arbeitszeitmodell
- Veränderte Anforderungen an das Management
- Interessen zusammenführen
- Widerstand gegen die Veränderungen
- Abbau von Vorbehalten
- Schlüsselfaktoren erfolgreichen Vorgehens
- Interventionstechniken
- Wertewandel und Werteorientierung
- Einführungsstrategie eines neuen Arbeitszeitmodells
- Planung
- Bildung einer Projektgruppe
- Projektplan
- Analyse der Rahmenbedingungen
- Ausarbeitung und Testphase
- Realisierung und Abschluss einer Dienst-/Betriebsvereinbarung
- Veränderte Anforderungen an das Management
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterthesis untersucht die Gestaltung von Arbeitszeitmodellen im Krankenhauspflegedienst, insbesondere im OP-Bereich, vor dem Hintergrund der EU-Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG. Ziel ist es, rechtkonforme und praktikable Alternativen zum traditionellen Modell aufzuzeigen und den Einführungsprozess neuer Modelle im Krankenhausmanagement zu beleuchten.
- Analyse des bestehenden arbeitsrechtlichen Rahmens (inkl. Rechtsprechung des EuGH)
- Bewertung der geltenden Tarifverträge im Krankenhausbereich
- Vorstellung alternativer Arbeitszeitmodelle für den OP-Bereich
- Beschreibung der Herausforderungen bei der Implementierung neuer Modelle
- Entwicklung einer Strategie zur erfolgreichen Einführung neuer Arbeitszeitmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problemstellung der traditionellen Arbeitszeitmodelle im OP und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Entwicklung von rechtssicheren und praktikablen Alternativen. Es wird die Relevanz des Themas für das Krankenhausmanagement betont.
Arbeitsrechtlicher Hintergrund: Dieses Kapitel analysiert umfassend die rechtlichen Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung im Gesundheitswesen. Es werden die EU-Richtlinie 93/104/EG, das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sowie relevante Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) detailliert untersucht. Die Bedeutung von Ruhezeiten, Ruhepausen und der Abgrenzung von Bereitschafts- und Rufbereitschaft wird hervorgehoben. Die Kapitel erläutert zudem die Relevanz von Tarifverträgen und deren Bedeutung für die Arbeitszeitgestaltung.
Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit, insbesondere mit den Bestimmungen des ArbZG. Es werden die Definition der Arbeitszeit, die Abgrenzung von Ruhezeiten und Ruhepausen, sowie die Regelungen zur Nacht- und Schichtarbeit präzise erläutert. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten und Grenzen der gesetzlichen Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Ausführungen verdeutlichen die Bedeutung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für die Gestaltung von Arbeitszeitmodellen.
Tarifliche Arbeitszeitregelungen im Krankenhausbereich: Dieses Kapitel beleuchtet die tarifvertraglichen Regelungen zur Arbeitszeit im Krankenhausbereich. Die Bedeutung der Tarifpluralität seit 2006 wird diskutiert und die relevanten Tarifverträge (TVÖD-K und TV-L) werden im Detail analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf den Regelungen zur wöchentlichen Arbeitszeit, Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaft sowie auf den Möglichkeiten des Arbeitszeitkontos. Die Interaktion zwischen gesetzlichen und tariflichen Regelungen wird explizit untersucht.
Unternehmen Krankenhaus: Dieses Kapitel beschreibt die organisatorischen Rahmenbedingungen im Krankenhaus und das Berufsbild der Pflege im OP. Es beleuchtet die Besonderheiten des OP-Bereichs und dessen Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitszeit. Es werden die spezifischen Herausforderungen der Arbeitszeitplanung im OP-Bereich hervorgehoben, die eine Berücksichtigung in den neuen Modellen erfordern.
Neue Arbeitszeitmodelle: Dieses Kapitel stellt verschiedene neue Arbeitszeitmodelle für den OP-Bereich vor. Es wird das traditionelle Modell mit seinen Nachteilen gegenübergestellt und alternative Modelle, wie z.B. ein Spätdienstmodell mit Rufbereitschaft und ein 3-Schicht-Modell, detailliert beschrieben und analysiert. Ein Praxisbeispiel veranschaulicht die Umsetzung eines alternativen Modells. Die Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle und deren Vereinbarkeit mit den gesetzlichen und tariflichen Vorgaben.
Der Weg zum neuen Arbeitszeitmodell: Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen und Strategien für die erfolgreiche Einführung neuer Arbeitszeitmodelle. Es werden die notwendigen Veränderungen im Management, der Umgang mit Widerständen und der Aufbau von Akzeptanz thematisiert. Es wird eine detaillierte Einführungsstrategie vorgestellt, die die Planung, die Bildung einer Projektgruppe, die Analyse der Rahmenbedingungen, die Ausarbeitung und Testphase sowie den Abschluss einer Dienst-/Betriebsvereinbarung umfasst.
Schlüsselwörter
Arbeitszeitgestaltung, Krankenhaus, Pflegedienst, OP-Bereich, Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG, Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Tarifverträge (TVÖD-K, TV-L), Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst, Schichtarbeit, Rechtssprechung EuGH, Personalmanagement, Einführung neuer Arbeitszeitmodelle, Management, Widerstand, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterthesis: Arbeitszeitmodelle im Krankenhauspflegedienst
Was ist der Gegenstand dieser Masterthesis?
Die Masterthesis untersucht die Gestaltung von Arbeitszeitmodellen im Krankenhauspflegedienst, insbesondere im OP-Bereich. Im Fokus steht die Entwicklung rechtssicherer und praktikabler Alternativen zum traditionellen Modell und die Beleuchtung des Einführungsprozesses neuer Modelle im Krankenhausmanagement vor dem Hintergrund der EU-Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse des bestehenden arbeitsrechtlichen Rahmens (inkl. Rechtsprechung des EuGH), die Bewertung geltender Tarifverträge im Krankenhausbereich, die Vorstellung alternativer Arbeitszeitmodelle für den OP-Bereich, die Beschreibung der Herausforderungen bei der Implementierung neuer Modelle und die Entwicklung einer Strategie zur erfolgreichen Einführung neuer Arbeitszeitmodelle.
Welche Rechtsgrundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert umfassend die EU-Richtlinie 93/104/EG, das Arbeitszeitgesetz (ArbZG), relevante Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die Bedeutung von Ruhezeiten, Ruhepausen und die Abgrenzung von Bereitschafts- und Rufbereitschaft. Die Relevanz von Tarifverträgen (TVÖD-K und TV-L) für die Arbeitszeitgestaltung wird ebenfalls untersucht.
Welche Tarifverträge werden untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert die relevanten Tarifverträge im Krankenhausbereich, insbesondere den TVÖD-K und TV-L. Besonderes Augenmerk liegt auf den Regelungen zur wöchentlichen Arbeitszeit, Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaft sowie auf den Möglichkeiten des Arbeitszeitkontos. Die Interaktion zwischen gesetzlichen und tariflichen Regelungen wird explizit untersucht.
Welche alternativen Arbeitszeitmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene neue Arbeitszeitmodelle für den OP-Bereich vor, darunter ein Spätdienstmodell mit Rufbereitschaft und ein 3-Schicht-Modell. Das traditionelle Modell wird mit seinen Nachteilen gegenübergestellt. Ein Praxisbeispiel veranschaulicht die Umsetzung eines alternativen Modells. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle und deren Vereinbarkeit mit den gesetzlichen und tariflichen Vorgaben werden analysiert.
Welche Herausforderungen bei der Implementierung neuer Modelle werden beschrieben?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen und Strategien für die erfolgreiche Einführung neuer Arbeitszeitmodelle. Dies beinhaltet notwendige Veränderungen im Management, den Umgang mit Widerständen und den Aufbau von Akzeptanz. Es wird eine detaillierte Einführungsstrategie vorgestellt, die Planung, die Bildung einer Projektgruppe, die Analyse der Rahmenbedingungen, die Ausarbeitung und Testphase sowie den Abschluss einer Dienst-/Betriebsvereinbarung umfasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitszeitgestaltung, Krankenhaus, Pflegedienst, OP-Bereich, Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG, Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Tarifverträge (TVÖD-K, TV-L), Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst, Schichtarbeit, Rechtssprechung EuGH, Personalmanagement, Einführung neuer Arbeitszeitmodelle, Management, Widerstand, Akzeptanz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Vorwort, eine Einleitung mit Problemstellung und Zielsetzung, ein Kapitel zum arbeitsrechtlichen Hintergrund, ein Kapitel zu Reformen am Arbeitsmarkt, ein Kapitel zu tariflichen Arbeitszeitregelungen im Krankenhausbereich, ein Kapitel zum Unternehmen Krankenhaus, ein Kapitel zu neuen Arbeitszeitmodellen und ein Kapitel zum Weg zum neuen Arbeitszeitmodell. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Natascha Zacher (Author), 2009, Arbeitszeitgestaltung im Krankenhaus. Neue Arbeitsmodelle des Pflegedienstes im OP, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155637