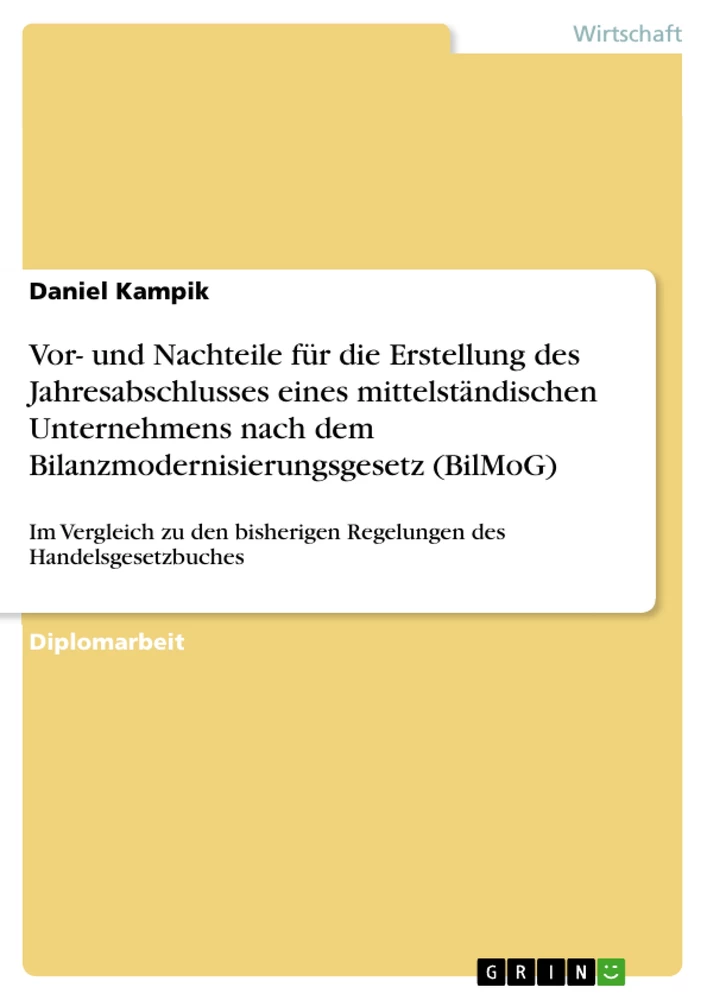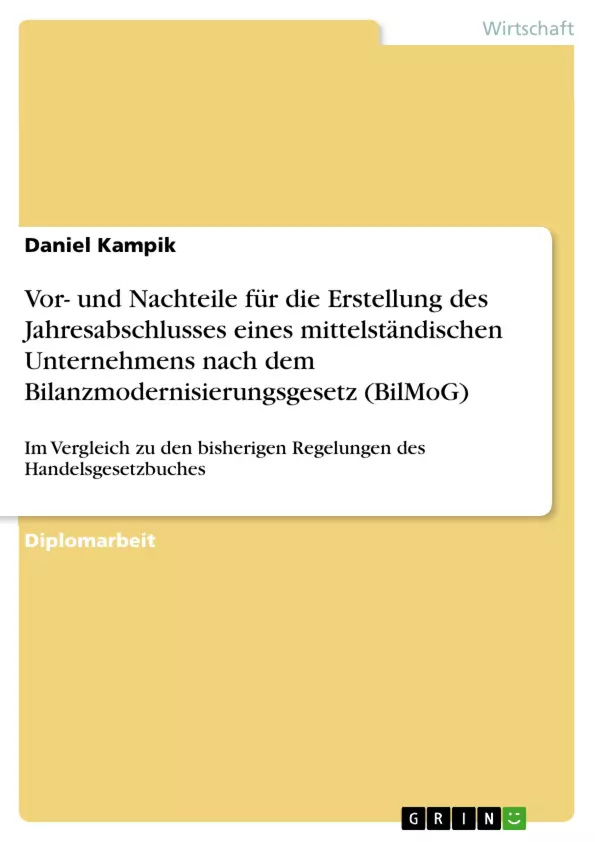Bedingt durch die Globalisierung ist eine Vielzahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht mehr ausschließlich auf dem heimischen Markt tätig. Sie agieren ebenfalls auf den internationalen Märkten und weiten ihre Bemühungen, auch global gut aufgestellt zu sein, weiter aus.1 Um auf diesen Märkten tätig zu sein, bedarf es hoher Investitionen und folglich ist eine hohe Menge an Kapital erforderlich. Um die hierfür benötigen Investoren zu gewinnen, ist es unabdingbar, eine Rechnungslegung zu betreiben, die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet und zugleich möglichst viele Informationen für die externen Bilanzadressaten, vor allem potenzielle Investoren, bietet. Der Gesetzgeber reagierte auf die veränderten Anforderungen mit einem weitestgehend modifizierten Gesetzeswerk. Mit der Verabschiedung des Bilanz-modernisierungsgesetzes2 (BilMoG) durch den Bundesrat am 03.04.2009 und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 28.05.2009 ist die tiefgreifendste Änderung der deutschen Bilanzregeln seit mehr als zwanzig Jahren in Kraft getreten. Das BilMoG wird die deutsche Bilanzierungslandschaft grundlegend verändern und hat nach dem Bilanzrichtliniengesetz zu den meisten und wichtigsten Änderungen geführt.3 Kaum ein wesentlicher Paragraph des Dritten Buches des HGB ("Handelsbücher") ist von der Reform ausgenommen. So sprachen Teile der Fachliteratur bereits nach Veröffentlichung des Referentenentwurfes4 Ende 2007 und auch nach Veröffentlichung des Regierungsentwurfes5 Mitte 2008 von einem Paradigmenwechsel und der Neuinterpretation der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).6
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Erkenntnisziel und Gang der Untersuchung
- Abgrenzung zentraler Begriffe
- Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMOG)
- Mittelständische Unternehmen in Deutschland (KMU)
- Übergreifende Neuregelungen
- Befreiung von der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht
- Anhebung der Schwellenwerte
- Umgekehrte Maßgeblichkeit
- Wesentliche Änderungen der Rechnungslegung im Einzelabschluss durch das BilMOG
- Änderungen mit übergreifender Bedeutung
- Wirtschaftliche Zurechnung
- Stetigkeitsgrundsatz
- Herstellungskosten
- Außerplanmäßige Abschreibungen und Wertaufholung
- Bewertungseinheiten
- Währungsumrechnung
- Änderungen der Bilanzierung (Ansatz und Bewertung) einzelner Vermögensgegenstände und Schulden
- Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des AV
- Latente Steuern
- Rückstellungen
- Sonstige Rückstellungen
- Pensionsrückstellungen
- Eigenkapital
- Ergebnisse aus der Sicht des Mittelstands
- Pro BilMoG im Einzelabschluss
- Contra BilMoG im Einzelabschluss
- Merkmale der Rechnungslegung mittelständischer Unternehmen in Deutschland
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Vor- und Nachteile des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) für die Erstellung des Jahresabschlusses mittelständischer Unternehmen im Vergleich zu den bisherigen Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB). Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen des BilMoG auf die Praxis der Jahresabschlusserstellung im Mittelstand zu geben.
- Auswirkungen des BilMoG auf die Buchführungs- und Bilanzierungspflicht mittelständischer Unternehmen
- Analyse der wesentlichen Änderungen in der Rechnungslegung nach BilMoG
- Bewertung der Vor- und Nachteile des BilMoG aus der Perspektive des Mittelstands
- Vergleich der Bilanzierung nach HGB und BilMoG
- Diskussion der Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und den Informationsgehalt von Jahresabschlüssen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit dar. Es wird erläutert, warum die Auswirkungen des BilMoG auf mittelständische Unternehmen einer genaueren Untersuchung bedürfen und welches Erkenntnisziel mit dieser Arbeit verfolgt wird. Die zentralen Begriffe wie BilMoG und KMU werden abgegrenzt und definiert, um eine einheitliche Terminologie zu gewährleisten und Missverständnisse zu vermeiden. Der Gang der Untersuchung wird skizziert, um dem Leser den Aufbau und die Struktur der Arbeit transparent zu machen.
Übergreifende Neuregelungen: Dieses Kapitel behandelt die übergreifenden Neuregelungen des BilMoG, welche mittelständische Unternehmen betreffen. Es werden die Befreiung von der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht, die Anhebung der Schwellenwerte und die umgekehrte Maßgeblichkeit detailliert erläutert und ihre Auswirkungen auf den administrativen Aufwand und die Transparenz für mittelständische Unternehmen analysiert. Die jeweiligen Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen werden im Detail untersucht und gegeneinander abgewogen.
Wesentliche Änderungen der Rechnungslegung im Einzelabschluss durch das BilMoG: Dieses Kapitel analysiert die wesentlichen Änderungen der Rechnungslegung im Einzelabschluss, die das BilMoG mit sich gebracht hat. Es werden sowohl Änderungen mit übergreifender Bedeutung (z.B. wirtschaftliche Zurechnung, Stetigkeitsgrundsatz, Herstellungskosten, außerplanmäßige Abschreibungen und Wertaufholung, Bewertungseinheiten, Währungsumrechnung) als auch Änderungen der Bilanzierung einzelner Vermögensgegenstände und Schulden (z.B. selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände, latente Steuern, Rückstellungen, Eigenkapital) im Detail erläutert und deren Implikationen für mittelständische Unternehmen diskutiert. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung der neuen Regelungen und den damit verbundenen Herausforderungen.
Ergebnisse aus der Sicht des Mittelstands: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung aus der Perspektive des Mittelstands. Es werden sowohl die Vorteile (z.B. Deregulierung, Informationswert, Vergleichbarkeit, Harmonisierung des internen/externen Rechnungswesens, realistische Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, besseres Gesamtrating, Verbesserung der Wettbewerbsposition) als auch die Nachteile (z.B. Abkehr von der Einheitsbilanz, Abkehr vom Vorsichtsprinzip, Komplexität, Wahlrechte und Ermessensspielräume) des BilMoG für mittelständische Unternehmen gegenübergestellt und eingehend analysiert. Es werden konkrete Beispiele und Fallstudien herangezogen, um die Argumentation zu untermauern.
Schlüsselwörter
Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), Handelsgesetzbuch (HGB), Mittelständische Unternehmen (KMU), Jahresabschluss, Rechnungslegung, Einzelabschluss, Bewertung, Wirtschaftliche Zurechnung, Stetigkeitsgrundsatz, Herstellungskosten, Rückstellungen, Eigenkapital, Deregulierung, Informationswert, Vergleichbarkeit, Komplexität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Auswirkungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) auf mittelständische Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) auf die Jahresabschlusserstellung mittelständischer Unternehmen (KMU) in Deutschland. Sie vergleicht die neuen Regelungen mit den vorherigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und analysiert Vor- und Nachteile für den Mittelstand.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt übergreifende Neuregelungen des BilMoG wie die Befreiung von der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht und die Anhebung der Schwellenwerte. Sie analysiert detailliert die wesentlichen Änderungen der Rechnungslegung im Einzelabschluss, einschließlich der wirtschaftlichen Zurechnung, des Stetigkeitsgrundsatzes, der Herstellungskosten und der Bewertung verschiedener Vermögensgegenstände und Schulden (z.B. Rückstellungen, Eigenkapital). Die Arbeit bewertet die Auswirkungen des BilMoG aus der Perspektive des Mittelstands und vergleicht die Bilanzierung nach HGB und BilMoG.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen des BilMoG auf die Praxis der Jahresabschlusserstellung im Mittelstand zu geben. Sie soll die Vor- und Nachteile des BilMoG für KMU aufzeigen und deren Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und den Informationsgehalt von Jahresabschlüssen diskutieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den übergreifenden Neuregelungen des BilMoG, ein Kapitel zu den wesentlichen Änderungen der Rechnungslegung im Einzelabschluss, ein Kapitel zu den Ergebnissen aus der Sicht des Mittelstands und ein Fazit. Die Einleitung definiert zentrale Begriffe wie BilMoG und KMU und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Die Kapitel enthalten detaillierte Analysen und Diskussionen der jeweiligen Themen.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Zentrale Begriffe wie Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), Handelsgesetzbuch (HGB), mittelständische Unternehmen (KMU), Jahresabschluss, Einzelabschluss, wirtschaftliche Zurechnung, Stetigkeitsgrundsatz und Herstellungskosten werden in der Einleitung definiert und präzisiert, um eine einheitliche Terminologie zu gewährleisten.
Welche Vorteile des BilMoG für den Mittelstand werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Vorteile wie Deregulierung, erhöhten Informationswert, verbesserte Vergleichbarkeit, Harmonisierung des internen/externen Rechnungswesens, realistischere Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, ein besseres Gesamtrating und eine verbesserte Wettbewerbsposition.
Welche Nachteile des BilMoG für den Mittelstand werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Nachteile wie die Abkehr von der Einheitsbilanz, die Abkehr vom Vorsichtsprinzip, erhöhte Komplexität, Wahlrechte und Ermessensspielräume.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die jeweils die wichtigsten Punkte und Ergebnisse des jeweiligen Kapitels zusammenfassen und die Argumentation der Arbeit strukturiert darstellen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für mittelständische Unternehmen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Studenten der Wirtschaftswissenschaften und alle, die sich für die Auswirkungen des BilMoG auf die Rechnungslegung interessieren.
Wo finde ich die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), Handelsgesetzbuch (HGB), Mittelständische Unternehmen (KMU), Jahresabschluss, Rechnungslegung, Einzelabschluss, Bewertung, wirtschaftliche Zurechnung, Stetigkeitsgrundsatz, Herstellungskosten, Rückstellungen, Eigenkapital, Deregulierung, Informationswert, Vergleichbarkeit, Komplexität.
- Quote paper
- Daniel Kampik (Author), 2010, Vor- und Nachteile für die Erstellung des Jahresabschlusses eines mittelständischen Unternehmens nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155603