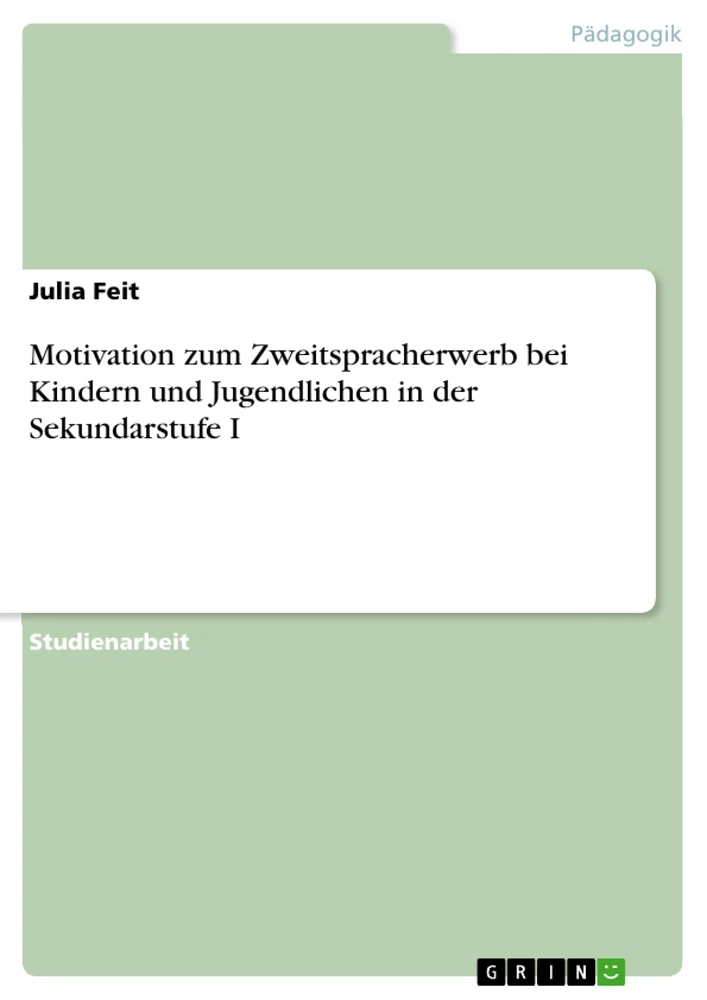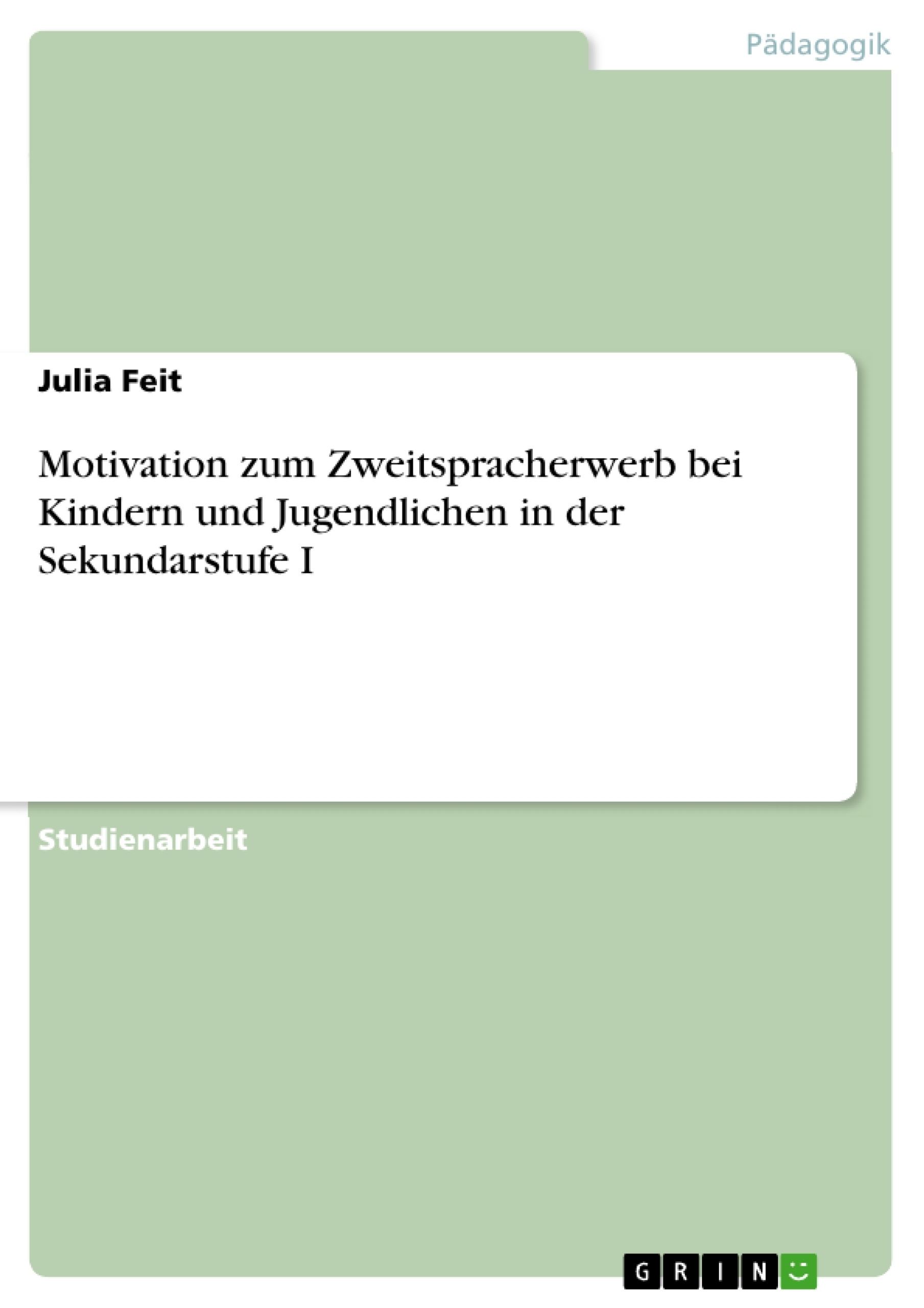Wie kann die Motivation zum Zweitspracherwerb bei SchülerInnen in der Sekundarstufe I gefördert werden? Bei der Zielgruppe handelt es sich um Kinder und Jugendliche im späten/postpubertären Alter. In dieser Lebensphase treten spezifische motivationale Herausforderungen auf, wie das gesteigerte Bewusstsein für soziale Bewertungen und eine stärkere Orientierung an Peer-Gruppen.
Die Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage erfolgt auf zwei Ebenen: der fachtheoretischen und der fachdidaktischen.
Der fachwissenschaftliche Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Motivation im Zweitspracherwerb von Jugendlichen der Sekundarstufe I. Zunächst wird der Begriff „Motivation“ definiert und die Bedeutung verschiedener Motivationsarten dargestellt, um das Verständnis ihrer Rolle im Spracherwerb zu erleichtern. Daraufhin wird die Motivation im Kontext des Zweitspracherwerbs näher betrachtet, wobei zwischen intrinsischer und extrinsischer sowie integrativer und instrumenteller Motivation unterschieden wird. Diese Unterscheidung ist wichtig, um die verschiedenen Anreize zu verstehen, die Lernende zum Spracherwerb motivieren. Im nächsten Abschnitt wird der Unterschied zwischen Zweitspracherwerb und Zweitspracherlernen erläutert. Zudem werden verschiedene Formen des Zweitspracherwerbs und ihre motivationalen Herausforderungen untersucht. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den spezifischen Bedingungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs. Diese theoretischen Grundlagen bieten die Basis für den praktischen Teil der Arbeit, in dem konkrete Ansätze zur Förderung der Motivation im Sprachunterricht aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Fachwissenschaftlicher Teil
- 1. Motivation – Begriffsdefinition
- 1.1. Allgemeine Definition von Motivation
- 1.2. Motivation im Spracherwerb
- 1.2.1. Intrinsische und extrinsische Motivation
- 1.2.2. Integrative und instrumentelle Motivation
- 2. Zweitsprache und Zweitspracherwerb - Begriffsdefinition
- 2.1. Unterschied zwischen Zweitspracherwerb und Zweitspracherlernen
- 2.1.1. Formen des Zweitspracherwerbs und ihre motivationalen Herausforderungen
- 2.2. Besonderheiten des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs
- 2.1. Unterschied zwischen Zweitspracherwerb und Zweitspracherlernen
- 1. Motivation – Begriffsdefinition
- Fachdidaktischer Teil
- 1. Lernende, Lehrende und Lernumgebung im Zweitspracherwerbsunterricht
- 1.1. Lernende im späten/postpubertären Zweitspracherwerb in der Sekundarstufe I
- 1.2. Lehrerbild und Lehrerrolle im motivierenden Zweitspracherwerbsunterricht
- 1.3. Die motivierende Lernumgebung des Regelunterrichts in der Sekundarstufe I
- 2. Anwendung der Motivationsformen im Sprachunterricht
- 2.1. Förderung der intrinsischen Motivation im Unterricht
- 2.2. Förderung der extrinsischen Motivation im Unterricht
- 2.3. Förderung der integrativen Motivation in der Praxis
- 2.4. Förderung der instrumentellen Motivation in der Praxis
- 3. Umsetzung der Selbstbestimmungstheorie im Zweitsprachunterricht
- 3.1. Autonomieförderung im Lernprozess
- 3.2. Kompetenzförderung im Lernprozess
- 3.3. Förderung der sozialen Eingebundenheit
- 1. Lernende, Lehrende und Lernumgebung im Zweitspracherwerbsunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung der Motivation zum Zweitspracherwerb bei Kindern und Jugendlichen der Sekundarstufe I, insbesondere im späten/postpubertären Alter. Das Hauptziel ist die Beantwortung der Forschungsfrage: Wie kann die Motivation zum Zweitspracherwerb bei SchülerInnen in der Sekundarstufe I gefördert werden? Die Arbeit betrachtet sowohl fachwissenschaftliche als auch fachdidaktische Aspekte.
- Definition und Bedeutung von Motivation im Spracherwerb
- Unterscheidung verschiedener Motivationsarten (intrinsisch, extrinsisch, integrativ, instrumental)
- Herausforderungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs
- Konkrete Ansätze zur Motivationsförderung im Sprachunterricht
- Umsetzung der Selbstbestimmungstheorie im Zweitsprachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht die Förderung der Motivation zum Zweitspracherwerb bei Kindern und Jugendlichen in der Sekundarstufe I, insbesondere im Kontext der steigenden Zahl an geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache ist essentiell für den Schulerfolg. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Förderung der Motivation im Zweitspracherwerb und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sowohl fachwissenschaftliche als auch fachdidaktische Aspekte umfasst.
Fachwissenschaftlicher Teil: Dieser Teil beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Motivation im Zweitspracherwerb. Es werden verschiedene Motivationsarten definiert und im Kontext des Spracherwerbs erläutert, mit einem Fokus auf intrinsische und extrinsische sowie integrative und instrumentelle Motivation. Weiterhin werden der Unterschied zwischen Zweitspracherwerb und -lernen sowie die spezifischen Herausforderungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs analysiert. Diese theoretische Basis dient als Fundament für den darauf folgenden fachdidaktischen Teil.
1. Motivation - Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Motivation“ allgemein und im Kontext des Spracherwerbs. Es werden verschiedene Arten der Motivation, wie Leistungsmotivation, und die drei Entstehungsquellen motivationaler Handlungsenergie (physiologische Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse und Emotionen) nach Deci und Ryan (1993) diskutiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit für die Lernmotivation im Spracherwerb.
2. Zweitsprache und Zweitspracherwerb - Begriffsdefinition: Dieses Kapitel erläutert den Unterschied zwischen Zweitspracherwerb und -lernen und untersucht verschiedene Formen des Zweitspracherwerbs (z.B. bilingualer Erstspracherwerb, früher und später Zweitspracherwerb) und ihre jeweiligen motivationalen Herausforderungen. Besonderes Augenmerk liegt auf den spezifischen Bedingungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs, die durch ein gesteigertes Bewusstsein für soziale Bewertungen und die Orientierung an Peer-Gruppen gekennzeichnet sind.
Fachdidaktischer Teil: Der fachdidaktische Teil befasst sich mit der praktischen Anwendung der im fachwissenschaftlichen Teil gewonnenen Erkenntnisse. Es werden konkrete Ansätze zur Förderung der Motivation im Zweitsprachunterricht vorgestellt und didaktische Maßnahmen diskutiert.
Schlüsselwörter
Motivation, Zweitspracherwerb, Sekundarstufe I, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, integrative Motivation, instrumentelle Motivation, später Zweitspracherwerb, Selbstbestimmungstheorie, Lernumgebung, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schülermotivation, sprachliche Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Motivation im Zweitspracherwerb?
Diese Arbeit untersucht die Förderung der Motivation zum Zweitspracherwerb bei Kindern und Jugendlichen der Sekundarstufe I, insbesondere im späten/postpubertären Alter. Ziel ist es, herauszufinden, wie die Motivation von SchülerInnen der Sekundarstufe I beim Erlernen einer Zweitsprache gefördert werden kann. Sie betrachtet sowohl fachwissenschaftliche als auch fachdidaktische Aspekte.
Was sind die wichtigsten Themen, die in dieser Arbeit behandelt werden?
Die Arbeit behandelt folgende Themen:
- Definition und Bedeutung von Motivation im Spracherwerb
- Unterscheidung verschiedener Motivationsarten (intrinsisch, extrinsisch, integrativ, instrumental)
- Herausforderungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs
- Konkrete Ansätze zur Motivationsförderung im Sprachunterricht
- Umsetzung der Selbstbestimmungstheorie im Zweitsprachunterricht
Was ist der Fokus des fachwissenschaftlichen Teils der Arbeit?
Der fachwissenschaftliche Teil beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Motivation im Zweitspracherwerb. Er definiert verschiedene Motivationsarten und erläutert sie im Kontext des Spracherwerbs, mit einem Fokus auf intrinsische und extrinsische sowie integrative und instrumentelle Motivation. Weiterhin werden der Unterschied zwischen Zweitspracherwerb und -lernen sowie die spezifischen Herausforderungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs analysiert.
Was ist der Fokus des fachdidaktischen Teils der Arbeit?
Der fachdidaktische Teil befasst sich mit der praktischen Anwendung der im fachwissenschaftlichen Teil gewonnenen Erkenntnisse. Es werden konkrete Ansätze zur Förderung der Motivation im Zweitsprachunterricht vorgestellt und didaktische Maßnahmen diskutiert.
Welche Motivationsarten werden in der Arbeit unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation sowie integrativer und instrumenteller Motivation.
Was sind die Herausforderungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs?
Der späte/postpubertäre Zweitspracherwerb ist durch ein gesteigertes Bewusstsein für soziale Bewertungen und die Orientierung an Peer-Gruppen gekennzeichnet. Dies kann die Motivation beeinflussen.
Was sind die Schlüsselwörter dieser Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Motivation, Zweitspracherwerb, Sekundarstufe I, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, integrative Motivation, instrumentelle Motivation, später Zweitspracherwerb, Selbstbestimmungstheorie, Lernumgebung, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schülermotivation, sprachliche Kompetenz.
Wie wird die Selbstbestimmungstheorie im Zweitsprachunterricht umgesetzt?
Die Umsetzung der Selbstbestimmungstheorie erfolgt durch Autonomieförderung im Lernprozess, Kompetenzförderung im Lernprozess und Förderung der sozialen Eingebundenheit.
Was wird im Kapitel "Motivation - Begriffsdefinition" diskutiert?
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Motivation“ allgemein und im Kontext des Spracherwerbs. Es werden verschiedene Arten der Motivation, wie Leistungsmotivation, und die drei Entstehungsquellen motivationaler Handlungsenergie (physiologische Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse und Emotionen) nach Deci und Ryan (1993) diskutiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit für die Lernmotivation im Spracherwerb.
Was wird im Kapitel "Zweitsprache und Zweitspracherwerb - Begriffsdefinition" erläutert?
Dieses Kapitel erläutert den Unterschied zwischen Zweitspracherwerb und -lernen und untersucht verschiedene Formen des Zweitspracherwerbs (z.B. bilingualer Erstspracherwerb, früher und später Zweitspracherwerb) und ihre jeweiligen motivationalen Herausforderungen. Besonderes Augenmerk liegt auf den spezifischen Bedingungen des späten/postpubertären Zweitspracherwerbs, die durch ein gesteigertes Bewusstsein für soziale Bewertungen und die Orientierung an Peer-Gruppen gekennzeichnet sind.
- Quote paper
- Julia Feit (Author), 2024, Motivation zum Zweitspracherwerb bei Kindern und Jugendlichen in der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1555601