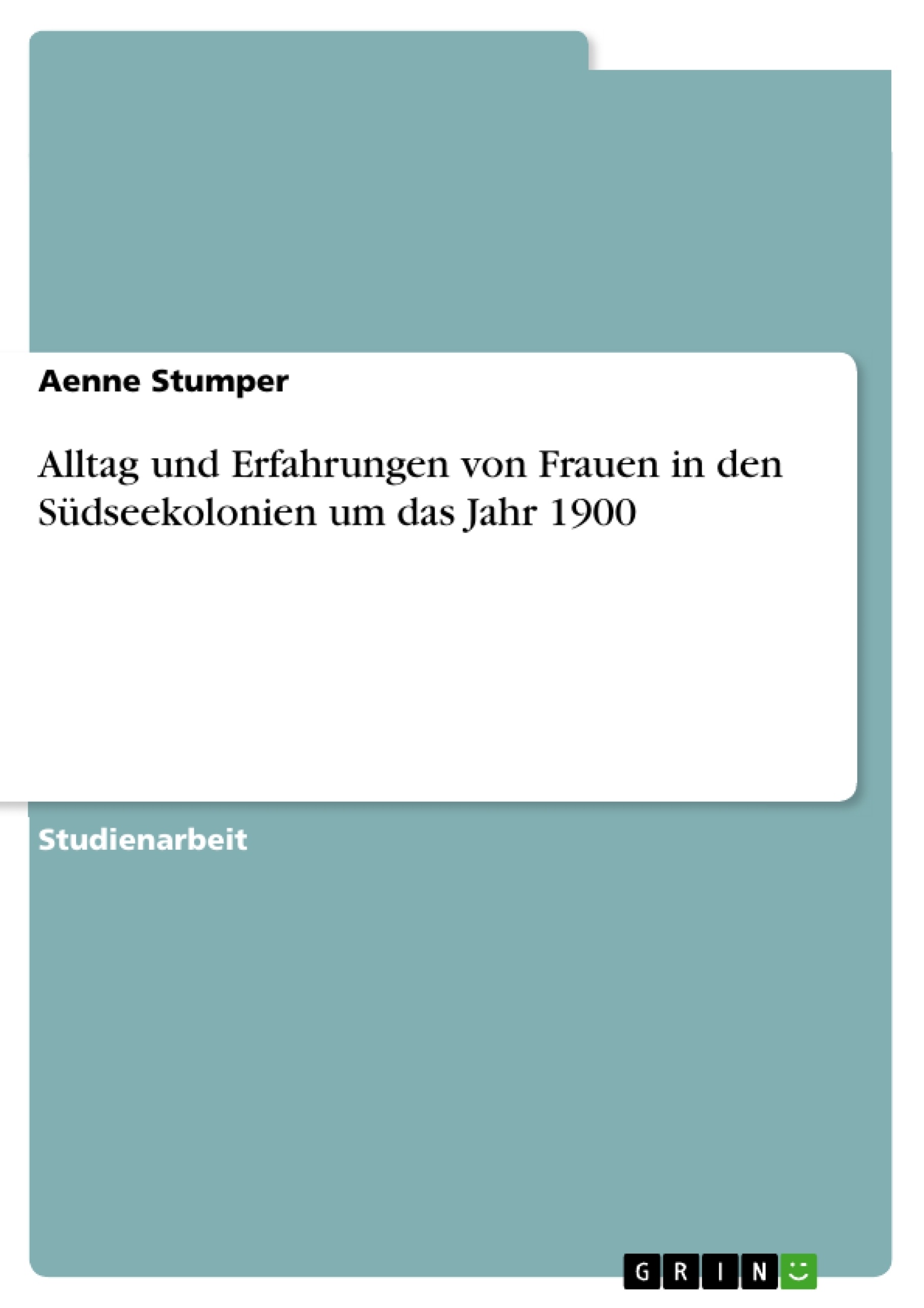Warum gab eine Frau eine Anzeige auf, um in einer Kolonie einen geeigneten Ehemann zu finden? Welche Frauen wanderten in die deutschen Kolonien aus? Was waren ihre Motive für die Auswanderung und wurde die Auswanderung von staatlicher Seite gefördert? Am Beispiel der Südseekolonien soll untersucht werden, wie der Alltag, die Aufgaben, aber auch die Herausforderungen deutscher Frauen aussahen. Im Mittelpunkt der Arbeit soll auch die Frage stehen, welches Rollenbild die sogenannte „deutsche Kolonialfrau“ nach den gesellschaftlichen Vorstellungen der damaligen Zeit zu erfüllen hatte.
Frauen werden bei der Betrachtung historischer Ereignisse allzu oft vernachlässigt, so auch in der deutschen Kolonialgeschichte. Aus diesem Grund lohnt es sich, einen Blick auf die deutschen Frauen in den Kolonien zu werfen und nicht, wie in der Forschung üblich, auf die Männer. Die Literatur ist dementsprechend weniger umfangreich. Die Arbeit ist deshalb von Bedeutung, weil sie nicht nur ein differenziertes Bild der Auswanderungsgründe zeichnet, sondern auch einen Beitrag zur Erhöhung der Aufmerksamkeit der Rolle der Frau im Alltag der Südseekolonien leistet. Eines der wichtigsten Forschungswerke der Arbeit ist das Werk Deutsche Frauen in den Südsee-Kolonien des Kaiserreichs: Alltag und Beziehungen zur indigenen Bevölkerung von der Historikerin Livia Loosen. Dieses wirft einen umfassenden Blick auf die Kolonien des Kaiserreichs mit besonderem Augenmerk auf den Alltag der Frauen. Darüber hinaus konnten einige Quellen, wie z.B. die deutsche Kolonialzeitung, gefunden werden, die einen guten Einblick in den Alltag der Frauen, aber auch in ihre Sichtweise und Wahrnehmung geben. Die Arbeit beginnt mit einem Blick auf die unterschiedlichen Motive für die Auswanderung. Die verschiedenen Gruppen von Frauen und die Rolle und Förderung der Institutionen für die Auswanderung sind von besonderem Interesse. Anschließend wird auf den Alltag, die Aufgaben und auch auf die möglichen Probleme eingegangen. Im letzten Kapitel wird das Verhältnis zwischen deutschen Frauen und der einheimischen Bevölkerung betrachtet. Das Fazit fasst alle wichtigen Aussagen zusammen. Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Kolonien in der Südsee. Eine umfassende Betrachtung aller Kolonien, insbesondere der afrikanischen, hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt und bedarf einer gesonderten Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motive deutscher Frauen für die Auswanderung
- Das Ideal der „deutschen Kolonialfrau“: Aufgabe und Rollenbild deutscher Frauen in den Kolonien
- Herausforderungen in den Kolonien: Einsamkeit, Anpassung und Klima
- Das Verhältnis zwischen deutschen Frauen und der einheimischen Bevölkerung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Alltag und die Erfahrungen deutscher Frauen in den Südseekolonien um 1900. Ziel ist es, die oft vernachlässigte Rolle der Frauen in der deutschen Kolonialgeschichte zu beleuchten und ein differenziertes Bild ihrer Auswanderungsmotive, Aufgaben, Herausforderungen und ihres Verhältnisses zur einheimischen Bevölkerung zu zeichnen.
- Auswanderungsmotive deutscher Frauen in die Südseekolonien
- Das Rollenbild der „deutschen Kolonialfrau“ und die damit verbundenen Erwartungen
- Herausforderungen des Alltags in den Kolonien (Klima, Einsamkeit, Anpassung)
- Das Verhältnis zwischen deutschen Frauen und der indigenen Bevölkerung
- Rolle von Institutionen bei der Förderung der weiblichen Auswanderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Alltag und den Erfahrungen deutscher Frauen in den Südseekolonien um 1900 in den Mittelpunkt. Sie hebt die bisherige Forschungslücke bezüglich der Rolle der Frauen in der deutschen Kolonialgeschichte hervor und begründet die Relevanz der Arbeit. Die Autorin kündigt ihren Forschungsansatz an, der sich auf die Südseekolonien konzentriert und auf die Analyse der Auswanderungsmotive, des Rollenbildes der „deutschen Kolonialfrau“, der Herausforderungen im Kolonialalltag und des Verhältnisses zu den Einheimischen abzielt. Die Arbeit stützt sich auf das Werk von Livia Loosen und weitere Quellen wie die Deutsche Kolonialzeitung.
Motive deutscher Frauen für die Auswanderung: Dieses Kapitel analysiert die vielfältigen Gründe für die Auswanderung deutscher Frauen in die Kolonien. Es unterscheidet zwischen institutionell geförderter Auswanderung (durch Organisationen wie den Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft und christliche Missionen) und individueller Auswanderung. Bei der institutionellen Auswanderung spielten eingebundene Rollenverständnisse und Aufgabenfelder eine wichtige Rolle, etwa die Heirat mit deutschen Siedlern und die Gründung von Familien zur Erhaltung einer „reinen Bevölkerung“. Im Gegensatz dazu werden bei der individuellen Auswanderung vier Kategorien unterschieden: Heirat, Arbeitssuche, Abenteuerlust und wissenschaftliche Expeditionen. Die Autorin erläutert die unterschiedlichen Motive innerhalb jeder Kategorie und beleuchtet den Einfluss von Institutionen auf die Auswanderung und den damit verbundenen Erwartungen an Frauen.
Schlüsselwörter
Deutsche Kolonialgeschichte, Frauen in den Kolonien, Südsee, Auswanderung, Rollenbild, Kolonialfrau, Missionen, Institutionen, Alltag, Herausforderungen, indigene Bevölkerung, Auswanderungsmotive.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument über deutsche Frauen in den Südseekolonien um 1900?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über eine Forschungsarbeit, die sich mit dem Alltag und den Erfahrungen deutscher Frauen in den Südseekolonien um 1900 beschäftigt. Es enthält das Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Forschungsarbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Auswanderungsmotive deutscher Frauen, das Rollenbild der "deutschen Kolonialfrau" und die damit verbundenen Erwartungen, die Herausforderungen des Alltags in den Kolonien (Klima, Einsamkeit, Anpassung), das Verhältnis zwischen deutschen Frauen und der indigenen Bevölkerung sowie die Rolle von Institutionen bei der Förderung der weiblichen Auswanderung.
Was ist das Ziel der Forschungsarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die oft vernachlässigte Rolle der Frauen in der deutschen Kolonialgeschichte zu beleuchten und ein differenziertes Bild ihrer Auswanderungsmotive, Aufgaben, Herausforderungen und ihres Verhältnisses zur einheimischen Bevölkerung zu zeichnen.
Welche Motive hatten deutsche Frauen für die Auswanderung in die Südseekolonien?
Die Motive waren vielfältig und reichten von institutionell geförderter Auswanderung (durch Organisationen wie den Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft und christliche Missionen), die oft mit Rollenverständnissen wie Heirat und Familiengründung verbunden war, bis hin zu individueller Auswanderung aus Gründen wie Heirat, Arbeitssuche, Abenteuerlust oder wissenschaftliche Expeditionen.
Welche Herausforderungen erwarteten deutsche Frauen in den Kolonien?
Deutsche Frauen in den Kolonien waren mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter das Klima, Einsamkeit und die Notwendigkeit, sich an eine neue Umgebung und Kultur anzupassen.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Forschungsarbeit relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Deutsche Kolonialgeschichte, Frauen in den Kolonien, Südsee, Auswanderung, Rollenbild, Kolonialfrau, Missionen, Institutionen, Alltag, Herausforderungen, indigene Bevölkerung, Auswanderungsmotive.
Welche Institutionen spielten eine Rolle bei der Auswanderung deutscher Frauen in die Südseekolonien?
Institutionen wie der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft und christliche Missionen spielten eine wichtige Rolle bei der Förderung der weiblichen Auswanderung, oft verbunden mit bestimmten Rollenbildern und Erwartungen.
- Arbeit zitieren
- Aenne Stumper (Autor:in), 2024, Alltag und Erfahrungen von Frauen in den Südseekolonien um das Jahr 1900, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1555046