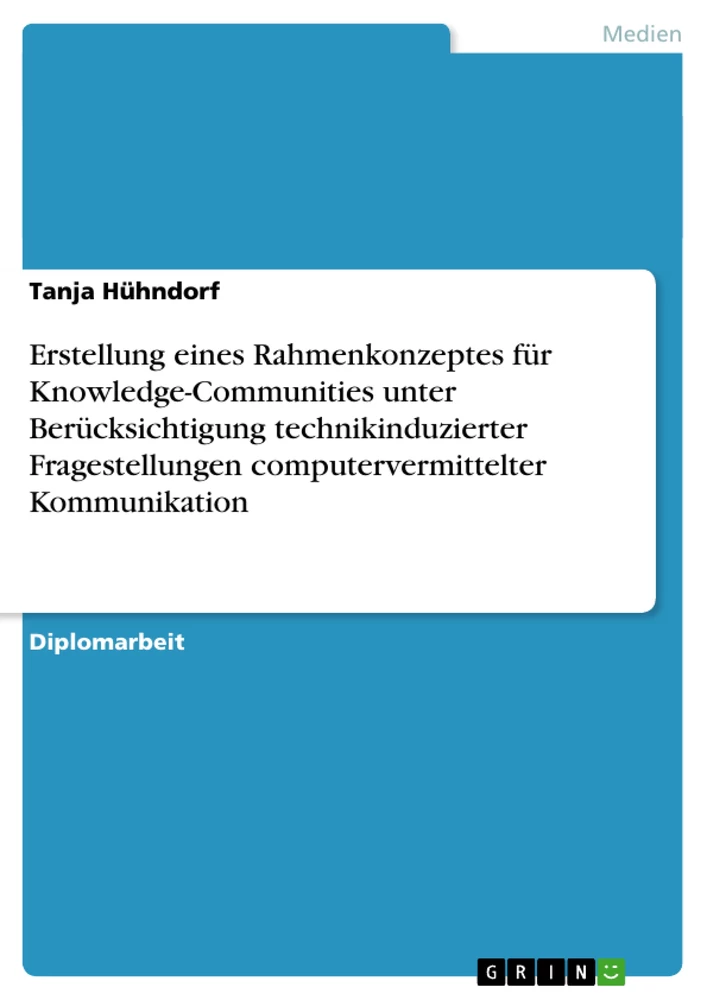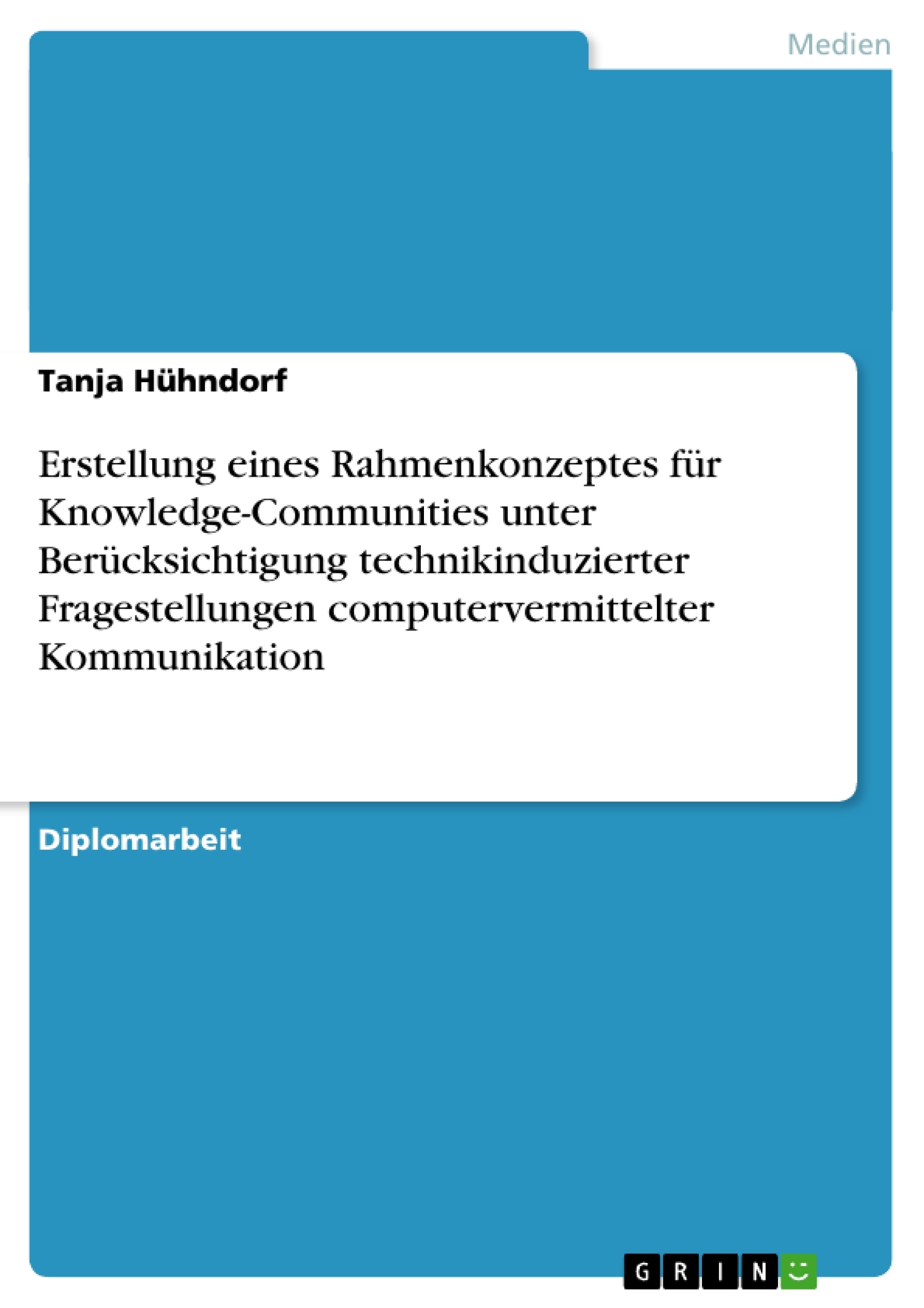Die verschiedenen sich in einer Community treffenden Menschen mit [...] etablieren verschiedenartige Netze mit Expertenwissen. Die Knowledge-Communities sind folglich ein gutes Mittel, um dort das individuelle Fachwissen zu potenzieren. Eine der größten Herausforderungen an das Wissensmanagement in Knowledge-Communities besteht darin, die Menschen – darunter Fach-Experten – zur Weitergabe ihres eigenen Wissens zu motivieren sowie die Bereitschaft zur Wissensgenerierung anderer dort agierender Teilnehmer mit Anreizen zu erhöhen, welche die Motivation im Sinne der Erreichung der Ziele und Erwartungen stärken soll.
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Hauptprobleme des Wissensaustausches in den Knowledge-Communities unter Berücksichtigung technikinduzierter Fragestellungen
computervermittelter Kommunikation (CvK). U.a. befasst sie sich
mit folgenden Fragestellungen: wie kann die Etablierung und Aufrechterhaltung einer professionellen Knowledge-Community die einzelnen Nutzer nicht nur auf sachlicher Ebene, d.h. rational und pragmatisch, sondern auch in emotionaler Hinsicht mit dem System verbinden, so dass die Erwartungen der Teilnehmer möglichst umfassend erfüllt werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei Hilfsmittel bzw. Werkzeuge, die den Teilnehmern bei Bedarf zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können, die zur verstärkten Nutzung bzw. zum aktiven und effektiven Austausch der Beteiligten anregen sollten.
Die Problemfelder, die unter Berücksichtigung technikinduzierter Fragestellungen der CvK zum Tragen kommen, werden im Zusammenhang mit dem Aspekt der Wissenskommunikation in Knowledge-Communities untersucht, die teilweise durch verschiedene Theorien erklärbar sind. Zu diesem Zweck wird eine Reihe von Theorien und Ansätzen der CvK herangezogen, die sich in ein Medienökologisches Rahmenmodell integrieren lassen.
Um ein besseres Verständnis der Organisationsstrukturen, die bei Knowledge-Communities anzutreffen sind, zu ermöglichen, werden die Eigenschaften ausgewählter klassischer aber auch moderner motivationaler Organisationsansätze untersucht und mit den spezifischen Eigenschaften der Knowledge-Communities verglichen. Ebenfalls werden die bestehenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen und klassischen Organisationsansätzen aufgezeigt. Hierfür wird [...] der gängigsten Motivationstheorien gegeben.
Die Ausarbeitung dieser Motivationstheorien soll eine unterstützte Hilfe geben, um eine Aussage über die entsprechenden Anreize [...]
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Vorgehen und Aufbau der Arbeit
- 2 Definition der Begriffe und thematische Eingrenzung
- 2.1 Definition und Bedeutung von Wissen
- 2.1.1 Explizites und implizites Wissen
- 2.2 Integration von Wissen im Wissensmanagement
- 2.3 Virtuelle Communities und ihre Kennzeichen
- 2.3.1 Aufgaben, Leistungsspektrum und Vertrauen in den Virtuellen Communities
- 2.3.2 Kategorisierung der Virtuellen Communities
- 2.4 Wissensmanagement mit Knowledge-Communities
- 2.4.1 Gestaltungsprinzipien von Knowledge-Communities
- 2.4.2 Etablierung von Knowledge-Communities
- 2.5 Expertennetzwerke als professionelle Knowledge-Communities
- 2.5.1 Ein kurzer Überblick über Expertennetzwerke-Community-Typen
- 2.1 Definition und Bedeutung von Wissen
- 3 Motivationale Ansätze und Anreizsysteme für Knowledge-Communities
- 3.1 Motivationstheorien versus Knowledge-Communities
- 3.1.1 Klassische Organisationsansätze
- 3.1.2 Verhaltensorientierte Organisationsansätze
- 3.1.3 Motivationstheoretische Ansätze
- 3.1.4 Systemorientierte Ansätze
- 3.1.5 Moderne organisationstheoretische Ansätze
- 3.1.6 Organisationstheoretische Ansätze und Knowledge-Communities
- 3.2 Anforderungen an Anreizsysteme unter Berücksichtigung computervermittelter Kommunikation (CvK)
- 3.2.1 Anreizinstrumente und Vertrauen als Einflussfaktoren
- 3.1 Motivationstheorien versus Knowledge-Communities
- 4 Computervermittelte Kommunikation (CvK)
- 4.1 Formen der computervermittelten Kommunikation (CvK)
- 4.2 Weblogs
- 4.2.1 Professionelle - Business Blogs
- 4.3 Merkmale der computervermittelten Kommunikation (CvK)
- 4.3.1 Face-to-Face-Kommunikation (FtFK) versus computervermittelte Kommunikation (CvK)
- 4.3.2 Vorteile der computervermittelten Kommunikation (CvK)
- 4.3.3 Sozialpsychologische Aspekte der computervermittelten Kommunikation (CvK)
- 4.4 Technikinduzierte Problemfelder der computervermittelten Kommunikation (CvK) in Knowledge-Communities
- 4.5 Theorien der computervermittelten Kommunikation (CvK)
- 4.5.1 Das Medienökologische Rahmenmodell
- 4.5.2 Eine kurze Zusammenfassung der Medienwahl-Modelle unter Berücksichtigung technikinduzierter Fragestellungen der computervermittelten Kommunikation (CvK)
- 4.6 Kompensation technikinduzierter Defizite in Knowledge-Communities
- 5 Empirie
- 5.1 Struktur der Studie
- 5.2 Ergebnisse der Studie
- 5.3 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- Literatur- und Quelleverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Erstellung eines Rahmenkonzepts für Knowledge-Communities, wobei technikinduzierte Fragestellungen der computervermittelten Kommunikation im Vordergrund stehen. Das Ziel der Arbeit ist es, die Hauptprobleme des Wissensaustausches in Knowledge-Communities zu untersuchen und Lösungsansätze zu entwickeln, um die Motivation der Teilnehmer zu steigern und die Effizienz des Wissensmanagements zu erhöhen.
- Die Bedeutung von Wissen und seine Integration im Wissensmanagement
- Die Herausforderungen und Chancen des Wissensaustausches in Knowledge-Communities
- Die Rolle von Motivation und Anreizsystemen in Knowledge-Communities
- Technikinduzierte Problemfelder der computervermittelten Kommunikation (CvK) in Knowledge-Communities
- Theorien und Modelle der computervermittelten Kommunikation (CvK) und ihre Anwendung auf Knowledge-Communities
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung und das Ziel der Arbeit dargelegt werden. Anschließend werden die wichtigsten Begriffe definiert und die thematische Eingrenzung vorgenommen. Im zweiten Kapitel werden virtuelle Communities und Knowledge-Communities im Detail betrachtet. Dabei wird auf die Aufgaben, das Leistungsspektrum und die Bedeutung von Vertrauen in diesen Communities eingegangen. Auch die Gestaltungsprinzipien und die Etablierung von Knowledge-Communities werden behandelt. Im dritten Kapitel werden verschiedene motivationale Ansätze und Anreizsysteme für Knowledge-Communities analysiert. Klassische, verhaltensorientierte, motivationstheoretische, systemorientierte und moderne organisationstheoretische Ansätze werden vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit in Knowledge-Communities untersucht. Im vierten Kapitel wird die computervermittelte Kommunikation (CvK) genauer betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Formen der CvK, die Merkmale der CvK, die Vorteile und die sozialpsychologischen Aspekte der CvK. Außerdem werden technikinduzierte Problemfelder der CvK in Knowledge-Communities analysiert und verschiedene Theorien der CvK vorgestellt. Das fünfte Kapitel widmet sich der Empirie. Hier werden die Ergebnisse der durchgeführten Studie dargestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Knowledge-Communities, Wissensmanagement, Motivation, Anreizsysteme, computervermittelte Kommunikation (CvK) und technikinduzierte Problemfelder. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind: virtuelle Communities, explizites und implizites Wissen, Face-to-Face-Kommunikation (FtFK) und das Medienökologische Modell. Die Arbeit befasst sich mit der Gestaltung von effektiven und motivierenden Knowledge-Communities, die den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht werden und den Wissensaustausch fördern.
- Quote paper
- Tanja Hühndorf (Author), 2009, Erstellung eines Rahmenkonzeptes für Knowledge-Communities unter Berücksichtigung technikinduzierter Fragestellungen computervermittelter Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155494