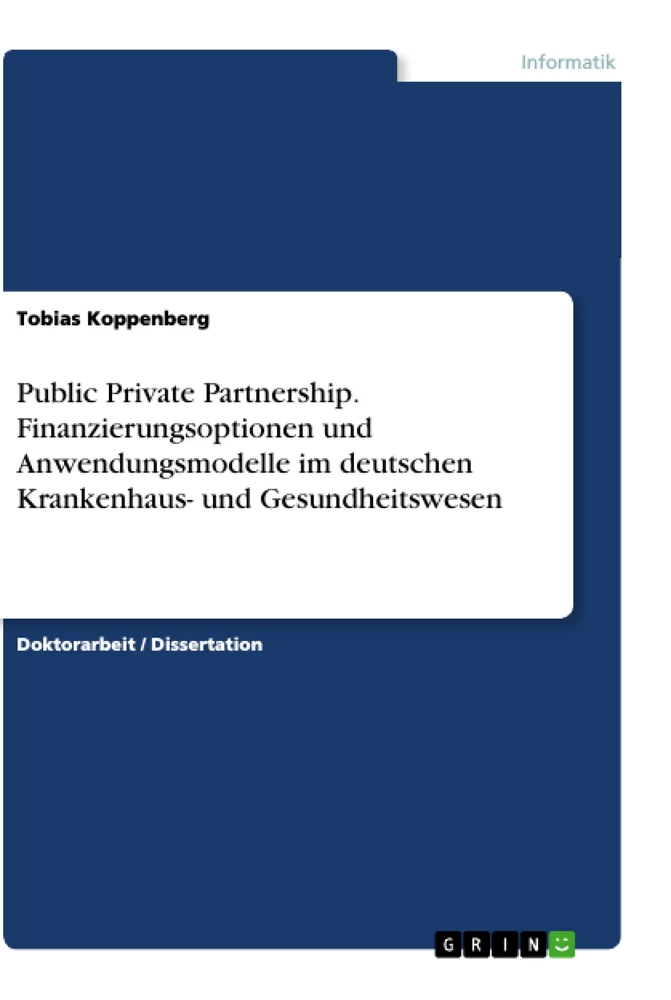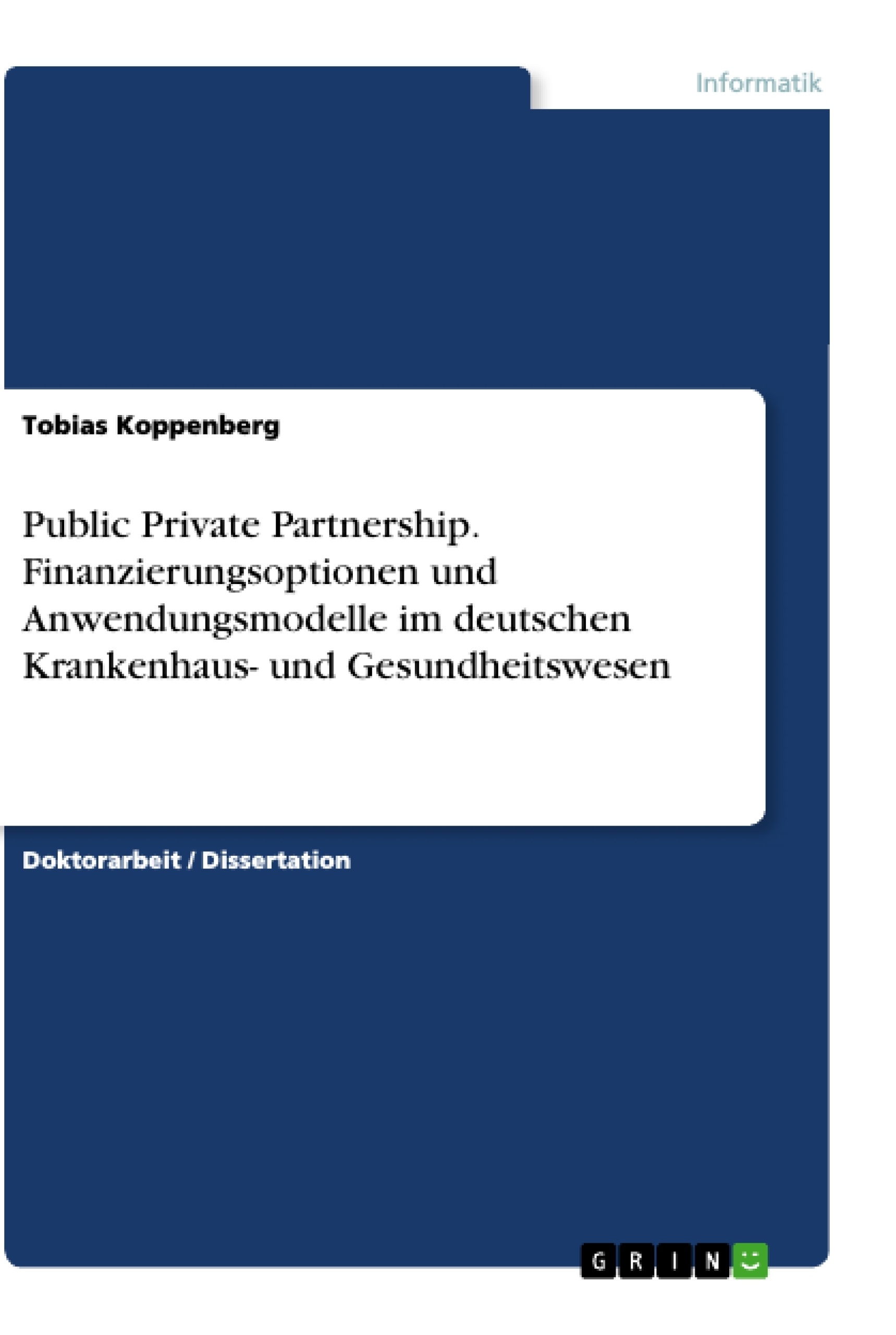In Deutschland besteht ein großes Bedürfnis nach fachlicher medizinischer Betreuung. Dieses Bedürfnis geht mit einer Betreuung einher, die durchaus kostenintensiv ist und damit zu einem bedeutenden Faktor wird, der für die behandelnde Seite (Ärzte, Krankenhausverwaltungen, Krankenkassen, etc.) nicht im Vorhinein planbar und unter betriebswirtschlichen Aspekten zu kalkulieren ist. Aufgrund dieser gegebenen Planungsunsicherheit und auch durch Missmanagement in der Vergangenheit steht das deutsche Gesundheitssystem vor einer gewaltigen Herausforderung. Diese Herausforderung besteht darin, das Versorgungssystem weiterhin aufrecht zu erhalten und dem medizinischen Fortschritt wie auch der Behandlung von neuen und teilweise noch nicht vollends erforschten Krankheiten gerecht zu werden.
Das ursprüngliche System der Finanzierung durch den Staat ist durch eine duale Finanzierung verändert worden. Diese Änderung bringt sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. Vor allem die Risiken führen zu Problemen, die einer angemessenen Lösung entgegenstehen.
In Deutschland besteht das Hauptrisiko, die nachhaltige Finanzierung von Ausgaben in Zusammenhang mit Behandlungen aufrecht zu erhalten. Auf Basis von Finanzierungsinstrumenten die je nach Ausprägung dem Eigenkapital oder dem Fremdkapital zuzuordnen sind, lassen sich nachhaltige und dem Anspruch bzw. dem Bedürfnis entsprechende Finanzierungslösungen herleiten, die eine Absicherung der Aufgabe (Behandlung von Patienten) und ggf. eine Finanzreserve hervorbringen.
Der Inhalt dieser Arbeit soll aufzeigen, mit welchen Mitteln und Möglichkeiten Finanzierungen von Gesundheitsausgaben auf organisatorischer Ebene (Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, etc.) darstellbar sind und somit die bestehenden Verpflichtungen weiterhin zu bewältigen sind. Darüber hinaus sollen die zur Verfügung stehenden Partnerschaftsmodelle identifiziert werden. Abschließend sollen die Grenzen von Partnerschaftsmodellen und der damit verbundenen Finanzierungen skizziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Kurzfassung
- Vorwort
- 1 Überblick
- 1.1 Relevanz der Arbeit
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Theoretischer Hintergrund der Arbeit
- 1.4 Methode
- 1.5 Forschungsfragen
- 2 Grundlagen
- 2.1 Darstellung der Problemstellung
- 2.2 Entwicklung der Finanzierung im Gesundheitswesen
- 2.3 Public Private Partnership
- 2.3.1 PPP-Modelle
- 2.3.2 PPP-Varianten
- 2.3.2.1 PPP-Betriebsführungsmodell
- 2.3.2.2 PPP-Betriebsüberlassungsmodell
- 2.3.2.3 PPP-Kooperationsmodell
- 2.3.2.4 PPP-Konzessionsmodell
- 2.3.2.5 PPP-Betreibermodell
- 2.3.3 Differenzierte PPP-Modelle
- 2.3.3.1 Erwerbermodell
- 2.3.3.2 Optionsmodell
- 2.3.3.3 Mietmodell
- 2.3.3.4 Contractingmodell
- 2.3.3.5 PPP-Leasingmodell
- 2.4 Exkurs Privatisierung
- 2.4.1 Formale Privatisierung
- 2.4.2 Materielle Privatisierung
- 2.4.3 Outsourcing
- 2.4.4 Contracting Out
- 2.4.5 Verfahrensprivatisierung
- 2.4.6 Finanzierungsprivatisierung
- 2.4.7 Kostenprivatisierung
- 2.4.8 Aufgabenprivatisierung
- 2.4.9 Teil- und Vollprivatisierung
- 2.5 Rechtliche Grundlagen
- 2.5.1 Partnerschaft
- 2.5.2 Betriebswirtschaftliche Einordnung
- 2.5.3 Rechtliche Einordnung
- 2.5.4 Vergaberecht
- 2.5.5 Steuerrecht
- 2.5.6 Haushaltsrecht
- 2.6 Wirtschaftlichkeitsnachweis/Value for Money
- 2.7 Prinzipal-Agenten-Theorie
- 2.8 Transaktionskostentheorie
- 3 Finanzierungs- und Handlungsmöglichkeiten
- 3.1 Finanzierungsvarianten
- 3.1.1 Eigenkapital
- 3.1.2 Fremdkapital
- 3.1.3 Mezzanine
- 3.2 Interne Finanzierungsmöglichkeiten
- 3.2.1 Finanzierung durch Unternehmensgewinne/Selbstfinanzierung
- 3.2.2 Vermögensumschichtung
- 3.2.3 Finanzierung aus Rückstellungen
- 3.2.4 Finanzierung durch Optimierung des Umlaufvermögens
- 3.2.5 Kapitalerhöhung
- 3.2.5.1 Ordentliche Kapitalerhöhung
- 3.2.5.2 Bedingte Kapitalerhöhung
- 3.2.5.3 Genehmigte Kapitalerhöhung
- 3.2.5.4 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
- 3.3 Externe Finanzierungsmöglichkeiten
- 3.3.1 Eigenkapitalzuführung
- 3.3.2 Fremdkapitalzuführung
- 3.4 Mezzaninekapital
- 3.5 Operative Finanzierungsmöglichkeiten
- 3.5.1 Leasing
- 3.5.2 Forfaitierung
- 3.5.3 Funktionen der Forfaitierung
- 3.5.4 Verbriefungen von Forderungen
- 3.6 Kapitalmarktorientierte Finanzierungsmöglichkeiten
- 3.6.1 Anleihen
- 3.6.2 Anleiheformen und Emissionsfähigkeit
- 3.6.3 Industrieobligationen
- 3.6.4 Wandelschuldverschreibungen
- 3.6.5 Optionsschuldverschreibung
- 3.6.6 Gewinnschuldverschreibung
- 3.6.7 Null-Kupon-Anleihe
- 3.6.8 Variabel verzinsliche Anleihen
- 4 Auswirkungen auf die Finanzierungsparameter
- 4.1 Risiken
- 4.1.1 Eurostat-konforme Risiken
- 4.1.2 Nachfragerisiko
- 4.1.3 Ausfallrisiko
- 4.1.4 Baurisiko
- 4.1.5 Kreditrisiken
- 4.1.6 Technische Risiken
- 4.1.7 Planungsrisiko
- 4.1.8 Wirtschaftliche Risiken
- 4.2 Grenzen der Finanzierung
- 4.3 Einfluss externer Faktoren
- 4.4 Garantien
- 5 Auswahlkriterien für PPP-Modelle
- 5.1 Strukturierung von PPP-Modellen
- 5.1.1 Projektstrukturierung
- 5.1.2 Entwicklung des PPP-Modells
- 5.1.3 Auswahl des PPP-Modells
- 5.1.4 Kosten-Nutzen-Szenario
- 5.2 Holding-Modelle
- 5.2.1 Definition von Holding-Modellen
- 5.2.2 Darstellung von Holding-Modellen
- 5.2.3 Berliner Modell
- 5.2.4 Bayern-Modell
- 5.3 Anwendbarkeit von PPP-Modellen
- 5.3.1 Durchführbarkeit
- 5.3.2 Risikoadjustierung
- 5.3.3 Modellfähigkeit
- 5.4 Schranken von PPP-Modellen
- 5.4.1 Kommunalrechtliche Aspekte
- 5.4.2 Bundes- und landeshaushaltsrechtliche Aspekte
- 5.4.3 Wirtschaftliche Aspekte
- 5.4.4 Aufnahme von Krediten und Investitionsfinanzierung bei PPP
- 5.5 Praxisbeispiele PPP im Kontext von Gesundheitsfinanzierungen
- 5.5.1 Radioonkologisches Centrum in Kiel
- 5.5.2 PPP-Krankenhausprojekt in Manchester (Großbritannien)
- 5.5.3 PPP in Italien
- 5.5.4 PPP im Krankenhausbereich in Australien
- 5.5.5 PPP im Gesundheitsumfeld in Nigeria
- 6 Gestaltung und Strukturierung
- 6.1 Kapitalstrukturierung
- 6.1.1 Ermittlung von Kosten
- 6.1.2 Ermittlung potentieller Erlöse
- 6.1.3 Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben
- 6.1.4 Cashflow-Modellierung
- 6.1.5 Analyse der Annahmen
- 6.2 Finanzierung
- 6.2.1 Finanzierungsmodelle
- 6.2.2 Finanzierungsquelle
- 6.2.2.1 Kreditfinanzierung
- 6.2.2.2 Kapitalmarktfinanzierung
- 6.2.2.3 Forfaitierung
- 6.2.2.4 Eigenkapital
- 6.2.2.5 Nachrangdarlehen
- 6.2.2.6 Mezzanine
- 6.2.3 Cashflow-Modell
- 6.3 Realisierung
- 6.3.1 Kriterienkatalog
- 6.3.2 Konzeption
- 6.3.3 Subsidiaritätsprinzip
- 6.3.4 Wirtschaftlichkeitsnachweis
- 6.3.5 Modellfähigkeit
- 6.3.6 Finanzierbarkeit
- 6.3.7 Umsetzung
- 6.3.8 Betrieb
- 6.4 Dividendenpolitik und Kapitalrückführung
- 7 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Finanzierung von Public Private Partnerships (PPP) im deutschen Krankenhaus- und Gesundheitswesen. Sie analysiert verschiedene Finanzierungsoptionen und Anwendungsmodelle von PPP und untersucht deren Auswirkungen auf die Finanzierungsparameter.
- Die Entwicklung von PPP-Modellen im Gesundheitswesen
- Die verschiedenen Finanzierungsvarianten für PPP-Projekte
- Die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen für PPP im Gesundheitswesen
- Die Risiken und Herausforderungen bei der Finanzierung von PPP
- Die Auswahlkriterien und Anwendungsbereiche von PPP-Modellen im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Relevanz der Arbeit, die Zielsetzung und den theoretischen Hintergrund. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Grundlagen von PPP, darunter die Entwicklung der Finanzierung im Gesundheitswesen, verschiedene PPP-Modelle und ihre Varianten, sowie der Exkurs Privatisierung. Kapitel drei beleuchtet die Finanzierungs- und Handlungsmöglichkeiten für PPP-Projekte, inklusive interner und externer Finanzierungsmöglichkeiten. Kapitel vier analysiert die Auswirkungen von PPP auf die Finanzierungsparameter, wie Risiken und Grenzen der Finanzierung. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Auswahlkriterien für PPP-Modelle, der Strukturierung von PPP-Projekten und der Anwendbarkeit von PPP-Modellen im Gesundheitswesen. Kapitel sechs behandelt die Gestaltung und Strukturierung von PPP-Projekten, inklusive Kapitalstrukturierung und Finanzierungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Public Private Partnership, PPP, Gesundheitswesen, Krankenhausfinanzierung, Finanzierungsoptionen, Anwendungsmodelle, Risiken, Auswahlkriterien, Rechtliche Rahmenbedingungen, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Value for Money, Holding-Modelle, Praxisbeispiele
- Quote paper
- Tobias Koppenberg (Author), 2010, Public Private Partnership. Finanzierungsoptionen und Anwendungsmodelle im deutschen Krankenhaus- und Gesundheitswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155483