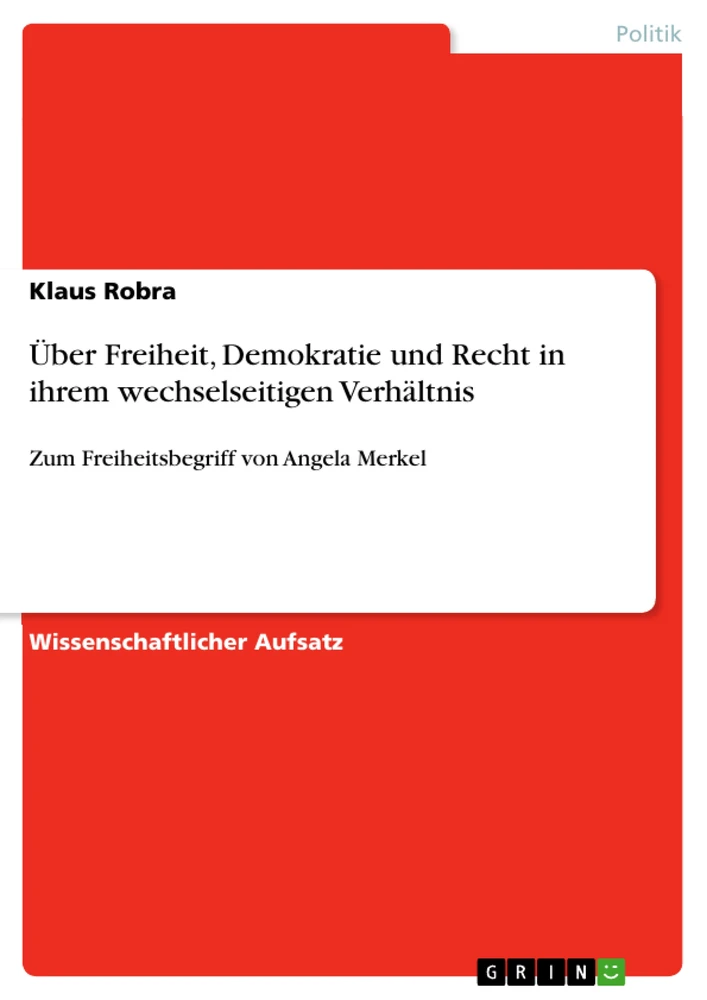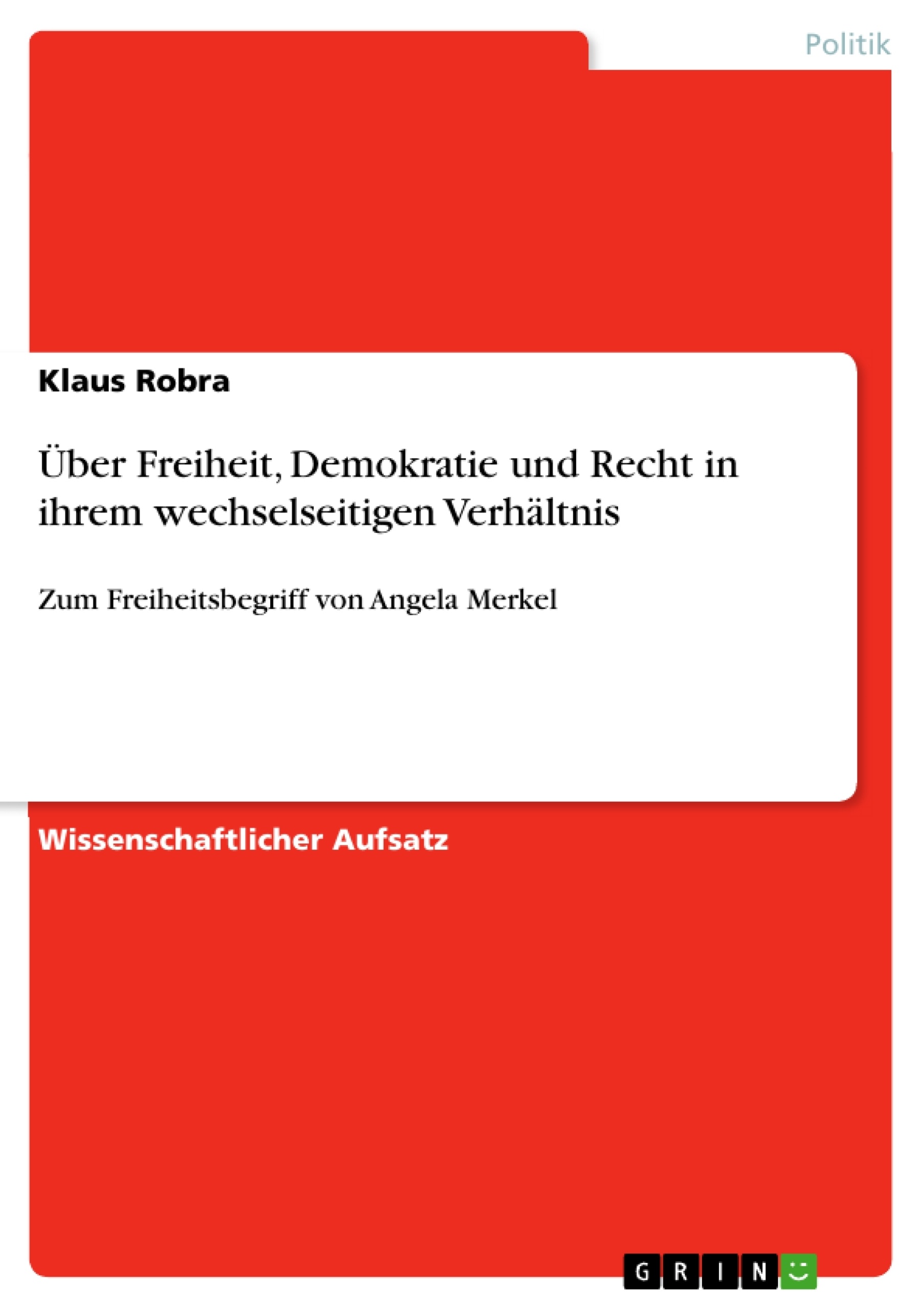Dieser Text analysiert die wechselseitige Beziehung zwischen Freiheit, Demokratie und Recht, insbesondere im Hinblick auf Angela Merkels Freiheitsverständnis. Ausgangspunkt ist Merkels Aussage, dass Demokratie die Voraussetzung für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte sei. Der Text hinterfragt diese Prämisse kritisch und beleuchtet alternative Sichtweisen, die Demokratie nicht nur als Grundlage, sondern auch als Teil eines komplexeren Geflechts von Abhängigkeiten sehen. Zudem wird die ethische Basis des Rechts thematisiert, einschließlich der Spannungen zwischen Gut und Böse, die moralische Orientierung und Ethik erforderlich machen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis der Interdependenzen zwischen Freiheit, Demokratie und Recht zu schaffen.
„ … ohne Demokratie gibt es keine Freiheit, keinen Rechtsstaat, keine Wahrung der Menschenrechte.“ (Angela Merkel, in: Freiheit (2024), S. 717)
Damit wäre die Demokratie nicht nur die Grundlage und Voraussetzung der Freiheit, sondern auch des Rechts und des Rechtsstaates – und zugleich Garantin der Menschenrechte. Um dies beurteilen zu können, kommt es zunächst darauf an, wie die Demokratie zu definieren oder zu verstehen ist: nur als „Herrschaft des Volkes durch das Volk für das Volk“? Dann wäre „Herr-schaft“ nicht nur ein Zeichen, sondern auch eine Grundvoraussetzung für Freiheit und Recht. Das aber wäre zumindest einseitig, denn Herrschaft, Freiheit und Recht existieren im Rechts-staat zwar mit- und nebeneinander; Freiheit und Recht beinhalten aber weitaus mehr als nur die pure Herrschaft. Vielmehr muss – in einer Demokratie – das Recht auch die Herrschafts-formen kontrollieren; und Freiheit ist auch (mögliche) Freiheit von Herrschaft und zugleich Freiheit zu einer Vielzahl anderer Möglichkeiten als die des Herrschens. Insofern könnte Demokratie nicht einfach die Grundlage von Freiheit sein. Was mutatis mutandis auch für das Verhältnis von Demokratie und Recht gilt. –
Die Vermutung liegt nahe, dass die Abhängigkeitsverhältnisse ganz anders situiert sind. Aber wie? Zu beachten ist zunächst, dass das Recht eine ethische Kategorie ist. Das Recht ist ethisch zu begründen, nicht umgekehrt. Dies aus folgendem Grund:
Wie aus neueren Forschungsergebnissen hervorgeht, kommen wir Menschen mit den Anlagen sowohl zum Guten als auch zum Bösen auf die Welt. Diese Anlagen gelten evolutionsge-schichtlich sogar als Erbteile aus dem Tierreich.1 Wollte man also die Entstehung von Gut und Böse zurückverfolgen, müsste man tief in die Evolutionsgeschichte eintauchen, was hier nicht meine Aufgabe sein kann. Immerhin: Dass Gut und Böse im Menschen mit- und gegen-einander existieren, ist nicht zu bezweifeln.2 Ebenso wenig wie die Tatsache, dass Gut und Böse in uns in Konflikt geraten können, so dass wir auch unserer Entscheidung für das Gute nicht immer sicher sein können. Wie die Erfahrung lehrt, kann das Gute durch das Böse verhindert oder sogar besiegt werden – und dies nicht nur in Fällen von Kriminalität jeder Art. „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“, sagte schon der Apostel Paulus – wobei zu beachten ist, dass Paulus, wie nach ihm Augustinus und Luther, diese Auffassung sogar mit der Lehre von der „Erbsünde“ verband, einer Lehre, die sich inzwischen als wissenschaftlich unhaltbar erwiesen hat. Nicht zu leugnen sind dennoch die (möglichen) Konflikte zwischen Gut und Böse. Wie können wir solche Kon-flikte zum Guten wenden? Nicht ohne Ethik und Moral! Wir brauchen Orientierung für unsere Entscheidungen und damit für unser Handeln. „Hand’le so, dass …“, heißt es bekanntlich am Anfang von Kants Kategorischem Imperativ, der sich inzwischen allerdings – zumindest in seiner Grundform – als obsolet, nicht mehr begründbar herausgestellt hat.3 Stattdessen lautet meine legitime Forderung:
„ Achte bei allem, was Du tust, darauf, Dich selbst und Deine Mit-Menschen als Rechts-personen und Persönlichkeiten zu respektieren und möglichst stets das Sittengesetz zu befolgen.
„Möglichst“ deshalb, weil es Ausnahmesituationen gibt, wie z.B. die der Notwehr, in denen die Rechte der eigenen Person gegen existenzielle Bedrohungen und Rechtsbrüche jeder Art zu verteidigen sind.“ (a.a.O. S. 305 f.)
Diese Formulierungen entsprechen teilweise durchaus Kants Kategorischem Imperativ, aller-dings nur in dessen Zweckformel, wonach der Mensch jederzeit als Rechtsperson zu achten und stets als Selbstzweck, niemals nur als Mittel zm Zweck zu behandeln ist.
Ergänzbar ist meine legitime Forderung durch eine ausführliche Natur-, Öko- und Tier-Ethik, kurz zusammengefasst in der Formel:
„Verhalte Dich so, dass Du die Natur in jeder Person und in jeder anderen Erscheinungsform stets als Zweck – und als Mittel nur zu ethisch begründbaren und moralisch vertretbaren Zwecken – behandelst.“ (a.a.O. S. 308)
Aus den beiden Ethik-Formeln lässt sich nicht nur eine Wertethik, sondern auch eine Begründung des Rechts ableiten, und zwar zunächst des Rechts auf Selbstbestimmung, das sich nicht zuletzt auch aus dem von Joachim Bauer erklärten Selbst-System ergibt. Bauer schreibt:
„„In Säuglingen und Kleinkindern komponiert sich ein Selbst, dessen Themen von ihren Bezugspersonen über Resonanzvorgänge in sie hineingelegt wurden. Je weiter wir heranwachsen und persönlich reifen, desto mehr wird das Selbst zu einem Akteur, der mitspricht und beeinflusst, was mit ihm geschieht. Wir entwickeln ein Gefühl, das uns spüren lässt, welche an uns herangetragenen Angebote zu uns passen und zu einem stimmigen Teil unseres Selbst werden könnten, und welche unserer Identität Gewalt antun würden. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich an der Konstruk-tion seiner selbst – und seines Selbst – beteiligen kann, ein Hinweis, der in dieser ex-pliziten Form erstmals durch den Renaissance-Philosophen Pico de la Mirandola gege-ben wurde.“4
Insgesamt gesehen hält J. Bauer den Besitz des Selbst-Systems für ein Erkennungs- und Alleinstellungsmerkmal der menschlichen Spezies. Es befähigt sowohl zur Selbst-Fürsorge als auch zur Fürsorge für andere Menschen. Es verhilft zur Ich-Findung, zur inneren Ruhe und Gelassenheit, so auch in der Meditation, in Yoga und – falls erforderlich – durch Psycho-therapie. Worin J. Bauer auch Möglichkeiten und zugleich Verpflichtungen des ärztlichen Tuns erkennt, die weit über Diagnostik und Therapie hinausgehen. Bauers Schlusswort lautet:
„Der Umgang mit unserem Selbst – und mit dem unserer Mitmenschen – erfordert Sensibilität, Geduld, Bewahrung, manchmal aber auch einen mutigen Schritt hinein in Möglichkeits- und Entwicklungsräume. Mehr als alles andere aber braucht unser Selbst – und das unsere Mitmenschen – dieses eine: Liebe.“ (a.a.O. S. 209)
Aus dieser neuen Darstellung des Selbst-Systems lässt sich – als neue politische Perspektive – ableiten:
Da das Selbst-System zur Ich-Findung, Selbst-Fürsorge und Fürsorge für andere Menschen befähigt, hat das Individuum – das personale Selbst – einen Rechtsanspruch auf Selbst-bestimmung, und zwar auch deshalb, weil der Mensch das einzige Wesen ist, „das sich an der Konstruktion seiner selbst – und seines Selbst“ beteiligt bzw. beteiligen kann, soll und muss. Beteiligt ist der Mensch vom Säuglingsalter an (s.o.). Beteiligen muss er sich später daran, wie sein Selbst konkret gestaltet wird, dabei auch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Dieser darf seinem Anspruch auf Selbstbestimmung nicht im Wege stehen, was nur dann möglich zu sein scheint, wenn der Anspruch auf Selbstbestimmung tatsächlich auch gesamt-gesellschaftlich gewährleistet wird. Jedes Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung, wobei jedes personale Individuum, die Einzelperson, an der individuellen Inanspruchnahme und Wahrnehmung dieses Rechts nur dann gehindert werden darf, wenn es dabei die Rechte sei-ner Mitmenschen verletzt oder missachtet.
Politisch besagt dies: Demokratie bedeutet nicht nur „Herrschaft des Volkes für das Volk und durch das Volk“, sondern auch Selbstbestimmung des Volkes. Demgemäß erstrebenswert erscheint eine Mischung aus direkter und repräsentativer Demokratie, weil in beiden Formen – und erst recht in ihrer Kombination und effektiver Kooperation – sowohl das Gemeinwohl als auch die Rechte der Einzelpersonen gewahrt werden. – Dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt des Selbst-Systems sollte in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden.
Ethik und Recht lassen sich anthropologisch begründen, und zwar ohne „naturalistischen Fehlschluss“. Ethik – als philosophische und wissenschaftliche Grundlage der Moral – ist unentbehrlich, um die im Menschen angelegten Möglichkeiten von Konflikten zwischen Gut und Böse bewältigen zu können. Orientierungen für unsere Entscheidungen und damit für unsere Handlungen können durch legitime ethische Forderungen nach allseitiger Respektie-rung der Natur einschließlich der menschlichen Natur, d.h. des Menschen als Rechtsperson, geboten werden. Hierzu heißt es (2022) in einem Internet-Artikel über den Unterschied zwischen Recht und Ethik:
„Das Recht regelt die Gesellschaft als Ganzes. Das Recht kann als „Pflichtmoral“ bezeichnet werden, weil es Handlungsgrenzen vorgibt.“5
Da aber jede Moral auf Ethik beruht, ergibt sich folgende erste Abhängigkeits-Hierarchie:
Recht
*
Moral
*
Ethik
*
Gut und Böse
Diese Hierarchie gilt zunächst und in erster Linie in der Sicht von unten nach oben. Im Übrigen besteht zwischen den Faktoren Wechselwirkung. Wobei Ethik verstanden werden kann als „das moralische Prinzip, das das Verhalten und die Handlungen eines Individuums regelt, kontrolliert oder beeinflusst“. (a.a.O. ebd.)
Womit klar wird, dass Ethik sich jeweils mit einer entsprechenden Anthropologie verbindet. Näher zu erläutern bleibt, ob und wie Ethik und Recht evtl. auch als Grundlagen von Demo-kratie und Freiheit dienen können.
Freiheit gibt es im Menschen von früher Kindheit an als Willensfreiheit. Diese ist jedoch – anders als Gut und Böse – nicht angeboren, sondern entwickelt sich erst allmählich in den ersten Lebensjahren. Den Willen gibt es nicht ohne das Selbst (s.o.), und zwar sowohl materi-ell als auch geistig-seelisch. Die materielle Grundlage des Willens bildet sich nach der Geburt vor allem durch die kontinuierliche Ausreifung bestimmter Hirnareale. Geistig-seelisch ent-wickelt sich der Wille vornehmlich durch den Einfluss der Bezugspersonen (Resonanz usw.) in der jeweiligen Umwelt. Relativ frei wird der Wille erst, wenn hierfür nicht nur die materiel-len (körperlichen, neuronalen), sondern auch die geistig-seelischen bzw. kognitiven Voraus-setzungen erfüllt sind. Gut und Böse sind als Anlagen angeboren, die Fähigkeit, zwischen ihnen abzuwägen und zu entscheiden, muss erlernt werden.
Wenn das Recht auf Selbstbestimmung anthropologisch begründet ist, gilt dies erst recht für eine auf dem Selbstbestimmungsrecht des Volkes beruhende Demokratie. Wie aber steht es dann mit der Freiheit? Bedingt diese die Demokratie oder ist es umgekehrt (wie A. Merkel be-hauptet, wonach es „ohne Demokratie … keine Freiheit“ gebe)? Auch der Freiheits-Begriff muss aber erneut geklärt werden. Meine Feststellungen hierzu:
Der Sinn des Seins liegt vermutlich in der Freiheit. Wir überblicken jedoch nicht (bzw. nicht mehr) das Ganze des Seins, nicht die Vergangenheit, z.B. jenseits des „Urknalls“, und nicht die Zukunft: Big Crunch oder Reich der Freiheit, Nichts oder Alles? So dass man sich vielleicht mit dem Sinn, nicht des Seins, sondern von Sein begnügen könnte.
Ein anderer Weg der Ergründung des Sinns von Sein besteht darin, vom Sein als dem Noch-Nicht, dem Sein als Werden, auszugehen. Was sich sogleich aufhebt, wenn alles Werden unvermeidlich dem Vergehen zum Opfer fällt – was nicht überschaubar und nicht entscheidbar zu sein scheint.
Aber: Im Werden kann Neues, nie Dagewesenes entstehen – bis hin zur Auflösung des Seins in Information, aber auch bis hin zu der Möglichkeit, ein Reich der Freiheit zu errichten. Zu diskutieren ist daher die Frage:
Freiheit wozu und wovon?
Erstens Freiheit wovon: von Unfreiheit, d.h. von Not, Elend, Ausbeutung, Unterdrückung, Entfremdung, Verdinglichung; so dass alle Verhältnisse umzustürzen sind, in denen derartige Mängel, derartige Unfreiheiten herrschen. – Erreichbar nicht ohne Reformen, vielleicht nicht ohne Revolution. Denn Unfreiheit der genannten Art gibt es bekanntlich nach wie vor in Hülle und Fülle, zumal in unserer globalisierten Welt. Der Kampf dagegen fordert Engage-ment in höchstem Maße, nicht nur politisch, sondern auch allgemein existenziell, körperlich, seelisch, geistig, geistlich. Nicht alle Menschen sind dazu fähig und bereit. Und die wirklich Bereiten stoßen allenthalben auf den Widerstand derjenigen, die das bestehende Unrecht, die herrschende Ungerechtigkeit, die grassierende Unfreiheit mit allen Mitteln verteidigen: politisch, militärisch, sozio-ökonomisch, psychologisch, unter Einschluss raffiniertester Machtmittel der Manipulation, offener und versteckter Einflussnahme im Sinne der herr-schenden Interessen, der Interessen der Herrschenden.
In dieser Lage befinden wir uns: zuweilen wie in einem Gefängnis (der Seele), oder auch: wie im eigenen Bewusstsein be- und ge-fangen. Wir treffen manchmal auf so viel Widerwärtiges, so viel bösen Widerstand gegen das Gute, dass wir an der eigenen Hoffnung zu verzweifeln drohen. Wir kommen zuweilen nicht voran, weder in der Theorie noch in der Praxis. Doch wir lassen uns gewiss das Denken nicht verbieten. Daher Zweitens Freiheit wozu? Zunächst zur Gedankenfreiheit. Wir denken, was wir wollen, was wir können, was uns zuteil wird, was uns gerade durch den Kopf geht, was uns einfällt. „Was fällt Dir denn ein?“, lautet eine bekannte kritische Alltags- und Allerwelts-Frage. Was uns einfällt, kann also nicht immer nur uns selbst betreffen, sondern auch unsere Mitmenschen. Wir können, dürfen und sollen alles denken, was wir wollen, müssen aber be-denken, dass wir mit unseren Gedanken nicht immer allein sind. Zumal dann nicht, wenn wir unsere Gedanken in Rede, Schrift und andere Taten umsetzen, kommunizieren. Dann – und nicht nur dann – müssen wir die Würde und die Freiheit unserer Mitmenschen, ihr Person-Sein, anerkennen und respektieren. Aber worin besteht nun diese Freiheit der Person, die ja sogar im Grundgesetz der BRD garantiert wird?
Für Kant ist die Person ein absoluter, unbedingter Wert, und ihre Freiheit, alles tun zu dürfen, wird nur durch die Freiheit der Anderen begrenzt. ‚Absolut‘ im Sinne von ‚unbedingt‘ bedeutet nicht die Loslösung der Person von allem anderen, wohl aber den Anspruch auf die zumindest denkmögliche Ganzheit des Menschen, „le volume total de l’homme“, seinen gesamten „Umfang“, wie es Emmanuel Mounier ausgedrückt hat. Wozu zweifellos auch alles gehört, was die Person im Laufe ihres Lebens erfährt, erlernt, erwirbt, durch eigenes Tun bewirkt, mithin die Persönlichkeit, die nicht von der leiblich-seelischen Konstitution der Person zu trennen ist.
Nicht sehr umfangreich, aber keineswegs belanglos sind die Ergebnisse des Libet-Experiments, zumal sie durch spätere Forschungen weitgehend bestätigt wurden. Sie besagen, kurz gefasst, dass unsere Entscheidungen nicht nur im Bewusstsein, sondern auch im Unbe-wussten vorbereitet werden, wobei das Bewusstsein keinesfalls entmündigt wird, weil, je nach Situation, immer eine mehr oder weniger große Marge der bewussten Entscheidungsfreiheit gewahrt bleibt. Folglich ist es unzulässig, zu behaupten, die Willensfreiheit sei eine Illusion.
Der Wille beruht sowohl auf unserem bewussten als auch unserem unbewusstes Sein. Er ist nicht identisch mit Trieben, Instinkten und Gefühlen, wird aber von diesen beeinflusst, z.B. in Form von Antrieben, Motiven und Beweggründen, deren Bedeutung Libet neu bestätigt hat. Darüber hinaus wird der Wille geprägt von Faktoren wie Zweckvorstellungen, dem Abwägen von Vor- und Nachteilen, Zielstrebigkeit, Entschlusskraft und Durchsetzungsfähigkeit. Wir können den Willen aus freien Stücken bewusst-rational beeinflussen und sogar steuern. In unseren willentlichen Handlungen machen wir von unserer Freiheit Gebrauch. Auch diese Tatsache geht ins Unterbewusste ein. Es gibt also Willensfreiheit, was auch Libet bestätigt hat. Dies im Gegensatz zu der theologischen Leugnung der Willensfreiheit, die sich ein Martin Luther, im Unterschied zu Erasmus von Rotterdam, nicht verkneifen konnte.
Zumindest die Willensfreiheit wird somit zur Voraussetzung auch von Ethik, Moral und Recht, so dass die hierarchische Werte-Ordnung sich nunmehr wie folgt gestaltet:
Demokratie
Recht
*
Moral
*
Ethik
*
(Willens-)Freiheit
*
Gut und Böse.
Gültig erneut in erster Linie in der Perspektive von unten nach oben. Denn auf dem Recht beruht zweifellos auch das Recht auf Selbstbestimmung und damit die Demokratie. Anders als Angela Merkel es annahm, sind Recht und Freiheit Voraussetzungen, nicht Folgen der Demokratie. Merkels eingangs zitierten Satz kann man also wie folgt abwandeln bzw. umkeh-ren: Ohne Freiheit gibt es kein Recht, keinen Rechtsstaat, keine Wahrung der Menschenrechte und keine Demokratie.
Was allerdings auch bedeutet: Wahre Demokratie kann es anscheinend erst dann geben, wenn die Freiheit und das Recht aller Menschen gewährleistet und gesichert sind.
Literaturhinweise
Bauer, Joachim 2019: Wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz, München
Habermann, Ernst 1996: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars, in: www.geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38...,
Libet, Benjamin 2005: Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt a.M.
Merkel, Angel 2024: Freiheit. Erinnerungen 1954-2021, Köln
Robra, Klaus 2020: Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München o.J. (2020), https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus 2022: Gut und Böse. Das Gute als Ursprung und Überwindung des Bösen – oder umgekehrt? Eine neue Hypothese, München, https://www.grin.com/document/1297008
[...]
1 Vgl. Habermann 1996, S. 31
2 Vgl. Robra 2022
3 Vgl. Robra 2020, S. 3 ff.
4 Bauer 2019, S. 8
5 https://wasistderunterschied.com/10-unterschied-zwischen-recht-und-ethik/
- Quote paper
- Klaus Robra (Author), 2024, Über Freiheit, Demokratie und Recht in ihrem wechselseitigen Verhältnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1553785