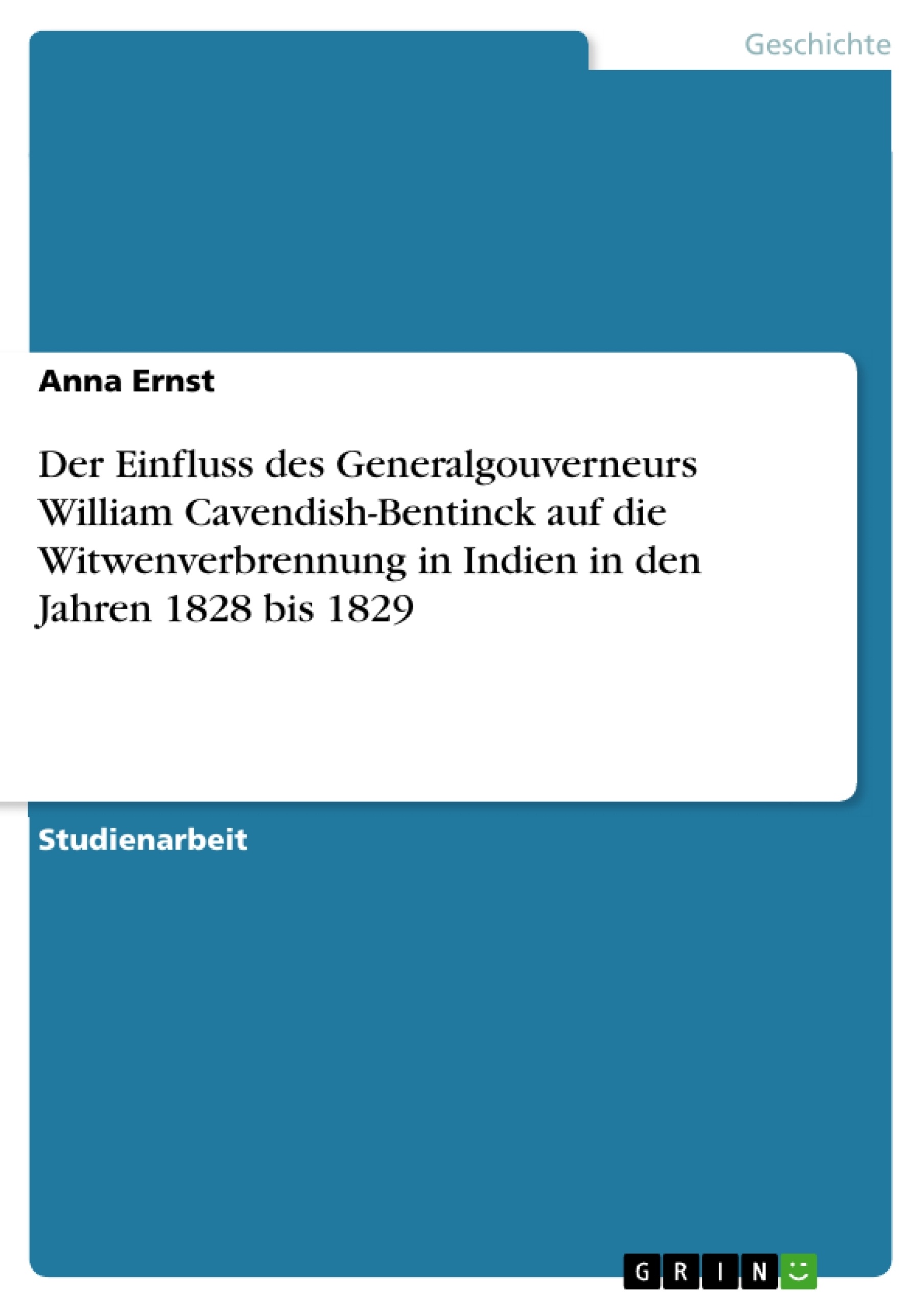Die folgende Arbeit beleuchtet den Einfluss des britischen Generalgouverneur Lord William Cavendish-Bentinck in Indien auf die sati-Praxis, die hinduistische Witwenverbrennung, in den Jahren 1828 und 1829. Dabei gilt es, vorab die hinduistische Praxis der Verbrennung der Witwen zu definieren und die westlichere Perspektive des Britischen Empire auf diese Praxis zu ergründen. Darauffolgend wird der Weg zur Regulation der Witwenverbrennung in den Jahren 1828 und 1829 dargelegt und der Einfluss des Generalgouverneurs sowie die finale Verordnung zur Abschaffung der sati-Praxis analysiert. Dies geschieht auf der Grundlage von Werken der Forschungsliteratur wie beispielsweise ‚Tödliche Rituale‘ und ‚Humanitarian achievement or administrative necessity?‘ von Jörg Fisch, ‚Sati Problem - Past and Present‘ von S.K. Pachauri und ‚Recht auf Leben, Recht auf Töten - Ein Kulturvergleich‘. Die Quellen ‚The Correspondence of Lord William Cavendish Bentinck‘ und ‚The essential writings of Raja Rammohan Ray‘ untermauern die Untersuchungen dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sati: Die hinduistische Praxis in Indien
- 3. Der westliche Blickwinkel des Britischen Empire auf die Sati-Praxis
- 4. Sati unter britischem Einfluss in den Jahren 1828-1829
- 4.1 Lord William Cavendish-Bentinck als Generalgouverneur
- 4.2 4. Dezember 1829 - Die Verordnung zur Abschaffung der Sati-Praxis
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Generalgouverneur Lord William Cavendish-Bentinck auf die Abschaffung der Sati-Praxis (Witwenverbrennung) in Indien zwischen 1828 und 1829. Sie beleuchtet die hinduistische Perspektive auf Sati, den westlichen Blick darauf und den Prozess der Regulierung und letztlichen Abschaffung dieses Rituals.
- Die hinduistische Praxis der Sati und ihre religiöse Bedeutung.
- Die Reaktion des Britischen Empire auf die Sati-Praxis und die ethischen Konflikte.
- Die Rolle von Lord William Cavendish-Bentinck bei der Abschaffung der Sati.
- Der rechtliche und politische Prozess der Verordnungserlassung.
- Der gesellschaftliche Druck und die Auswirkungen auf die betroffenen Witwen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Sati-Praxis und die Verordnung XVII vom 4. Dezember 1828 ein, welche die hinduistische Witwenverbrennung für illegal erklärte. Sie beschreibt die Sati-Praxis als ein Ritual, bei dem die Witwe sich mit dem Leichnam ihres verstorbenen Mannes verbrannte, und skizziert den langwierigen Prozess bis zu ihrem Verbot unter Lord William Cavendish-Bentinck. Die Arbeit wird als eine Analyse des Einflusses Bentincks auf die Sati-Praxis in den Jahren 1828 und 1829 angekündigt.
2. Sati - Die hinduistische Praxis in Indien: Dieses Kapitel definiert die Sati-Praxis aus hinduistischer Sicht. Es beschreibt Sati als ein tief verwurzeltes Ritual, bei dem die Witwe ihrem verstorbenen Mann in den Tod folgte. Es wird der Unterschied zwischen den Begriffen „Sahamarana“ und „Sati“ erläutert und die Vorstellung einer freiwilligen Handlung hervorgehoben, obwohl gesellschaftlicher Druck eine entscheidende Rolle spielte. Das Kapitel betont die Bedeutung der Hingabe der Ehefrau und das Versprechen der Erlösung im Jenseits. Die fehlende Trennung zwischen Exekutive und Jurisdiktion im damaligen Indien wird beleuchtet, ebenso wie die unterschiedlichen regionalen und kastenspezifischen strafrechtlichen Regelungen. Der Glaube an die Wiedergeburt und die damit verbundene brüchige Grenze zwischen Leben und Tod wird als wichtiger Kontextualisierungsfaktor dargestellt.
3. Der westliche Blickwinkel des Britischen Empire auf die Sati-Praxis: Dieses Kapitel (angenommen, es existiert im Originaltext) würde vermutlich den kulturellen und moralischen Konflikt zwischen der britischen Kolonialmacht und der hinduistischen Tradition beleuchten. Es würde die britische Empörung über die Sati-Praxis und die damit verbundenen ethischen Überlegungen darstellen, und wie diese mit den bestehenden politischen und administrativen Realitäten in Indien interagierten. Das Kapitel würde wahrscheinlich die unterschiedlichen Ansätze der britischen Regierung zur Regulierung der Sati beleuchten, und die Herausforderungen und Kompromisse, die mit der Einmischung in religiöse Bräuche einhergingen, hervorheben.
4. Sati unter britischem Einfluss in den Jahren 1828-1829: Dieses Kapitel würde die Ereignisse rund um die Abschaffung der Sati detailliert beschreiben. Es würde die Rolle von Lord William Cavendish-Bentinck als Generalgouverneur und seine Motivationen beleuchten. Der Prozess der Gesetzgebung, die politischen Debatten und die Herausforderungen bei der Umsetzung der Verordnung würden analysiert werden. Das Kapitel würde auch den Widerstand gegen die Verordnung und die verschiedenen Strategien der Kolonialverwaltung berücksichtigen. Schliesslich würde das Kapitel die Bedeutung des Datums 4. Dezember 1829 und die langfristigen Auswirkungen der Verordnung untersuchen.
Schlüsselwörter
Sati, Witwenverbrennung, Britisches Empire, Lord William Cavendish-Bentinck, Indien, Hinduismus, Kolonialismus, Religionsfreiheit, Menschenrechte, Verordnung XVII, 1828, 1829, westliche Sichtweise, kultureller Konflikt, gesellschaftlicher Druck.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau über eine Arbeit, die den Einfluss von Generalgouverneur Lord William Cavendish-Bentinck auf die Abschaffung der Sati-Praxis (Witwenverbrennung) in Indien zwischen 1828 und 1829 untersucht. Er beleuchtet die hinduistische Perspektive auf Sati, den westlichen Blick darauf und den Prozess der Regulierung und letztlichen Abschaffung dieses Rituals.
Was ist die Sati-Praxis?
Sati ist eine hinduistische Praxis, bei der sich eine Witwe freiwillig oder unter gesellschaftlichem Druck mit dem Leichnam ihres verstorbenen Mannes verbrennt.
Welche Rolle spielte Lord William Cavendish-Bentinck bei der Abschaffung der Sati-Praxis?
Lord William Cavendish-Bentinck war Generalgouverneur von Indien und spielte eine entscheidende Rolle bei der Abschaffung der Sati-Praxis durch die Verordnung XVII vom 4. Dezember 1829.
Welche Themen werden in dem Text behandelt?
Der Text behandelt die hinduistische Praxis der Sati und ihre religiöse Bedeutung, die Reaktion des Britischen Empire auf die Sati-Praxis, die Rolle von Lord William Cavendish-Bentinck bei der Abschaffung der Sati, den rechtlichen und politischen Prozess der Verordnungserlassung sowie den gesellschaftlichen Druck und die Auswirkungen auf die betroffenen Witwen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Thema?
Relevante Schlüsselwörter sind: Sati, Witwenverbrennung, Britisches Empire, Lord William Cavendish-Bentinck, Indien, Hinduismus, Kolonialismus, Religionsfreiheit, Menschenrechte, Verordnung XVII, 1828, 1829, westliche Sichtweise, kultureller Konflikt, gesellschaftlicher Druck.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema der Sati-Praxis und die Verordnung XVII vom 4. Dezember 1828 ein, welche die hinduistische Witwenverbrennung für illegal erklärte.
Was wird im Kapitel über die hinduistische Praxis der Sati behandelt?
Dieses Kapitel definiert die Sati-Praxis aus hinduistischer Sicht und beschreibt sie als ein tief verwurzeltes Ritual. Es erläutert den Unterschied zwischen "Sahamarana" und "Sati" und betont die Bedeutung der Hingabe der Ehefrau und das Versprechen der Erlösung im Jenseits.
Was würde das Kapitel über den westlichen Blickwinkel des Britischen Empire auf die Sati-Praxis behandeln?
Dieses Kapitel würde vermutlich den kulturellen und moralischen Konflikt zwischen der britischen Kolonialmacht und der hinduistischen Tradition beleuchten. Es würde die britische Empörung über die Sati-Praxis und die damit verbundenen ethischen Überlegungen darstellen.
Was würde das Kapitel über Sati unter britischem Einfluss in den Jahren 1828-1829 behandeln?
Dieses Kapitel würde die Ereignisse rund um die Abschaffung der Sati detailliert beschreiben. Es würde die Rolle von Lord William Cavendish-Bentinck als Generalgouverneur, den Prozess der Gesetzgebung, die politischen Debatten und die Herausforderungen bei der Umsetzung der Verordnung analysieren.
- Quote paper
- Anna Ernst (Author), 2024, Der Einfluss des Generalgouverneurs William Cavendish-Bentinck auf die Witwenverbrennung in Indien in den Jahren 1828 bis 1829, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1553072