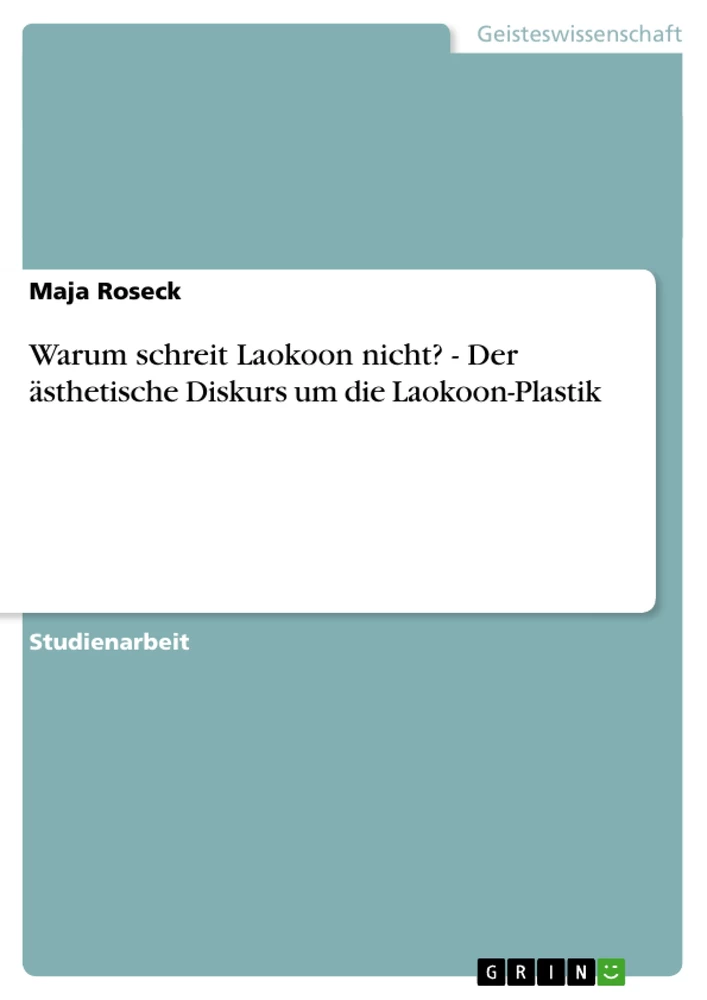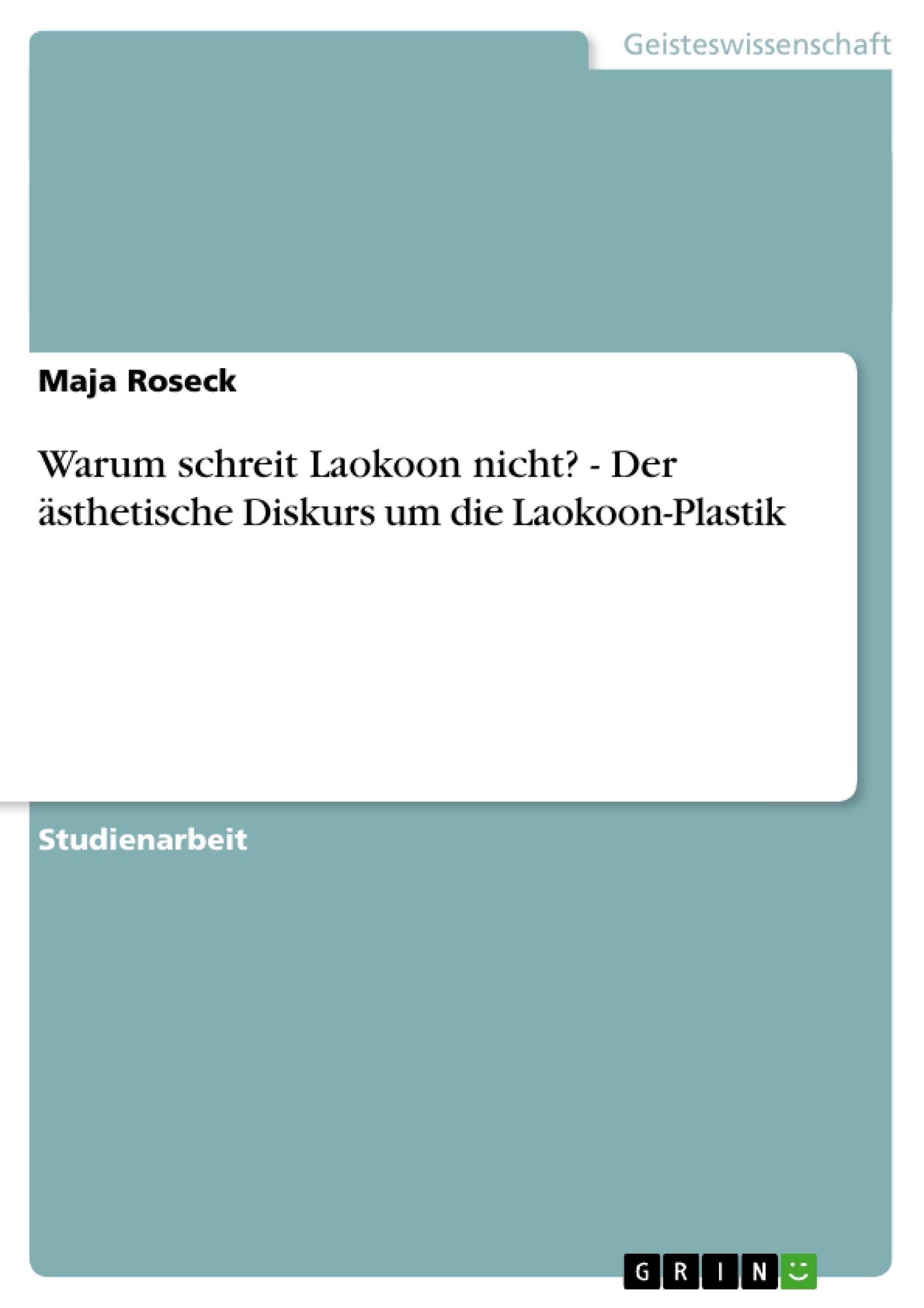"Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke." behauptet Johann Joachim Winckelmann 1755. Es gibt viele berühmte Meisterstücke der griechi-schen Antike, doch keines erhitzte die Gemüter im ästhetischen Diskurs mehr als die Plas-tik des Priesters Laokoon. So gilt diese Plastik sogar als Deutungsmuster der Kunstauffas-sungen der einzelnen Epochen und machte gleichzeitig die Antike zum Deutungsmuster der Moderne.
Deshalb ist es Ziel meiner Hausarbeit, den ästhetischen Diskurs um die Laokoon-Plastik genauer zu beleuchten. Dabei werde ich zunächst auf den Mythos des Laokoon und die davon inspirierte Plastik eingehen, um mich dann mit den Standpunkten von Winckel-mann, Lessing, Goethe, Schiller und Herder auseinanderzusetzen. Abschließend soll die Frage "Warum schreit Laokoon nicht?" erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Mythos
- 2. Die Plastik
- 2.1 Die griechische Plastik
- 2.2 Die Laokoon-Plastik
- 3. Der kulturästhetische Diskurs um die Laokoon-Plastik
- 3.1 Winckelmann
- 3.2 Lessing
- 3.3 Herder, Goethe und Schiller
- 3.4 Warum schreit Laokoon nicht?
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beleuchtet den ästhetischen Diskurs um die Laokoon-Plastik. Ziel ist es, den Mythos des Laokoon und die daraus entstandene Plastik zu untersuchen und die unterschiedlichen Standpunkte von Winckelmann, Lessing, Goethe, Schiller und Herder zu analysieren. Die zentrale Frage lautet: "Warum schreit Laokoon nicht?".
- Der Mythos des Laokoon und seine Darstellung in der Kunst
- Die Entwicklung der griechischen Plastik
- Die Interpretation der Laokoon-Plastik durch verschiedene Künstler und Denker
- Die Rolle der Laokoon-Plastik im ästhetischen Diskurs verschiedener Epochen
- Die Frage nach dem Ausdruck und der Ästhetik in der Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: Warum schreit Laokoon nicht? Sie verortet die Laokoon-Plastik als zentrales Werk im ästhetischen Diskurs und kündigt die Analyse des Mythos, der Plastik selbst und der Interpretationen durch verschiedene Denker an. Winckelmanns Zitat über die „edle Einfalt und stille Größe“ griechischer Kunst wird als Ausgangspunkt für die Betrachtung der Laokoon-Plastik verwendet, welche als Deutungsmuster für Kunstauffassungen verschiedener Epochen dient.
1. Der Mythos: Dieses Kapitel beschreibt den Mythos um Laokoon, den trojanischen Priester des Apollon. Laokoons Warnung vor dem trojanischen Pferd und sein Tod durch die Schlangen des Poseidon werden detailliert geschildert. Die unterschiedlichen Versionen des Mythos, eine von Sophokles und eine von Vergil, werden präsentiert, wobei die unterschiedlichen Gründe für Poseidons Zorn beleuchtet werden. Das Kapitel endet mit der Beschreibung, wie das Motiv des sterbenden Laokoon später in der Kunst aufgegriffen wurde, und legt somit die Grundlage für die nachfolgende Betrachtung der Plastik.
2. Die Plastik: Das Kapitel beginnt mit einer Erörterung der Entwicklung der griechischen Plastik, beginnend mit der archaischen Periode und ihren Charakteristika wie dem „archaischen Lächeln“ und der Verwendung neuer Materialien. Die Entwicklung zur frühklassischen und hochklassischen Periode wird nachvollzogen, wobei die Veränderung des Ausdrucks von Starrheit zu Dynamik und Harmonie hervorgehoben wird. Die Einführung des Kontrapost als Gestaltungsprinzip wird erläutert. Der Übergang zur Plastik des 4. Jahrhunderts v. Chr. und die dargestellten Emotionen wie Trauer und Tod werden beschrieben. Das Kapitel endet mit der Entstehung der Laokoon-Gruppe im Kontext des Niedergangs der griechischen Plastik und dem Aufkommen des Klassizismus.
Schlüsselwörter
Laokoon, Plastik, griechische Antike, ästhetischer Diskurs, Winckelmann, Lessing, Herder, Goethe, Schiller, Mythos, Kunstinterpretation, Ausdruck, Ästhetik, Stilentwicklung
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Der ästhetische Diskurs um die Laokoon-Plastik
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den ästhetischen Diskurs um die Laokoon-Plastik. Sie analysiert den Mythos des Laokoon, die Plastik selbst und die unterschiedlichen Interpretationen dieser durch bedeutende Denker wie Winckelmann, Lessing, Goethe, Schiller und Herder. Die zentrale Fragestellung lautet: "Warum schreit Laokoon nicht?".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Mythos des Laokoon, die Entwicklung der griechischen Plastik, die Interpretation der Laokoon-Plastik durch verschiedene Künstler und Denker, die Rolle der Laokoon-Plastik im ästhetischen Diskurs verschiedener Epochen und die Frage nach dem Ausdruck und der Ästhetik in der Kunst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Mythos, Die Plastik (inkl. Unterkapitel zur griechischen Plastik und der Laokoon-Plastik), Der kulturästhetische Diskurs um die Laokoon-Plastik (inkl. Unterkapitel zu Winckelmann, Lessing, Herder, Goethe und Schiller, sowie der Frage "Warum schreit Laokoon nicht?") und Zusammenfassung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit ("Warum schreit Laokoon nicht?") vor, verortet die Laokoon-Plastik im ästhetischen Diskurs und kündigt die Analyse des Mythos, der Plastik und der Interpretationen verschiedener Denker an. Winckelmanns Zitat über die „edle Einfalt und stille Größe“ wird als Ausgangspunkt genutzt.
Wie wird der Mythos des Laokoon dargestellt?
Das Kapitel "Der Mythos" beschreibt den Mythos um den trojanischen Priester Laokoon, seine Warnung vor dem trojanischen Pferd und seinen Tod durch die Schlangen des Poseidon. Es werden unterschiedliche Versionen des Mythos (Sophokles und Vergil) und die Gründe für Poseidons Zorn beleuchtet. Die spätere künstlerische Rezeption des Motivs wird ebenfalls dargestellt.
Wie wird die Entwicklung der griechischen Plastik beschrieben?
Das Kapitel "Die Plastik" behandelt die Entwicklung der griechischen Plastik von der archaischen Periode mit ihren Charakteristika (archaisches Lächeln, Materialverwendung) über die früh- und hochklassische Periode (Kontrapost, Dynamik, Harmonie) bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. Die Darstellung von Emotionen wie Trauer und Tod wird ebenso beleuchtet wie der Kontext der Entstehung der Laokoon-Gruppe.
Welche Denker werden im Kontext der Laokoon-Plastik analysiert?
Die Arbeit analysiert die Interpretationen der Laokoon-Plastik durch Johann Joachim Winckelmann, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Ihre unterschiedlichen Standpunkte werden verglichen und kontrastiert.
Was ist die zentrale Frage der Arbeit?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet: "Warum schreit Laokoon nicht?". Diese Frage dient als roter Faden durch die Analyse des ästhetischen Diskurses um die Laokoon-Plastik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Laokoon, Plastik, griechische Antike, ästhetischer Diskurs, Winckelmann, Lessing, Herder, Goethe, Schiller, Mythos, Kunstinterpretation, Ausdruck, Ästhetik, Stilentwicklung.
- Arbeit zitieren
- Maja Roseck (Autor:in), 2003, Warum schreit Laokoon nicht? - Der ästhetische Diskurs um die Laokoon-Plastik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15527