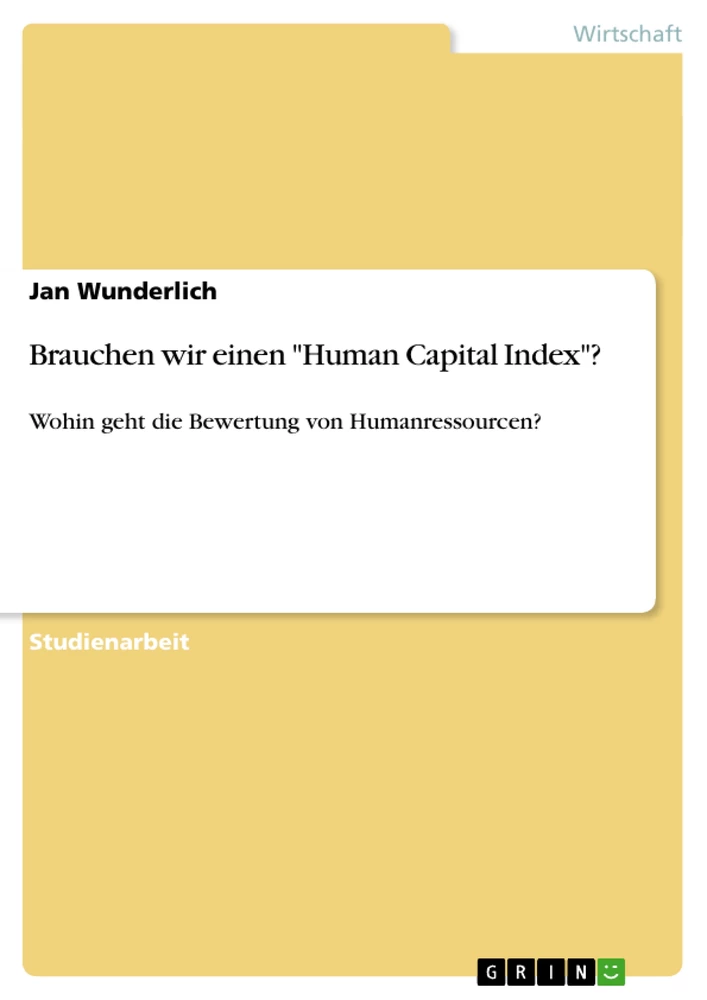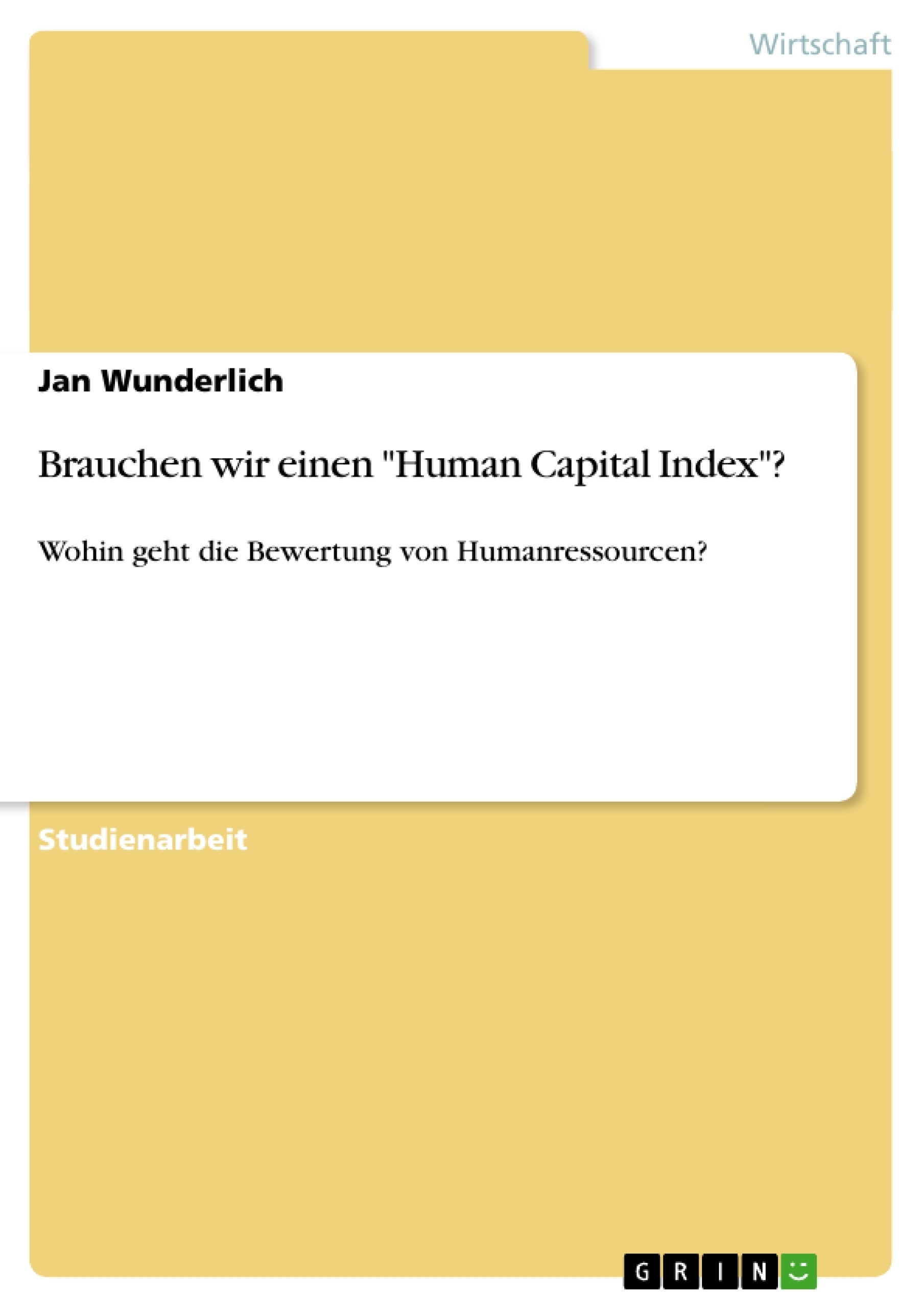Die aktuelle Diskussion um Humankapital reicht von entschiedener Ablehnung jedes Versuches dem Menschen, oder den ihm innewohnenden Eigenschaften und Fähigkeiten, einen Geldwert gegenüberzustellen, über wissenschaftliche und pragmatisch ausgerichtete Diskussionen zu dem Thema, bis hin zu hoffnungsvoller Euphorie, mit diesem Zahlenwert den Faktor Mensch in volks- und betriebswirtschaftliche Betrachtungsweisen aussagekräftig einzubinden.
Argumente und Emotionen nähren sich dabei aus einem reichhaltigen Fundus unterschiedlicher Weltanschauungen und Betrachtungsschwerpunkte.
Das Ziel vorliegender Arbeit ist die kritische Betrachtung eines Humankapitalindexes hinsichtlich seiner „Brauchbarkeit“ und Gefahren im Kontext unternehmerischer Bewertung von Humanressourcen. Die Individualperspektive wird dabei nicht berücksichtigt. Volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte werden nur in der Begriffsklärung und Diskussion peripher erwähnt und erfahren keine differenzierte Betrachtung.
Inhalt
1 Einleitung und Ziel der Arbeit
2 Humankapital - Allgemeine Begriffsbestimmung und Abgrenzung
3 Humankapital in Volks- und Betriebswirtschaft
3.1 Theoretische Grundlagen zur Berechnung von Humankapital
3.2 Ansätze zur Bewertung und deren Aussagekraft
4 Brauchen wir einen Human Capital Index?
4.1 Humankapital im modernen Personalmanagement
5 Zusammenfassung und Fazit
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung und Ziel der Arbeit
Die aktuelle Diskussion um Humankapital reicht von entschiedener Ablehnung jedes Versuches dem Menschen, oder den ihm innewohnenden Eigenschaften und Fähigkeiten, einen Geldwert gegenüberzustellen, über wissenschaftliche und pragmatisch ausgerichtete Diskussionen zu dem Thema, bis hin zu hoffnungsvoller Euphorie, mit diesem Zahlenwert den Faktor Mensch in volks- und betriebswirtschaftliche Betrachtungsweisen aussagekräftig einzubinden.
Argumente und Emotionen nähren sich dabei aus einem reichhaltigen Fundus unterschiedlicher Weltanschauungen und Betrachtungsschwerpunkte.
Auf der einen Seite stehen rigorose Ablehnung allein schon des Wortes Humankapital, welches von der „Sprachkritische Aktion Unwort des Jahres“ der Goethe Universität Frankfurt am Main zum Unwort des Jahres 2004 gekürt wurde. Wobei die Jury damit nicht die „ehrwürdige Tradition des Begriffes Humankapital“1 (in der Wissenschaftsgeschichte, Anm. d. Verf.) kritisiert, sondern die derzeitige Verwendung, auch außerhalb der Wirtschaftsfachsprache. Dieser Umgang „fördert damit die primär ökonomische Bewertung aller denkbaren Lebensbezüge, wovon auch die aktuelle Politik immer mehr beeinflusst wird. Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen.“2 Die Autoren führen weiter aus: „Realität ist doch wohl, dass das »Humankapital« grundsätzlich dem »shareholder value« untergeordnet wird. Auch die um sich greifende Umschreibung von Arbeitkräften als »human resources« (gelegentlich sogar als »personelle Rationalisierungsreserve«) ist mehr als entlarvend.“3
Dieser Position entgegen gesetzt wird der Begriff Humankapital von anderer Seite als Aufwertung gegenüber der herkömmlichen Betrachtung des Menschen und dessen Arbeitseinsatzes als Kostenfaktor beschrieben. In der Bewertung als Humankapital erfahre der Mensch eine differenzierte Betrachtung und Wertschätzung in seiner zentralen Rolle bei der Erzeugung von wirtschaftlichen Gütern. Beispielhaft für diese Position schreiben STEINHÜBEL und DISTEL: „Richtig verstanden sind es gerade der Mensch und die von ihm ausgehenden Wertschöpfungspotenziale, die in einem von internationalem Wettbewerb, Technologisierung und verkürzten Produktlebenszyklen geprägten Umfeld von existenzentscheidender Bedeutung für Unternehmen sind“4, und unterstellen der Frankfurter Unwort-Jury „ethische, kulturelle, soziale und ökonomische Fehlschlüsse.“5 Auf den Seiten des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, wo auch die Saarbrücker Formel erdacht wurde, wird die Frankfurter Kritik am Wort Humankapital als „typisches Beispiel von Ignoranz“6 bezeichnet. Diese stelle „(...) die Trivialgleichung »Human + Kapital = Messung von Persönlichkeit in Euro = moralisch fragwürdig« (auf). Moralisch fragwürdig ist (so der Lehrstuhl - Anm. d. Verf.) in diesem Fall allenfalls das Weltbild der Jury.“7
Zwischen diesen beiden Polen lassen sich vielfältige Positionen identifizieren, die vor teilweise sehr unterschiedlichen fachlichen und weltanschaulichen Hintergründen vertreten werden und mit dem Begriff Humankapital unterschiedliche Inhalte assoziieren. Die daraus resultierende Unschärfe des Begriffes Humankapital und inhaltlich naher Begriffe erschwert die Diskussion. In Kapitel 2 wird der Versuch einer vorläufigen Definition und Abgrenzung unternommen, als Grundlage für eine weitere Präzisierung im Verlauf der Arbeit, um schließlich in Kapitel 4 eine Diskussion zu ermöglichen.
Das Ziel vorliegender Arbeit ist die kritische Betrachtung eines Humankapitalindexes hinsichtlich seiner „Brauchbarkeit“ und Gefahren im Kontext unternehmerischer Bewertung von Humanressourcen. Die Individualperspektive wird dabei nicht berücksichtigt. Volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte werden nur in der Begriffsklärung und Diskussion peripher erwähnt und erfahren keine differenzierte Betrachtung.
2 Humankapital - Allgemeine Begriffsbestimmung und Abgrenzung
Während davon ausgegangen werden kann, dass im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff human für die vorliegende Arbeit genügend einvernehmlich als menschlich, den Menschen betreffend interpretiert wird, ist diese übereinstimmende Deutung für die Begriffe Kapital und insbesondere Humankapital nicht gegeben. SOYKA schlägt eine Definition von Humankapital und inhaltlich naher Begriffe vor, die hier vereinfacht wiedergegeben werden soll um als Grundlage für den Versuch einer schematischen Darstellung des Themenkomplexes zu dienen:
„ Intellektuelles Potenzial beschreibt die von einem Menschen in den individuellen und gesellschaftlichen Lernprozess eingebrachten intellektuellen und psychosozialen Fähigkeiten, Talente und Möglichkeiten (...).“8
„ Humankapital entsteht in einem nie abgeschlossenen, also lebenslangen Sozialisations- und Bildungsprozess auf der Grundlage des in jedem Individuum in unterschiedlicher Ausprägung vorhandenen »Intellektuellen Potenzials« . (...). Qualität und Quantität des individuell entstehenden und ständigen Veränderungsprozessen unterliegenden Humankapitals sind abhängig von einem permanenten Vorgang der Synthese von Intellektuellem Potenzial, bereits kumuliertem Humankapital, Einflüssen der Sozialisationsbiographie, sowie empfangener Bildung und Ausbildung. Im Ergebnis kann Humankapital definiert werden, als das in einem permanenten Bildungsprozess erworbene Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums, die dieses zu einem bestimmten Zeitpunkt in den gesellschaftlichen bzw. ökonomischen Prozess einzubringen imstande ist.“9
Weiterhin unterscheidet SOYKA „zwischen dem akkumulierten Humankapital eines Menschen und dem Umfang des tatsächlich in den Wirtschaftsprozess einfließenden Humankapitals. Der Transferprozess von Humankapital auf die Prozessebene eines Unternehmens oder einer Organisation ist jedoch (...) nicht ohne gleichzeitigen Einsatz von »Intellektuellem Vermögen« möglich.“10
„Das Intellektuelle Vermögen eines Menschen impliziert die emotional gesteuerte Bereitschaft, vorhandenes Humankapital, getragen von Motivation und Verantwortungsbewusstsein, einer Organisation bzw. einem Unternehmen vollständig zur Verfügung zur stellen. Nicht zu unterschätzende Einflüsse auf die Entstehung von intellektuellem Vermögen gehen dabei auch von dem »Sozialkapital« des gesellschaftlichen Umfelds aus, das durch gemeinsame Grundwerte, tradierte Regeln, verbindliche Normen, gegenseitiges Vertrauen, Beziehungsnetze, sozialen Frieden und Gemeinwohlorientierung bestimmt wird.“11 („Vermögen“ ist bei SOYKA hier also nicht im Sinne der betriebswirtschaftlichen Verwendung des Vermögensbegriffes gemeint, sondern in der Bedeutung „können“, „etwas zu tun vermögen“. Für die vorliegende Arbeit wird zur besseren Unterscheidung für SOYKA’s Intellektuelles Vermögen der Begriff Intellektuelles (Einsatz-) Vermögen verwendet.)
„Aus der Summe (besser: aus der funktionalen Verknüpfung, Anm. d. Verf.) von Humankapital und Intellektuellem Vermögen ergibt sich das tatsächlich dem Unternehmen oder der Organisation zur Verfügung stehende Humanpotenzial.“12 Damit meint SOYKA „alle im Individuum angelegten Potenziale (...), die einem bestimmten Unternehmen oder einer Organisation zur Verfügung gestellt werden könnten oder tatsächlich zur Verfügung gestellt werden.“13
Intellectual Capital definiert SOYKA „als die sich in einem permanenten Lern- und Arbeitsprozess entwickelnden Ergebnisse der Synergien organisationaler Humanpotenziale mit dem organisationseigenen Strukturkapital.“14
In Abbildung 1 (Seite 5) sind SOYKA’s allgemeine Überlegungen im betriebswirtschaftlichen Kontext immateriellen Vermögens zusammengefasst dargestellt.
3 Humankapital in Volks- und Betriebswirtschaft
In der Volkswirtschaft wird Kapital „(...) definiert als Produktionsfaktor neben Arbeit und Boden. Unter Kapital wird in diesem Zusammenhang der Bestand an Produktionsausrüstung verstanden, der zur Güter- und Dienstleistungsproduktion eingesetzt werden kann (Kapitalstock)“, bzw. „als Geld für Investitionszwecke“. 15
In der klassischen Betriebswirtschaft sieht SCHMALENBACH Kapital als die abstrakte Wertsumme der Bilanz.16 Die Bilanz gibt auf der Aktivseite (Anlage-, Umlaufvermögen) Auskunft über die Mittelverwendung und auf der Passivseite (Eigenkapital, Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Beide Seiten weisen die gleiche Summe auf, und stellen jede für sich den Buchwert eines Unternehmens unter unterschiedlichen Perspektiven dar.
Im Sinne der volkswirtschaftlichen Definition von Kapital legt der Begriff Humankapital eine Interpretation der dem Menschen innewohnenden Eigenschaften und Fähigkeiten als Produktionsausrüstung im weitesten Sinne nahe. Dabei spielt es zunächst keine Rolle wo diese Eigenschaften und Fähigkeiten herkommen. Nach dieser Interpretation bietet sich eine Definition an, wie von der OECD 1998 in ihrem Report zum Human Capital Investment vorgenommen:
(A) „ (...) this report adopts the following meaning: the knowledge, skills, competences and other attributes embodied in individuals that are relevant to economic activity“17.
In Abgrenzung zur Arbeit, welche konkrete Tätigkeiten umfasst, die entweder unmittelbar der Einkommenserzielung dienen18, oder in allgemeinerer Fassung auf die Befriedigung der Bedürfnisse fremder Personen gerichtet ist19, stellt das Humankapital nach dieser Definition ein Potential dar, dessen wertschöpfende Entfaltung separat behandelt werden muss.
Die betriebswirtschaftliche Definition von Kapital ist eng mit dem betrieblichen Rechnungswesen verknüpft. Dabei wird für die vorliegende Arbeit zwischen der von formalen Normen diktierten, bilanziell-externen Rechnungslegung auf der einen Seite und dem unternehmens-internen Controlling auf der anderen Seite unterschieden.
Für Unternehmen in modernen, post-industriellen Volkswirtschaften lässt sich häufig eine erhebliche Wertlücke feststellen zwischen bilanziellem Buchwert und durch Unternehmensverkauf zu erzielendem Marktwert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 20
Abbildung 1: Begriffsbestimmung und Abgrenzung - Intellektuelles Potenzial, Humankapital, Intellektuelles Vermögen, Humanpotenzial, Immaterielles Vermögen / Intellectual Capital 21 Quelle: Eigene Darstellung
[...]
1 Goethe Universität Frankfurt am Main. Sprachkritische Aktion Unwort des Jahres, online im Internet: http://www.uni- frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/histSprw/ehemalige/Schlosser/unwortdesjahres/unwoerter/2004.html
2 ebenda
3 ebenda
4 Steinhübel /Distel (2007), S. 3
5 ebenda
6 Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Universität des Saarlandes - Pressemitteilung vom 19.01.2005
7 ebenda
8 Soyka (2006), S. 53 (Hervorh. nicht im Original)
9 Soyka (2006), S. 53ff (Hervorh. nicht im Original)
10 Soyka (2006), S. 53ff (Hervorh. nicht im Original)
11 ebenda
12 ebenda
13 ebenda
14 ebenda
15 Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Kapital, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54789/kapital-v3.html
16 Schmalenbach (1961), zitiert nach Wikipedia, online im Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kapital
17 OECD (1998), zitiert nach Soyka (2006)
18 Vgl. Fischbach (2003), zitiert nach. Wikipedia, online im Internet: fttp://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Volkswirtschaftslehre)
19 Vgl. Hanusch, Kuhn, Kantner (2002), zitiert nach Wikipedia, online im Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Volkswirtschaftslehre)
20 Vgl. Persch (2003), S. 97 u. S. 229
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit über Humankapital?
Die Arbeit behandelt das Thema Humankapital, seine Definition, Abgrenzung und Bedeutung in Volks- und Betriebswirtschaft. Sie diskutiert die Kontroverse um den Begriff, die Bewertung von Humankapital und die Notwendigkeit eines Human Capital Index im Kontext des modernen Personalmanagements.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist die kritische Betrachtung eines Humankapitalindexes hinsichtlich seiner Brauchbarkeit und Gefahren im Kontext unternehmerischer Bewertung von Humanressourcen. Die Individualperspektive wird dabei nicht berücksichtigt.
Wie wird Humankapital definiert?
Die Arbeit zitiert verschiedene Definitionen, u.a. von der OECD (Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen und andere Eigenschaften von Individuen, die für die Wirtschaft relevant sind) und von Soyka (erworbenes Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums, das dieses zu einem bestimmten Zeitpunkt in den gesellschaftlichen bzw. ökonomischen Prozess einzubringen imstande ist).
Was ist der Unterschied zwischen Humankapital, Intellektuellem Potenzial und Intellektuellem Vermögen (Einsatzvermögen)?
Die Arbeit stellt die Definitionen von Soyka dar:
- Intellektuelles Potenzial: Fähigkeiten, Talente und Möglichkeiten eines Menschen.
- Humankapital: Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in einem lebenslangen Lernprozess erworben werden.
- Intellektuelles (Einsatz-) Vermögen: Die Bereitschaft, das Humankapital einer Organisation zur Verfügung zu stellen, getragen von Motivation und Verantwortungsbewusstsein.
- Humanpotenzial: Die Summe aus Humankapital und intellektuellem Einsatzvermögen, das einem Unternehmen zur Verfügung steht.
Welche Kritik gibt es am Begriff "Humankapital"?
Kritiker sehen im Begriff eine Degradierung des Menschen zu einer ökonomisch interessanten Größe und eine Unterordnung unter den Shareholder Value. Es wird befürchtet, dass dadurch die primär ökonomische Bewertung aller Lebensbereiche gefördert wird.
Welche Argumente sprechen für den Begriff "Humankapital"?
Befürworter sehen im Begriff eine Aufwertung des Menschen und seiner Arbeit als zentralen Faktor bei der Wertschöpfung. Sie argumentieren, dass er eine differenzierte Betrachtung und Wertschätzung der menschlichen Fähigkeiten ermöglicht.
Wie wird Kapital in Volks- und Betriebswirtschaft definiert?
In der Volkswirtschaft ist Kapital ein Produktionsfaktor neben Arbeit und Boden. In der Betriebswirtschaft ist Kapital die abstrakte Wertsumme der Bilanz.
Was ist die Wertlücke zwischen Buchwert und Marktwert von Unternehmen?
Die Wertlücke beschreibt die Differenz zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert eines Unternehmens und dem höheren Marktwert, der durch einen Unternehmensverkauf erzielt werden könnte. Dies deutet oft auf immaterielle Werte hin, die in der Bilanz nicht vollständig erfasst werden.
- Quote paper
- Jan Wunderlich (Author), 2010, Brauchen wir einen "Human Capital Index"?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155264