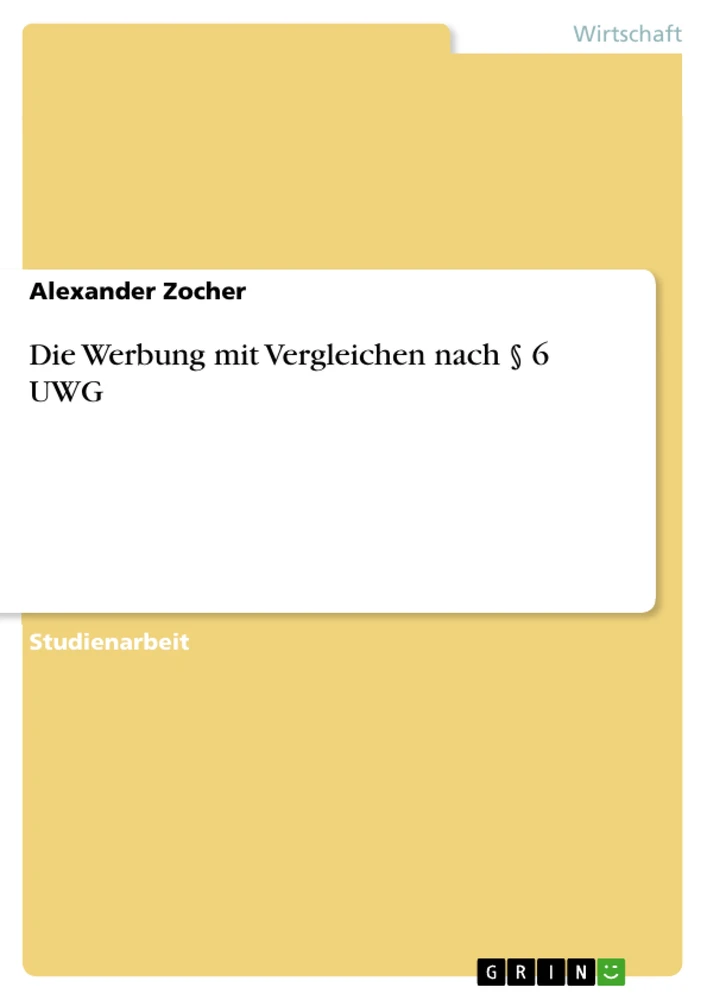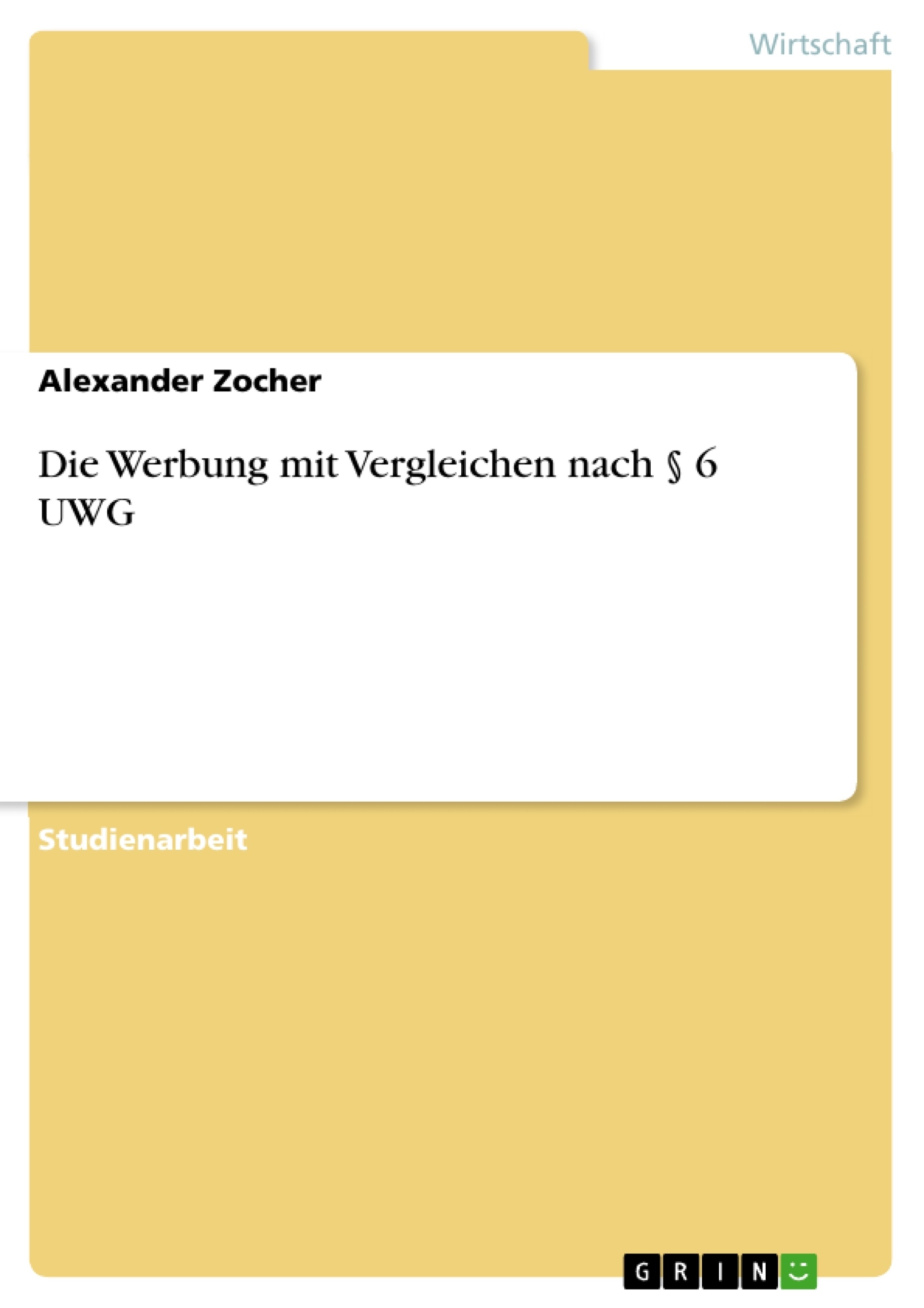Vergleichende Werbung war in der deutschen Rechtsprechung lange Zeit grundsätzlich unzulässig. Erst mit der RL 97/55/EG über vergleichende Werbung im Rahmen der europäischen Harmonisierungsbemühungen wurde diese Werbeform in Deutschland als
grundsätzlich zulässig erklärt. Obwohl dies schon fast ein Jahrzehnt her ist, hat sich die vergleichende Werbung als Instrument der Kommunikationspolitik von Unternehmen immer noch nicht endgültig durchgesetzt. Große, flächendeckende Kampagnen sind nur sehr selten zu finden. Der verhaltene Einsatz vergleichender Werbung ist auf den ersten Hinblick überraschend, da dieses vergleichsweise neue Instrument den grundsätzlichen Zielen und Anforderungen der Kommunikationspolitik, nämlich einer erhöhten Aufmerksamkeit und einer klaren Abgrenzung von Konkurrenzprodukten, in idealer Weise gerecht zu werden. Bei genauerem Betrachten der Thematik lässt sich diese Zurückhaltung jedoch teilweise erklären. Einerseits ist die Wirkung vergleichender Werbung noch immer nicht ausreichend erforscht, anderseits herrscht eine gewisse rechtliche Unsicherheit, die auf der immer noch sehr stark ausgeprägten Reglementierung und einer Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe beruht. Das Ziel
dieser Arbeit ist es, die vergleichende in diese Richtung hin näher zu beleuchten. Zu Beginn gilt es, vergleichende Werbung und ihre Erscheinungsformen zu definieren. Im Anschluss daran soll die gesetzliche Entwicklung der vergleichenden Werbung anhand
der wichtigsten Richtlinien der EG dargestellt werden. Kernelement der Arbeit ist die Regelung der vergleichenden Werbung in Deutschland und die damit verbundene Erörterung der Legaldefinition sowie der Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 6 UWG. Hierbei spielt auch der Bezug der vergleichenden Werbung zu anderen Normen des
Wettbewerbsrechts und die Rechtsfolgen im Falle einer unlauteren vergleichenden Werbung eine Rolle. Abschließend sollen die Chancen und Risiken, die mit dem Einsatz vergleichender Werbung verbunden sind, theoretisch sowie auch an Praxisbeispielen dargestellt und bilanziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Werbung und der vergleichenden Werbung
- 2.1 Die Begriffe Werbung und vergleichende Werbung
- 2.3 Erscheinungsformen vergleichender Werbung
- 2.3.1 Indirekt vergleichende Werbung
- 2.3.2 Direkt vergleichende Werbung
- 3. Die geschichtliche Entwicklung vergleichender Werbung
- 3.1 Die RL 84/450/EGW über irreführende Werbung
- 3.2 RL 97/55/EG über vergleichende Werbung
- 3.3 Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken
- 3.4 RL 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung
- 4. Vergleichende Werbung nach § 6 UWG
- 4.1 Legaldefinition, § 6 I UWG
- 4.1.1 Werbung
- 4.1.2 Mitbewerber
- 4.1.3 Waren oder Dienstleistungen
- 4.1.4 Erkennbarkeit
- 4.2 Die Zulässigkeitsvoraussetzungen vergleichender Werbung nach § 6 II UWG
- 4.2.1 Die Vergleichbarkeit von Waren oder Dienstleistungen
- 4.2.2 Voraussetzungen des Eigenschaftsvergleichs
- 4.2.3 Vermeidung von Verwechslungen
- 4.2.4 Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung
- 4.2.5 Herabsetzung oder Verunglimpfung
- 4.2.6 Verbot von Imitationswerbung
- 4.3 Das Verhältnis des § 6 UWG zu anderen Vorschriften des UWG
- 4.3.1 Das Verhältnis zur Generalklausel, § 3 I UWG
- 4.3.2 Das Verhältnis zur Irreführung, § 5 UWG
- 4.4 Verfahrensrechtliche Vorgaben der vergleichenden Werbung
- 4.4.1 Beweislast
- 4.4.2 Rechtsfolgen und Klagebefugnis
- 4.1 Legaldefinition, § 6 I UWG
- 5. Der Einsatz vergleichender Werbung in der Praxis
- 5.1 Chancen vergleichender Werbung
- 5.2 Risiken vergleichender Werbung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die vergleichende Werbung in Deutschland. Ziel ist es, die Rechtslage und die praktischen Aspekte dieser Werbeform zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Definition und Erscheinungsformen vergleichender Werbung, deren historische Entwicklung im Lichte europäischer Richtlinien und schließlich die Regulierung nach deutschem Recht (§ 6 UWG).
- Definition und Erscheinungsformen vergleichender Werbung
- Historische Entwicklung der vergleichenden Werbung im europäischen Kontext
- Regulierung der vergleichenden Werbung nach § 6 UWG
- Beziehungen zu anderen Normen des Wettbewerbsrechts
- Chancen und Risiken der vergleichenden Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der vergleichenden Werbung ein und stellt fest, dass diese Werbeform in Deutschland, trotz ihrer grundsätzlichen Zulässigkeit durch die RL 97/55/EG, noch immer zurückhaltend eingesetzt wird. Dies wird auf mangelnde Forschung zu ihrer Wirksamkeit und rechtliche Unsicherheiten aufgrund der komplexen Regulierung zurückgeführt. Die Arbeit skizziert ihren Fokus auf die Definition, die rechtliche Entwicklung und die Chancen sowie Risiken der vergleichenden Werbung.
2. Grundlagen der Werbung und der vergleichenden Werbung: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen. Es klärt die Begriffe "Werbung" und "vergleichende Werbung" und erläutert verschiedene Erscheinungsformen, wie indirekte und direkte vergleichende Werbung. Diese Klärung der Terminologie ist essentiell für die spätere Analyse der rechtlichen Regelungen.
3. Die geschichtliche Entwicklung vergleichender Werbung: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung der Rechtslage zur vergleichenden Werbung nach, beginnend mit der Richtlinie 84/450/EGW über irreführende Werbung, über die Richtlinie 97/55/EG über vergleichende Werbung bis hin zu den Richtlinien 2005/29/EG und 2006/114/EG über unlautere Geschäftspraktiken bzw. irreführende und vergleichende Werbung. Der Fokus liegt auf der schrittweisen Harmonisierung des europäischen Rechts in diesem Bereich.
4. Vergleichende Werbung nach § 6 UWG: Das Kernstück der Arbeit analysiert die deutsche Rechtslage zur vergleichenden Werbung gemäß § 6 UWG. Es werden die Legaldefinition, die Zulässigkeitsvoraussetzungen und das Verhältnis zu anderen Normen des UWG detailliert untersucht. Die Analyse der Zulässigkeitsvoraussetzungen (Vergleichbarkeit, Vermeidung von Verwechslungen, etc.) und die Diskussion der Rechtsfolgen im Falle unlauterer Werbung bilden den Schwerpunkt dieses Kapitels.
5. Der Einsatz vergleichender Werbung in der Praxis: Dieses Kapitel bewertet die Chancen und Risiken des Einsatzes vergleichender Werbung in der Praxis. Es wägt die potenziellen Vorteile (z.B. erhöhte Aufmerksamkeit, Abgrenzung von Konkurrenzprodukten) gegen die Risiken (z.B. rechtliche Auseinandersetzungen, Rufschädigung) ab und bietet einen umfassenden Überblick über die praktischen Implikationen.
Schlüsselwörter
Vergleichende Werbung, § 6 UWG, Wettbewerbsrecht, Rechtsprechung, Europäische Richtlinien, Irreführung, Zulässigkeitsvoraussetzungen, Chancen, Risiken, Markenrecht, Warenzeichen.
FAQ: Vergleichende Werbung in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die vergleichende Werbung in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Analyse der vergleichenden Werbung, insbesondere im Kontext des § 6 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) und der einschlägigen europäischen Richtlinien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Definition und Erscheinungsformen vergleichender Werbung (indirekte und direkte), die historische Entwicklung der Rechtslage (inkl. europäischer Richtlinien wie RL 84/450/EGW, RL 97/55/EG, RL 2005/29/EG und RL 2006/114/EG), die Regulierung nach § 6 UWG (Legaldefinition, Zulässigkeitsvoraussetzungen, Verhältnis zu anderen UWG-Vorschriften), sowie die Chancen und Risiken der vergleichenden Werbung in der Praxis.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Analyse der Rechtslage und der praktischen Aspekte der vergleichenden Werbung in Deutschland. Es soll ein umfassendes Verständnis der Definition, der rechtlichen Entwicklung und der Implikationen dieser Werbeform geschaffen werden.
Wie wird die vergleichende Werbung nach deutschem Recht reguliert?
Die deutsche Rechtslage zur vergleichenden Werbung wird primär durch § 6 UWG geregelt. Die Arbeit analysiert die Legaldefinition nach § 6 I UWG und die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 6 II UWG im Detail. Dies beinhaltet die Prüfung der Vergleichbarkeit von Waren oder Dienstleistungen, die Vermeidung von Verwechslungen, die Ausschluss von Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung sowie das Verbot von Herabsetzung oder Verunglimpfung und Imitationswerbung. Zusätzlich wird das Verhältnis von § 6 UWG zu anderen Vorschriften des UWG (z.B. § 3 I UWG - Generalklausel, § 5 UWG - Irreführung) untersucht.
Welche europäischen Richtlinien sind relevant?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Rechtslage im europäischen Kontext und bezieht sich auf verschiedene Richtlinien: RL 84/450/EGW (irreführende Werbung), RL 97/55/EG (vergleichende Werbung), RL 2005/29/EG (unlautere Geschäftspraktiken) und RL 2006/114/EG (irreführende und vergleichende Werbung). Diese Richtlinien zeigen die schrittweise Harmonisierung des europäischen Rechts im Bereich der vergleichenden Werbung.
Welche Chancen und Risiken bietet die vergleichende Werbung?
Die Arbeit bewertet die Chancen (z.B. erhöhte Aufmerksamkeit, Abgrenzung von Konkurrenzprodukten) und Risiken (z.B. rechtliche Auseinandersetzungen, Rufschädigung) der vergleichenden Werbung. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die praktischen Implikationen dieser Werbeform.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Vergleichende Werbung, § 6 UWG, Wettbewerbsrecht, Rechtsprechung, Europäische Richtlinien, Irreführung, Zulässigkeitsvoraussetzungen, Chancen, Risiken, Markenrecht, Warenzeichen.
Welche Erscheinungsformen der vergleichenden Werbung werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen indirekter und direkter vergleichender Werbung.
- Quote paper
- Alexander Zocher (Author), 2009, Die Werbung mit Vergleichen nach § 6 UWG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155217