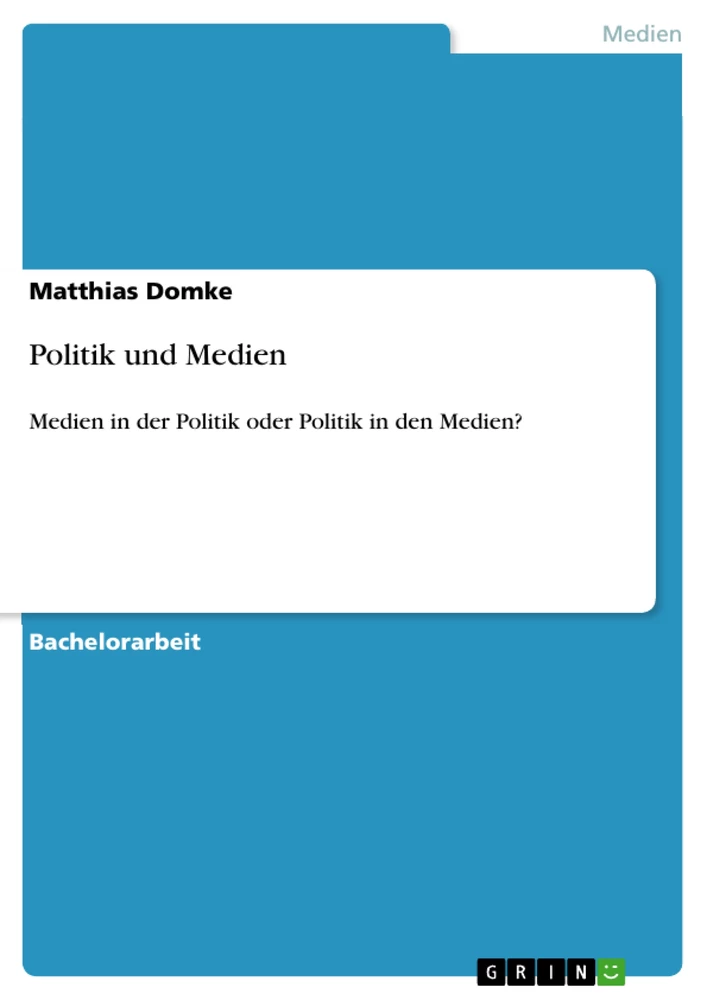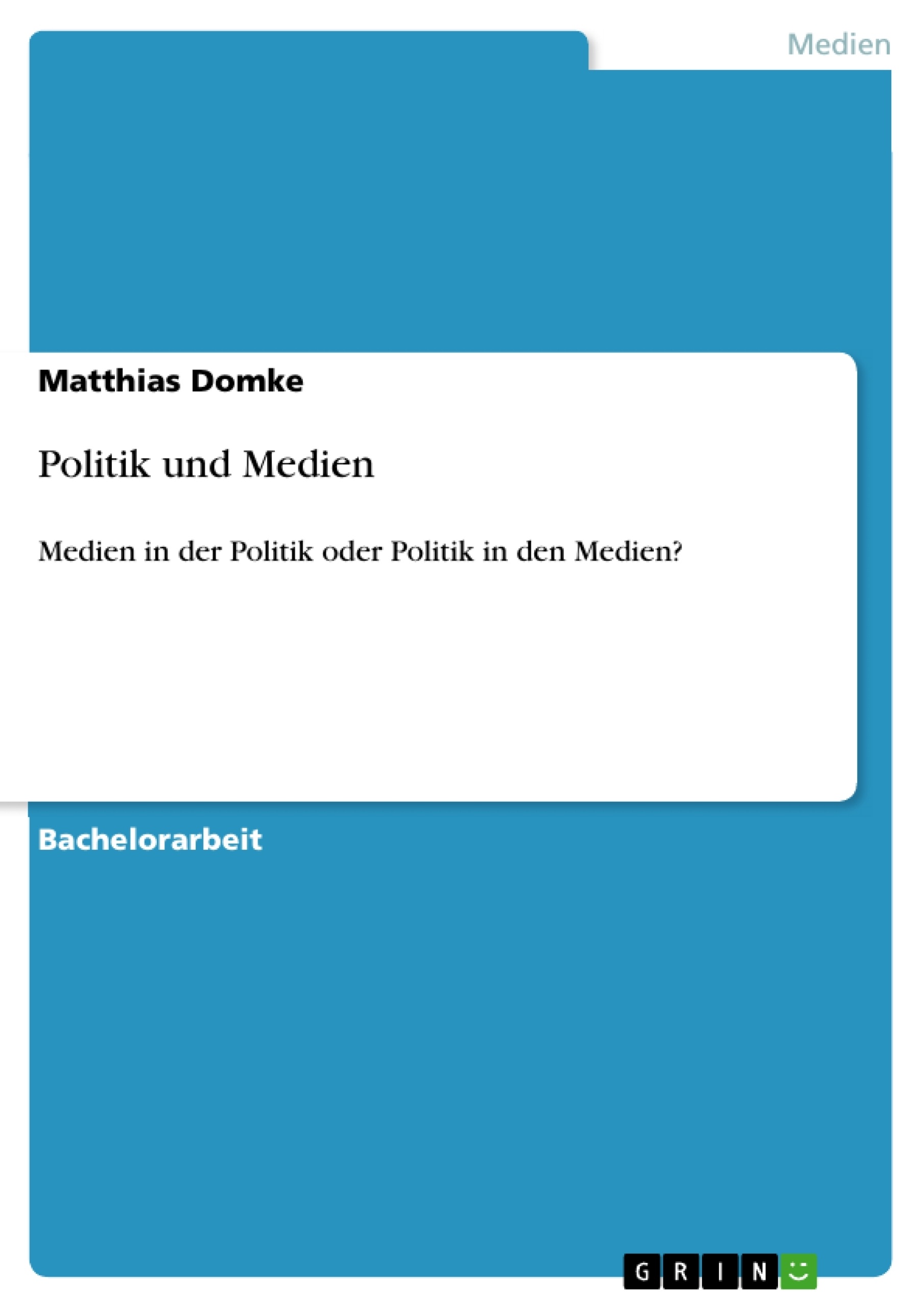„Bild dir deine Meinung“ , so wirbt eine große deutsche Tageszeitung seit Jahren. Ein solcher Slogan vermittelt den Eindruck, dass die Leser ausschließlich Informationen ohne Wertung zur Verfügung gestellt bekämen. Die Medien erfüllten nur die Rolle der Informationsquelle. Doch eine große Mehrheit der Menschen sieht das anders. Laut einer Umfrage aus den neunziger Jahren glauben 80% der Befragten , dass der Einfluss der Medien auf die politische Meinungsbildung stark oder sehr stark ist. Ungefähr 75% glauben sogar, dass die Wahlentscheidungen von den Medien beeinflusst werden. Im gleichen Artikel wird jedoch dargelegt, dass es wissenschaftlich dafür keine Bestätigung gibt. Und genau an dieser Stelle setzt die Problematik an. Auch aus den Reihen der Politiker habe ich schon oft Kritik an den Medien gehört. In meinen zwei Jahren in der Kommunalpolitik wurde mir oft von dem Gefühl berichtet, die Medienvertreter seien politisch festgelegt und würden durch gezielte Auswahl und Ausführungen von Themen versuchen, Einfluss auf die Meinung der Medienkonsumenten zu nehmen. Diese Diskrepanz zwischen der Forschung, den subjektiven Wahrnehmungen von (Kommunal-) Politikern und den Bürgern habe ich zum Anlass genommen, mich näher mit dem Thema zu befassen. Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt der Arbeit:
• In welchem Verhältnis stehen Medien und Politik zueinander?
• Wie sehr beeinflussen die Medien die Politik?
• Wie sehr beeinflusst die Politik die Medien?
• Bildet sich der Medienkonsument noch eine Meinung, oder wird seine Meinung gebildet?
• Warum gibt es bei der Frage der Einflussnahme der Medien auf die Meinungsbildung eine scheinbare Diskrepanz zwischen der Forschung und der subjektiven Wahrnehmung?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Das Thema und seine Grundproblematik
- 1.2. Die Thesen
- 2. Hauptteil
- 2.1. Frames, Framing und Framing-Effekte
- 2.2. Die Mediendemokratie
- 2.3. Die Medien im Zusammenspiel
- 2.3.1. Politikvermittlung durch die Medien: Ein historischer Überblick
- 2.3.2. Die Rolle der Medien
- 2.3.3. Erich Böhme: Ein Beispiel für die subjektive Sicht der Dinge
- 2.4. Die Politik im Zusammenspiel
- 2.4.1. Die Rolle der Politik
- 2.4.2. Die subjektive Wahrnehmung eines Politikers: Interview
- 2.5. Interdependenzen von Medien und Politik
- 3. Fazit und Ausblick
- 3.1. Interpretation
- 3.2. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Medien und Politik, insbesondere die Frage des gegenseitigen Einflusses und der subjektiven Wahrnehmung dieser Einflussnahme. Es wird der Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der öffentlichen Meinung nachgegangen.
- Das wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis von Medien und Politik
- Der subjektive Charakter der wahrgenommenen Medienbeeinflussung
- Die Rolle von Frames und Framing-Effekten in der Medienberichterstattung
- Die subjektive Wahrnehmung von Politikern und Medienkonsumenten
- Die Diskrepanz zwischen Forschungsergebnissen und subjektiver Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Ausgangsproblematik der scheinbaren Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Einfluss der Medien auf die politische Meinungsbildung und der subjektiven Wahrnehmung von Politikern und Bürgern. Der Slogan einer Tageszeitung "Bild dir deine Meinung" wird kritisch hinterfragt. Die Arbeit stellt zentrale Fragen zum Verhältnis von Medien und Politik und formuliert drei Thesen, die im Verlauf der Arbeit untersucht werden: wechselseitige Abhängigkeit von Medien und Politik, Subjektivität des Einflusses und Schutzbehauptungen im Umgang mit kritischer Berichterstattung.
2. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit der Erläuterung von Frames, Framing und Framing-Effekten. Es wird dargestellt, wie Journalisten durch die Selektion und Strukturierung von Informationen Einfluss auf die Darstellung von Themen nehmen. Anschließend wird die Rolle der Medien und der Politik im Zusammenspiel analysiert. Dabei werden sowohl historische Zusammenhänge betrachtet als auch die subjektive Sichtweise von Politikern und Medienkonsumenten beleuchtet, unter anderem anhand eines Beispiels und Interviews. Der Abschnitt untersucht die Interdependenzen zwischen beiden Systemen.
Schlüsselwörter
Medien, Politik, Meinungsbildung, Framing, Framing-Effekte, Mediendemokratie, subjektive Wahrnehmung, Interdependenzen, Kommunalpolitik, Einflussnahme.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Medien und Politik
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht das komplexe Verhältnis zwischen Medien und Politik, insbesondere den gegenseitigen Einfluss und die subjektive Wahrnehmung dieser Einflussnahme. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der öffentlichen Meinung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: das wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis von Medien und Politik, den subjektiven Charakter der wahrgenommenen Medienbeeinflussung, die Rolle von Frames und Framing-Effekten in der Medienberichterstattung, die subjektive Wahrnehmung von Politikern und Medienkonsumenten sowie die Diskrepanz zwischen Forschungsergebnissen und subjektiver Wahrnehmung. Historische Zusammenhänge und konkrete Beispiele, wie z.B. ein Interview mit einem Politiker, werden ebenfalls einbezogen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in drei Kapitel: 1. Einleitung, 2. Hauptteil und 3. Fazit und Ausblick. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Forschungsfragen und Thesen vor. Der Hauptteil analysiert die Interdependenzen von Medien und Politik, beleuchtet Frames und Framing-Effekte und untersucht die subjektive Wahrnehmung von Politikern und Medienkonsumenten. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Thesen werden im Text aufgestellt und untersucht?
Der Text formuliert drei zentrale Thesen: die wechselseitige Abhängigkeit von Medien und Politik, die Subjektivität des Einflusses der Medien und Schutzbehauptungen im Umgang mit kritischer Berichterstattung. Diese Thesen werden im Verlauf des Textes untersucht und belegt.
Welche Rolle spielen Frames und Framing-Effekte im Text?
Der Text erklärt Frames und Framing-Effekte als Mechanismen, durch die Journalisten durch Selektion und Strukturierung von Informationen Einfluss auf die Darstellung von Themen nehmen. Diese Effekte werden im Kontext des Verhältnisses zwischen Medien und Politik analysiert.
Wie wird die subjektive Wahrnehmung im Text behandelt?
Der Text betont den subjektiven Charakter der wahrgenommenen Medienbeeinflussung sowohl bei Politikern als auch bei Medienkonsumenten. Die Diskrepanz zwischen objektiven Forschungsergebnissen und der subjektiven Wahrnehmung bildet einen zentralen Aspekt der Analyse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter des Textes sind: Medien, Politik, Meinungsbildung, Framing, Framing-Effekte, Mediendemokratie, subjektive Wahrnehmung, Interdependenzen, Kommunalpolitik und Einflussnahme.
Welche Methoden werden im Text verwendet?
Der Text verwendet eine Kombination aus Literaturanalyse, Fallbeispielen und möglicherweise Interviews, um die Forschungsfragen zu beantworten. Die Analyse von Frames und Framing-Effekten ist ebenfalls eine zentrale Methode.
- Quote paper
- Matthias Domke (Author), 2009, Politik und Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155059