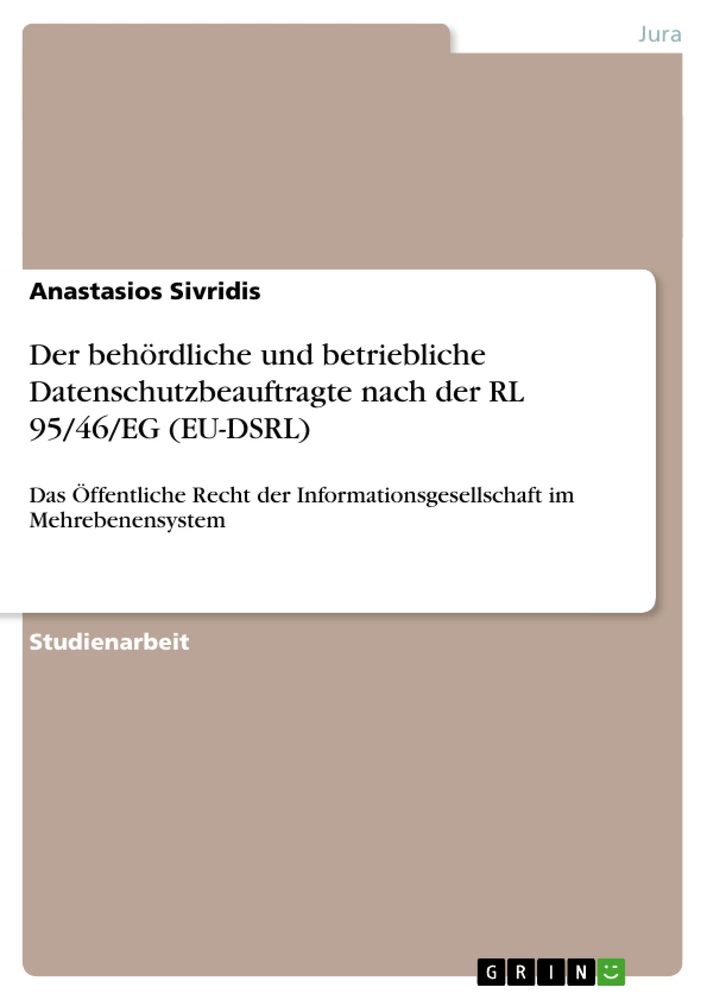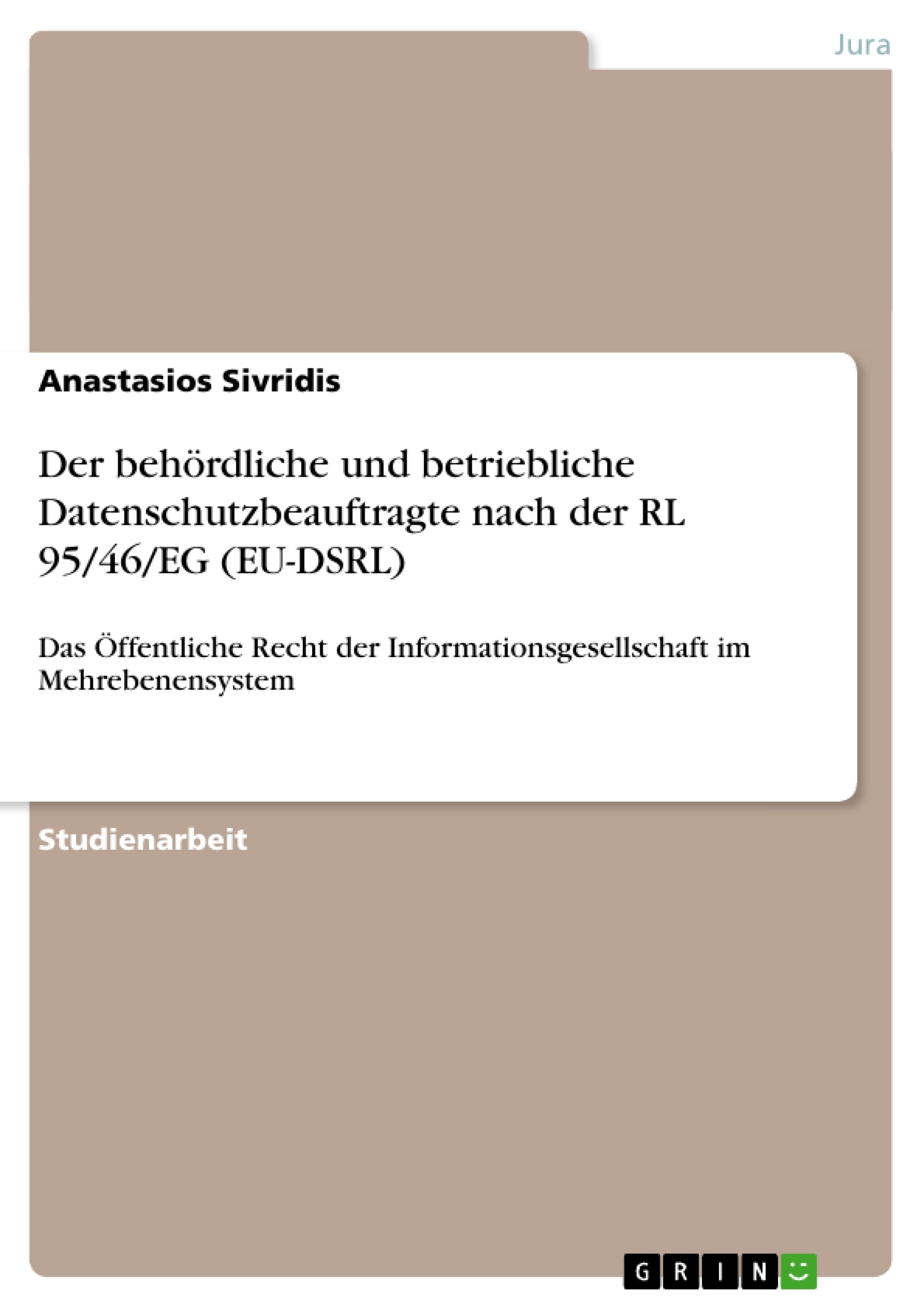In den vergangenen rund 30 Jahren hat die Institution des Datenschutzbeauftragten eine bemerkenswerte Karriere gemacht. In der Einsicht, dass das Ziel eines hohen Datenschutzniveaus ohne Kontrollinstanzen nicht zu erreichen ist, wurde zunächst im nicht-öffentlichen Bereich die Figur des DSB eingeführt. Zugleich wurde mit dieser Entscheidung auch dem dualen Kontrollsystem, bestehend aus einer internen Kontrollinstanz und einer externen Kontrollinstanz, der Aufsichtsbehörde, der Vorzug gewährt.
Der in jedem Unternehmen und jedem Betrieb anders strukturierte Umgang mit personenbezogenen Daten lässt sich von einer zum Betrieb gehörenden Person sehr viel besser erschließen, steuern und kontrollieren, als allein von einer externen Aufsichtsbehörde. Dass diese Einschätzung zutrifft, ist vor dem Hintergrund der in jüngster und jüngerer Zeit zahlreich bekannt gewordenen Datenschutzverstöße in Unternehmen fraglich geworden. Das Konzept setzte sich zunächst dennoch durch, so dass im Laufe der Zeit immer mehr Länder dazu übergingen, auch behördliche DSB fakultativ oder obligatorisch vorzusehen. Einen wirklich verbesserten Stellenwert erfuhr der DSB jedoch im Zuge der Umsetzung der RL 95/46/EG (EG-Datenschutzrichtlinie)in deutsches Recht. Die deutsche Delegation bei den Verhandlungen zur EGDSRL bewirkte, dass die Person des DSB Eingang in die EG-DSRL fand. Andernfalls hätte die stark am französischen Modell der datenschutzrechtlichen Kontrolle orientierte EG-DSRL zur Abschaffung des deutschen dualen Kontrollsystems geführt. So aber konnte der betriebliche DSB beibehalten werden. Mehr noch: Im Zuge der Umsetzung der EG-DSRL wurde im Bundesdatenschutzgesetz mit kleinen Ausnahmen die Bestellung eines bDSB für alle Bundesbehörden obligatorisch vorgeschrieben. Auch in den allermeisten Ländern ist mittlerweile die Bestellung mindestens eines bDSB je Behörde Pflicht. Seitdem haben die Aufgaben des bDSB weiter an Kontur gewonnen, so dass mittlerweile sogar von einem Berufsbild gesprochen werden kann. Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat erst im letzten Jahr die Stellung des DSB erneut gestärkt, indem er im Zuge der BDSG-Novelle II den Abberufungs- bzw. Kündigungsschutz des DSB nach vielfacher Forderung gestärkt hat, um seine Unabhängigkeit zu garantieren.
Inhaltsverzeichnis
- Der behördliche Datenschutzbeauftragte nach der Richtlinie 95/46/EG
- A. Einführung
- B. Behördlicher DSB vor der EG-Datenschutzrichtlinie
- I. Aufgaben des bDSB
- II. Person und Stellung des bDSB
- C. Behördlicher DSB nach der EG-Datenschutzrichtlinie
- I. Das Kontrollsystem der EG-DSRL
- II. Zusätzliche Aufgaben des bDSB
- III. Gewandelte Stellung des bDSB
- D. Behördlicher DSB und die Anforderungen der EG-Datenschutzrichtlinie
- I. Anrufungsrecht des bDSB gegenüber dem BfDI
- II. Publikationspflicht und Transparenz
- E. Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) vor und nach Inkrafttreten der EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG). Ziel ist es, die Entwicklung der Aufgaben, Befugnisse und Stellung des bDSB zu beschreiben und die Auswirkungen der Richtlinie auf seine Tätigkeit zu analysieren.
- Aufgaben des bDSB vor und nach der EG-Datenschutzrichtlinie
- Stellung und Unabhängigkeit des bDSB
- Kontrollmechanismen und -instrumente der EG-DSRL
- Anrufung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI)
- Transparenz und Publikationspflichten
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Dieses einleitende Kapitel legt den Fokus auf den Gegenstand und den Gang der Untersuchung. Es wird die Bedeutung des behördlichen Datenschutzbeauftragten im Kontext der EG-Datenschutzrichtlinie skizziert und die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert. Die Kapitelstruktur wird kurz vorgestellt, um dem Leser einen Überblick über den Aufbau der Arbeit zu geben. Die Einleitung dient als notwendiger Rahmen, um den Kontext der späteren detaillierten Analyse der Rolle des Datenschutzbeauftragten zu etablieren.
B. Behördlicher DSB vor der EG-Datenschutzrichtlinie: Dieses Kapitel beschreibt die Aufgaben und die Stellung des behördlichen Datenschutzbeauftragten vor dem Hintergrund der EG-Datenschutzrichtlinie. Es werden seine Beratungsfunktion, seine Kontroll- und Überwachungsbefugnisse sowie seine Rolle als Ansprechpartner für Betroffene ausführlich dargestellt. Die Analyse beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung seiner Aufgaben in der vorherrschenden Rechtslage vor der Richtlinie. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Grenzen seiner Tätigkeit in diesem Kontext. Die Beschreibung seiner Person und seiner formalen Stellung innerhalb der Behörde bildet einen weiteren wichtigen Aspekt dieses Kapitels.
C. Behördlicher DSB nach der EG-Datenschutzrichtlinie: Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen der Rolle des bDSB im Lichte der EG-Datenschutzrichtlinie. Es wird das Kontrollsystem der Richtlinie detailliert untersucht, einschließlich der Kontrollstellen, -instrumente (wie Meldepflicht und Vorabkontrolle), und der zusätzlichen Aufgaben des bDSB, die durch die Richtlinie entstanden sind. Die Analyse umfasst die Auswirkungen auf die Stellung des bDSB, seine Bestellung und Abberufung, sowie die Funktionsausübung im veränderten rechtlichen Rahmen. Die erweiterten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des bDSB nach der Richtlinie werden im Detail untersucht, und es wird untersucht, inwieweit die Richtlinie die Anforderungen an die Unabhängigkeit des bDSB verbessert hat.
D. Behördlicher DSB und die Anforderungen der EG-Datenschutzrichtlinie: Dieses Kapitel vertieft die Untersuchung der Beziehung zwischen dem bDSB und den Anforderungen der EG-Datenschutzrichtlinie. Es analysiert das Anrufungsrecht des bDSB beim BfDI, insbesondere im Rahmen der Vorabkontrolle, und untersucht die Bedeutung der Publikationspflicht und Transparenz für die Erfüllung der Aufgaben des bDSB. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie und den damit verbundenen Herausforderungen für den bDSB. Die rechtliche Argumentation wird mit praktischen Beispielen und Fallstudien untermauert, um die Komplexität der Thematik zu verdeutlichen. Die Analyse der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden im nicht-öffentlichen Bereich ist ein wichtiger Aspekt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Behördlicher Datenschutzbeauftragter, EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), Datenschutz, Kontrollsystem, Meldepflicht, Vorabkontrolle, Unabhängigkeit, Aufsichtsbehörde, BfDI, Transparenz, Publikationspflicht, Aufgaben, Befugnisse, Stellung.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Der behördliche Datenschutzbeauftragte nach der Richtlinie 95/46/EG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle des behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) vor und nach Inkrafttreten der EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG). Sie untersucht die Entwicklung seiner Aufgaben, Befugnisse und Stellung sowie die Auswirkungen der Richtlinie auf seine Tätigkeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Aufgaben des bDSB vor und nach der Richtlinie, seiner Stellung und Unabhängigkeit, den Kontrollmechanismen der EG-DSRL, der Anrufung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI), sowie Transparenz- und Publikationspflichten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Untersuchung einführt, gefolgt von Kapiteln, die den bDSB vor und nach der EG-Datenschutzrichtlinie beschreiben. Ein weiteres Kapitel analysiert die Beziehung zwischen dem bDSB und den Anforderungen der Richtlinie, insbesondere das Anrufungsrecht beim BfDI und die Bedeutung von Transparenz und Publikationspflicht. Die Arbeit schließt mit einem Résumé.
Was sind die Hauptaufgaben des bDSB vor der EG-Datenschutzrichtlinie?
Vor Inkrafttreten der Richtlinie umfasste die Tätigkeit des bDSB Beratungsfunktionen, Kontroll- und Überwachungsbefugnisse sowie die Rolle als Ansprechpartner für Betroffene. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung seiner Aufgaben in der damaligen Rechtslage, einschließlich der Herausforderungen und Grenzen.
Wie verändert sich die Rolle des bDSB nach der EG-Datenschutzrichtlinie?
Die EG-Datenschutzrichtlinie führte zu zusätzlichen Aufgaben und veränderten die Stellung des bDSB. Die Arbeit untersucht detailliert das Kontrollsystem der Richtlinie, einschließlich der Kontrollinstrumente und der Auswirkungen auf die Bestellung, Abberufung und Funktionsausübung des bDSB im neuen rechtlichen Rahmen. Die erweiterten Kompetenzen und die verbesserte Unabhängigkeit werden analysiert.
Welche Bedeutung haben das Anrufungsrecht beim BfDI und die Transparenz?
Die Arbeit analysiert das Anrufungsrecht des bDSB beim BfDI, insbesondere im Kontext der Vorabkontrolle. Sie untersucht zudem die Bedeutung der Publikationspflicht und Transparenz für die Erfüllung der Aufgaben des bDSB und die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Vorgaben. Die rechtliche Argumentation wird durch praktische Beispiele und Fallstudien veranschaulicht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Behördlicher Datenschutzbeauftragter, EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), Datenschutz, Kontrollsystem, Meldepflicht, Vorabkontrolle, Unabhängigkeit, Aufsichtsbehörde, BfDI, Transparenz, Publikationspflicht, Aufgaben, Befugnisse, Stellung.
- Quote paper
- Anastasios Sivridis (Author), 2010, Der behördliche und betriebliche Datenschutzbeauftragte nach der RL 95/46/EG (EU-DSRL), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154812