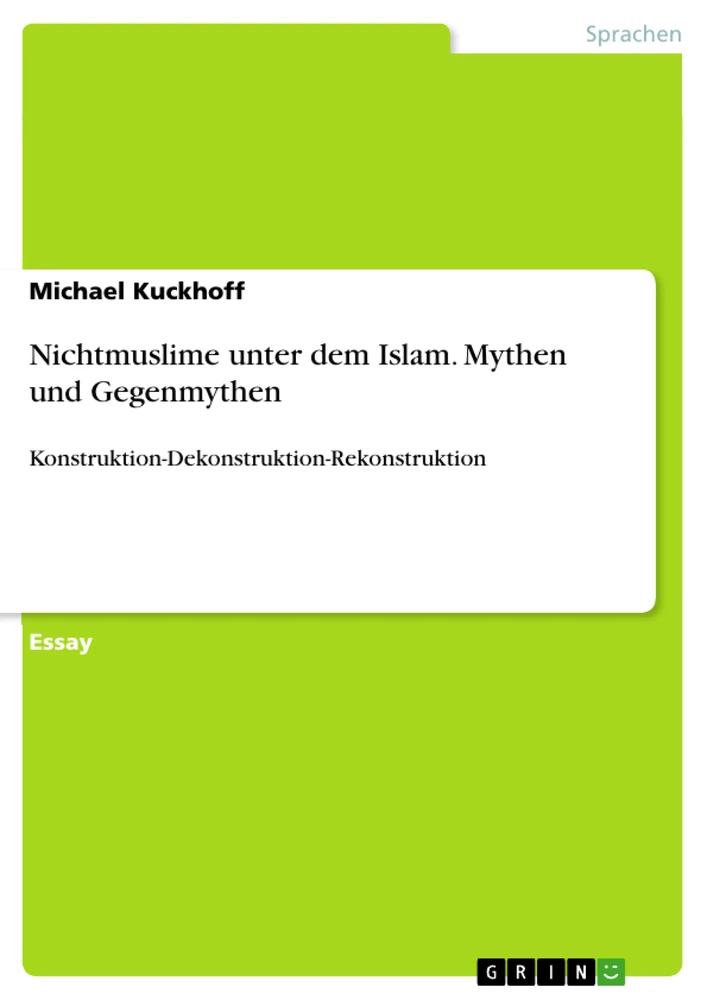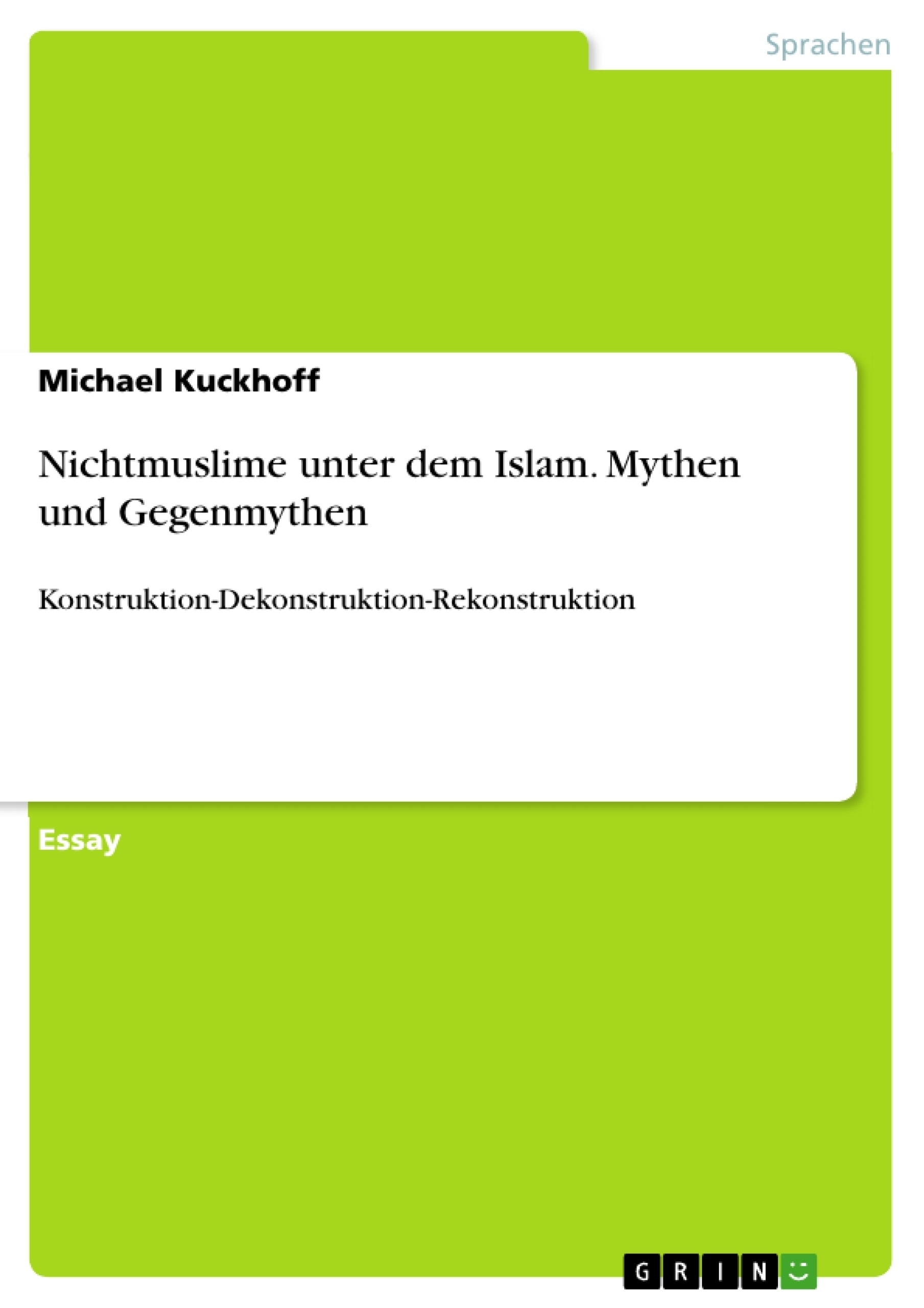Haben der Mythos von der Harmonie und der Gegenmythos von der Verfolgung der Nichtmuslime in der islamisch geprägten Gesellschaft noch heute Bestand? Gegenstand dieses Essays ist zunächst die Darstellung der verschiedenen Mythen und Gegenmythen zur Frage der Toleranz in der islamisch geprägten Gesellschaft. Anschließend werden einige Aspekte zur Quellenlage in Vergangenheit und Gegenwart aufgeführt. Im Hauptteil werden einige neuere Studien vorgestellt, die frühkoranische und spätmittelalterliche Quellen analysieren und interpretieren. Daneben werden richtungsweisende Studien zu wirtschaftlichen, sozialen und interreligiösen Beziehungen im islamischen Mittelalter und im frühen Osmanischen Reich erörtert.
Die lange Debatte über die Frage von Toleranz und Intoleranz im vormodernen Islam bewegt sowohl Akademiker als auch eine breite Öffentlichkeit. Insbesondere der Status religiöser Minderheiten, vor allem der Christen und Juden, stehen hier im Mittelpunkt der Betrachtungen. Als Beleg für die Behauptung, dass der Islam keine tolerante Religion ist, werden die diskriminierenden Regelungen zur Behandlung von Nichtmuslimen in islamischen Ländern angeführt. Auf der anderen Seite deklarieren einige Muslime den Islam als einladende und respektvolle Religion, in denen die Regelungen zum Umgang mit Nichtmuslimen keinen ethischen Gradmesser für die islamische Gesellschaft darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Vom Mythos zum Narrativ
- Narrativ der historia lacrimosa
- Narrativ der interreligiösen Utopie
- Narrativ der arabischen Wiederbelebung des Mythos der interreligiösen Utopie
- Narrativ besserer Bedingungen für Juden unter dem Islam als unter dem Christentum
- Narrativ der historia neolacrimosa
- Zwischen religiöser Diversität und Konversion – Die Geburt des dhimmi
- Der wiedergefundene Prophet und die Menschenrechtstradition des Korans
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Mythen und Gegenmythen über Toleranz in islamisch geprägten Gesellschaften, insbesondere den Status religiöser Minderheiten. Er analysiert historische Quellen und neuere Studien, um die Frage zu beantworten, ob der Mythos von Harmonie und der Gegenmythos von Verfolgung heute noch Bestand haben.
- Die Konstruktion und Dekonstruktion von Mythen über Toleranz im Islam.
- Analyse historischer Quellen zur Behandlung von Nichtmuslimen im Mittelalter und im frühen Osmanischen Reich.
- Untersuchung verschiedener Narrative über die Beziehungen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen.
- Die Rolle von wirtschaftlichen, sozialen und interreligiösen Beziehungen in der Gestaltung dieser Narrative.
- Die Bedeutung der Konzepte von Dhimmitude und Schutz im Kontext der interreligiösen Beziehungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Vom Mythos zum Narrativ: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Entstehung verschiedener Mythen und Narrative über die Behandlung von Nichtmuslimen unter islamischer Herrschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Es stellt die Grundlage für die weitere Analyse der verschiedenen, oft widersprüchlichen, Perspektiven dar. Die Entstehung dieser Mythen wird im Kontext historischer und politischer Entwicklungen betrachtet.
Narrativ der historia lacrimosa: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Narrativ der leidvollen Geschichte der Juden in der Diaspora, wie es beispielsweise von Heinrich Graetz dargestellt wurde. Es betont das anhaltende Leid als zentrales Element der jüdischen Geschichte und analysiert die Ursprünge dieses Mythos im Kontext der Emanzipation des europäischen Judentums. Die Langsamkeit des Akkulturationsprozesses wird als ein tragendes Element dieses Narrativs herausgestellt.
Narrativ der interreligiösen Utopie: Im Gegensatz zum vorherigen Narrativ, stellt dieses Kapitel den Mythos eines Zeitalters der Toleranz und des blühenden jüdischen Lebens unter muslimischer Herrschaft dar, insbesondere in al-Andalus und dem Osmanischen Reich. Salo W. Baron's Werk wird als zentrales Beispiel für diese Perspektive angeführt, wobei die Beiträge der Juden zu Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der positiven Darstellung der Integration und des kulturellen Austauschs.
Narrativ der arabischen Wiederbelebung des Mythos der interreligiösen Utopie: Dieses Kapitel analysiert George Antonius' "The Arab Awakening" und dessen Darstellung einer jahrhundertelangen Harmonie zwischen Juden und Arabern unter islamischer Herrschaft, die durch den Zionismus zerstört wurde. Antonius' Argumentation wird kritisch untersucht, wobei der Fokus auf der politischen Motivation hinter der Rekonstruktion dieses Mythos im Kontext des arabischen Nationalismus liegt. Die Wiederherstellung der alten Harmonie wird als abhängig von der Aufgabe zionistischer Ansprüche dargestellt.
Narrativ besserer Bedingungen für Juden unter dem Islam als unter dem Christentum: Dieses Kapitel untersucht Bernard Lewis' Argumentation, dass die Lage von Nichtmuslimen unter traditioneller islamischer Herrschaft besser war als die von Nichtchristen im mittelalterlichen Europa. Die "Second-class citizenship" wird in diesem Kontext analysiert und die relative rechtliche Stellung im Vergleich zum mittelalterlichen Europa wird beleuchtet. Lewis' Vergleich der rechtlichen Rahmenbedingungen dient als Ausgangspunkt für die folgende Diskussion.
Narrativ der historia neolacrimosa: Dieses Kapitel befasst sich mit Bat Ye'or's Werk, welches die Bedingungen nichtmuslimischer Minderheiten unter muslimischer Herrschaft beschreibt und eine zunehmende Rigidität und Unterdrückung seit dem 11. Jahrhundert postuliert. Ye'or's Argumentation, die den Aspekt der Toleranz zurückweist und von Unterdrückung und Verfolgung spricht, selbst im "Goldenen Zeitalter", wird detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Analyse von Ye'ors Interpretationen und der kritischen Auseinandersetzung mit deren Schlussfolgerungen.
Zwischen religiöser Diversität und Konversion – Die Geburt des dhimmi: Dieses Kapitel untersucht koranische Aussagen zum Status von Nichtmuslimen und die Entwicklung des Dhimmi-Status. Es erklärt die Bedingungen des Schutzes (Dhimma) und die damit verbundenen Steuern (Jizya und Kharāj). Die Bedeutung der monotheistischen Religionen und der Besitz einer Offenbarungsschrift (aḥl al-kitāb) für den Erhalt dieses Status werden erläutert. Der Fokus liegt auf der rechtlichen und sozialen Konstruktion des Dhimmi-Status und dessen Auswirkungen.
Der wiedergefundene Prophet und die Menschenrechtstradition des Korans: Dieses Kapitel analysiert die Arbeiten von John Andrew Morrow und Ahmed El-Wakil, die die Authentizität von Verträgen Mohammeds mit christlichen Gemeinden betonen und diese als Beleg für friedliche Koexistenz und Toleranz interpretieren. Die Bedeutung dieser Verträge und Abkommen im Kontext der interreligiösen Beziehungen wird beleuchtet. Die Argumentation gegen die Ablehnung dieser Dokumente als Fälschungen wird detailliert dargestellt und deren aktuelle Relevanz hervorgehoben. Der ḥadīth über den Schutz von Dhimmis wird als zentrales Element der Diskussion präsentiert.
Schlüsselwörter
Toleranz, Intoleranz, Islam, Nichtmuslime, Dhimmi, Mythen, Narrative, Historia Lacrimosa, Interreligiöse Beziehungen, Mittelalter, Osmanisches Reich, Koran, Hadīth, Juden, Christen, Kultureller Austausch, Politische Geschichte, Religionsgeschichte, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht dieser Essay?
Dieser Essay untersucht Mythen und Gegenmythen über Toleranz in islamisch geprägten Gesellschaften, insbesondere den Status religiöser Minderheiten. Er analysiert historische Quellen und neuere Studien, um die Frage zu beantworten, ob der Mythos von Harmonie und der Gegenmythos von Verfolgung heute noch Bestand haben.
Welche Themenschwerpunkte werden in diesem Essay behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind: Die Konstruktion und Dekonstruktion von Mythen über Toleranz im Islam; Analyse historischer Quellen zur Behandlung von Nichtmuslimen im Mittelalter und im frühen Osmanischen Reich; Untersuchung verschiedener Narrative über die Beziehungen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen; Die Rolle von wirtschaftlichen, sozialen und interreligiösen Beziehungen in der Gestaltung dieser Narrative; Die Bedeutung der Konzepte von Dhimmitude und Schutz im Kontext der interreligiösen Beziehungen.
Was ist das Narrativ der historia lacrimosa?
Das Narrativ der historia lacrimosa konzentriert sich auf die leidvolle Geschichte der Juden in der Diaspora und betont das anhaltende Leid als zentrales Element der jüdischen Geschichte. Es analysiert die Ursprünge dieses Mythos im Kontext der Emanzipation des europäischen Judentums.
Was ist das Narrativ der interreligiösen Utopie?
Dieses Narrativ stellt den Mythos eines Zeitalters der Toleranz und des blühenden jüdischen Lebens unter muslimischer Herrschaft dar, insbesondere in al-Andalus und dem Osmanischen Reich. Es hebt die Beiträge der Juden zu Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur hervor.
Was besagt das Narrativ der arabischen Wiederbelebung des Mythos der interreligiösen Utopie?
Dieses Narrativ stellt eine jahrhundertelange Harmonie zwischen Juden und Arabern unter islamischer Herrschaft dar, die durch den Zionismus zerstört wurde. Die Wiederherstellung der alten Harmonie wird als abhängig von der Aufgabe zionistischer Ansprüche dargestellt.
Was ist das Narrativ besserer Bedingungen für Juden unter dem Islam als unter dem Christentum?
Dieses Narrativ argumentiert, dass die Lage von Nichtmuslimen unter traditioneller islamischer Herrschaft besser war als die von Nichtchristen im mittelalterlichen Europa, und analysiert die "Second-class citizenship" in diesem Kontext.
Was ist das Narrativ der historia neolacrimosa?
Dieses Narrativ beschreibt die Bedingungen nichtmuslimischer Minderheiten unter muslimischer Herrschaft und postuliert eine zunehmende Rigidität und Unterdrückung seit dem 11. Jahrhundert, selbst im "Goldenen Zeitalter".
Was bedeutet der Begriff Dhimmi?
Der Dhimmi-Status beschreibt den Status von Nichtmuslimen in islamischen Gesellschaften, die unter dem Schutz (Dhimma) des islamischen Staates stehen und bestimmte Steuern (Jizya und Kharāj) zahlen. Dieser Status war primär für Angehörige monotheistischer Religionen mit einer Offenbarungsschrift (aḥl al-kitāb) vorgesehen.
Welche Rolle spielen Verträge Mohammeds mit christlichen Gemeinden in der Diskussion um Toleranz?
Einige Gelehrte betonen die Authentizität von Verträgen Mohammeds mit christlichen Gemeinden und interpretieren diese als Beleg für friedliche Koexistenz und Toleranz. Der ḥadīth über den Schutz von Dhimmis wird als zentrales Element dieser Argumentation präsentiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diesen Essay?
Relevante Schlüsselwörter sind: Toleranz, Intoleranz, Islam, Nichtmuslime, Dhimmi, Mythen, Narrative, Historia Lacrimosa, Interreligiöse Beziehungen, Mittelalter, Osmanisches Reich, Koran, Hadīth, Juden, Christen, Kultureller Austausch, Politische Geschichte, Religionsgeschichte, Quellenkritik.
- Quote paper
- Michael Kuckhoff (Author), 2022, Nichtmuslime unter dem Islam. Mythen und Gegenmythen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1547672