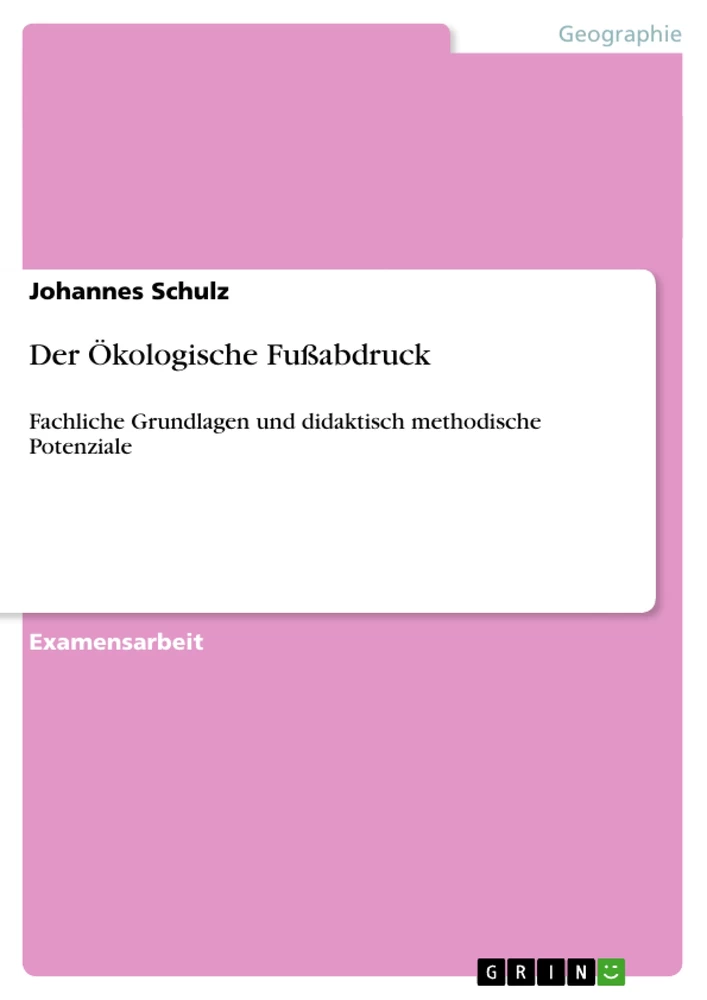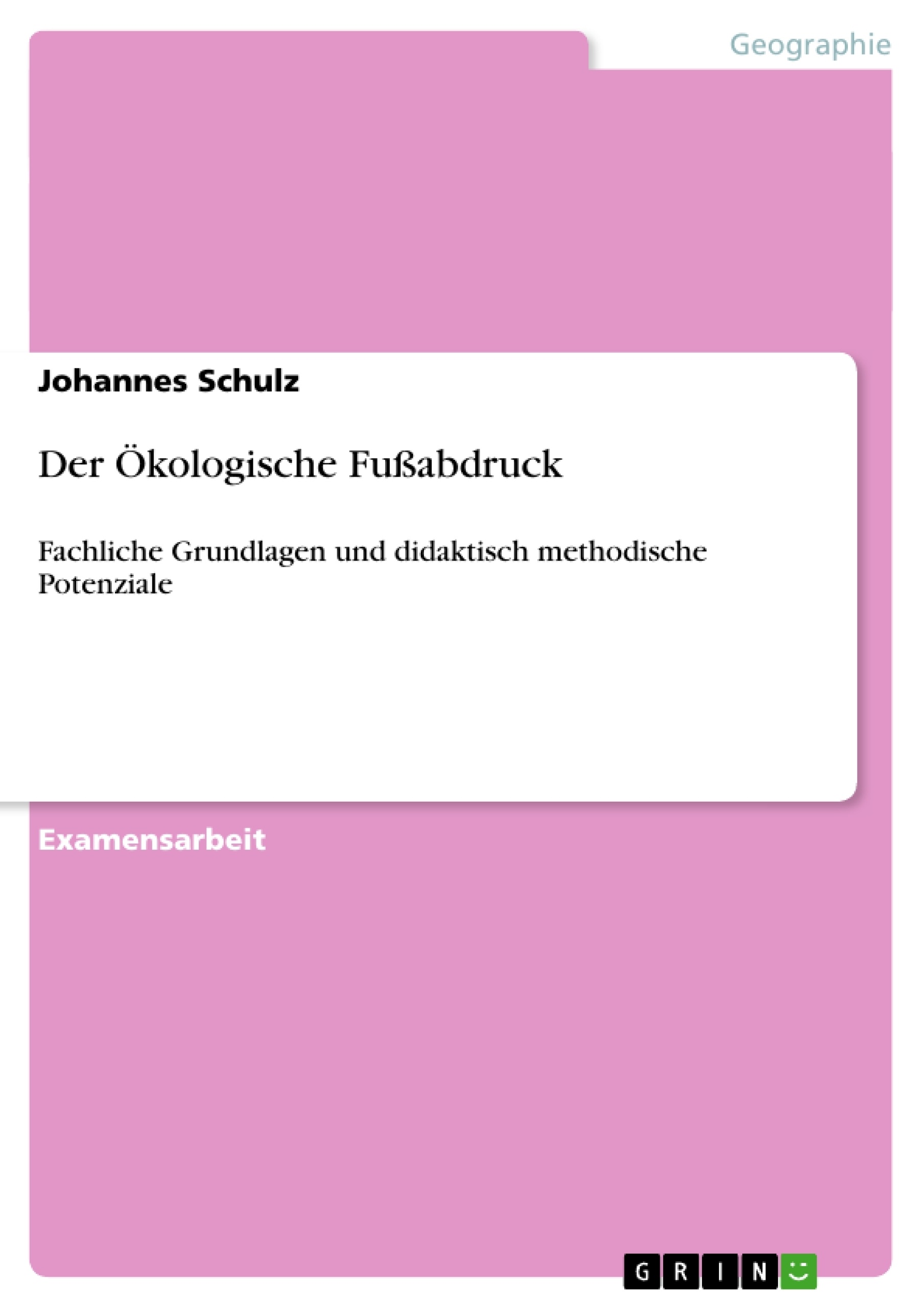Mathis Wackernagel, Umwelterziehung, Umweltbildung
In der vorliegenden Arbeit sollte das Konzept des Ökologischen Fußabdrucks auf seine fachlichen Grundlagen hin überprüft werden. Insbesondere wurden kritikwürdige Details herausgearbeitet, die dem „normalen“ Anwender des Konzepts meist im Verborgenen bleiben. Die Interpretierbarkeit eines errechneten Fußabdrucks hängt aber im Wesentlichen von der Zusammensetzung und der Grundannahme ab.
Diese Grundannahmen sind sehr abstrakt und für sich in vielfacher Weise realitätsfern. Besonders die Zusammensetzung und Einbeziehung des Energieverbrauchs in den ÖFA, sowie die Berechnung und Gewichtung der Äquivalenzfaktoren, lassen den ÖFA sehr Variabel erscheinen, je nachdem welcher Ansatz verfolgt und welche Berechnungsmethodik verwendet wird. Die ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung des ÖFA steht für einen regen Diskurs und verspricht eine ständige Überprüfung der wissenschaftlichen Grundlagen. Sie ist für die Interpretation sowohl problematisch als auch positiv zu sehen.
Wichtig für den Anwender ist bei solch stark aggregierten Indikatoren, dass das dahinter stehende Konzept mit den grundlegenden Prämissen durchschaut wird, da sonst falsche Vorstellungen bei der Schlussfolgerung gezogen werden können. Zum Beispiel, dass durch die Aufforstung von Wäldern das Vergrößern des Fußabdrucks kompensiert werden könne.
Weiterhin wurde hintergefragt, ob der ÖFA einer seiner Zielsetzungen, ein Indikator für Nachhaltigkeit zu sein, gerecht werden kann. Dazu ist zu sagen, dass der ÖFA nur einen kleinen aber wichtigen Ausschnitt aus dem Nachhaltigkeitskomplex untersuchen kann. Die Kombination mit anderen Indikatoren wie zum Beispiel zur Biodiversität (Living Planet Index) oder dem Waterfootprint schafft hier teilweise Abhilfe. Die die Aussagekraft in Bezug auf Nachhaltigkeit ist grundsätzlich in Frage zu stellen.
Die didaktische Wirkung bleibt der große Vorteil des Ansatzes. Selbst bei veränderten Rechenmodellen und veränderten Grundannahmen, ist die Aussage dieselbe: wir leben über unseren Verhältnissen. Egal ob der der Fußabdruck aus 4 oder 5 gha besteht, denn 2,2 gha wären laut vorhandener Biokapazität schon zu viel.
Es hat sich herausgestellt, dass der Einsatz des ÖFA im Unterricht sehr vielfältig sein kann. Neben dem bekannten Footprintrechner gibt es sehr unterschiedliche Varianten des Einsatzes. Je nach Zielsetzung kann der ÖFA zu unterschiedlichen Problemfeldern hinführend oder abschließend eingesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wissenschaftshistorie
- 3. Fachliche Grundlagen
- 3.1. Die Grundidee des Ökologischen Fußabdrucks
- 3.2. Berechnungsgrundlagen
- 3.2.1. Der Globale Hektar (in gha)
- 3.2.2. Äquivalenzfaktoren (ÄQF)
- 3.2.3. Ertragsfaktoren (EF)
- 3.2.4. Produktivität von Energiequellen
- 3.3. Die Biokapazität
- 3.4. Die Ökobilanzierung
- 3.5. Erhebung von Daten
- 3.6. Flächenkategorien
- 4. Kritische Betrachtungen
- 4.1. Vorüberlegung
- 4.2. Bezug zur Nachhaltigkeit
- 4.3. Konzeptionelle Schwachstellen
- 4.3.1. Geringproduktive Flächen und die exklusive Funktionalität
- 4.3.2. Über den Verlust von Biokapazität
- 4.3.3. Über den Verlust von Biodiversität
- 4.3.4. Der ÖFA sieht nur mit einem Auge
- 4.3.5. Das Doublecounting
- 4.3.6. Die Kernenergie
- 4.3.7. Die CO²-Fläche
- 4.4. Schwachstellen im Verfahren
- 4.4.1. Die Datensituation
- 4.4.2. Die Umrechnungsfaktoren
- 4.4.3. Die hohe Aggregation
- 4.5. Zur Begrifflichkeit
- 5. didaktisch methodische Potenziale in der gymnasialen Oberstufe
- 5.1. Nachhaltigkeit im Unterricht
- 5.2. Umweltbewusstsein im Kontext von Bildung und Werteorientierung
- 5.3. Der Ökologische Fußabdruck
- 5.3.1. Problematisierung
- 5.3.1.1. Schwerpunkt: Overshoot
- 5.3.1.2. Schwerpunkt: Wohlstand für alle – eine Utopie?
- 5.3.2. Der persönliche Ökologische Fußabdruck im Unterricht
- 5.3.3. Arbeiten mit dem Ökologischen Fußabdruck
- 5.3.3.1. Anwendungsbeispiele außerhalb des Footprintrechners
- 5.3.3.2. Unsere Bedürfnisse in der Nachhaltigkeitsfalle
- 5.3.3.3. Footprint und nun? Konstruktive Weiterarbeit
- 5.3.3.3.1. Individuelle Ebene - die Zukunft selbst in die Hand nehmen
- 5.3.3.3.2. Kollektive Ebene - gemeinsam aktiv durchstarten
- 5.3.3.4. Das Dilemma des zu hohen Fußabdrucks
- 5.4. Probleme bei der Arbeit mit dem Ökologischen Fußabdruck
- 5.3.1. Problematisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ökologischen Fußabdruck und seine didaktischen Potenziale im gymnasialen Unterricht. Ziel ist es, das Konzept verständlich zu machen, Missverständnisse zu vermeiden und seine Anwendung im Unterricht aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die fachlichen Grundlagen des Ökologischen Fußabdrucks, seine kritischen Punkte und seine didaktischen Möglichkeiten zur Förderung von Umweltbewusstsein und nachhaltigem Handeln.
- Entwicklung und Ideengeschichte des Ökologischen Fußabdrucks
- Fachliche Grundlagen und Berechnungsmethoden des Ökologischen Fußabdrucks
- Kritische Auseinandersetzung mit den methodischen Grenzen und Schwächen des Konzepts
- Didaktische Potenziale des Ökologischen Fußabdrucks im Unterricht
- Konstruktive Vorschläge zur Anwendung des Ökologischen Fußabdrucks in der Umweltbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Notwendigkeit, das Konzept des Ökologischen Fußabdrucks (ÖFA) vor Missverständnissen und Falschinterpretationen zu schützen. Sie stellt die zentrale Frage nach der Gerechtigkeit des ÖFA im Hinblick auf Nachhaltigkeit und legt den didaktischen Fokus der Arbeit dar, der sich auf den Einsatz des ÖFA im Unterricht konzentriert.
2. Wissenschaftshistorie: Dieses Kapitel beleuchtet die ideengeschichtliche Entwicklung des Konzepts des Ökologischen Fußabdrucks, beginnend mit frühen philosophischen und forstwirtschaftlichen Überlegungen zur Nachhaltigkeit. Es zeichnet den Weg von Malthus' Bevölkerungslehre über Marsh's Werk "Man and Nature" bis hin zur Entwicklung des ÖFA durch Rees und Wackernagel nach, wobei wichtige Zwischenstationen wie das Konzept der ökologischen Tragfähigkeit und der Umweltraum erläutert werden.
3. Fachliche Grundlagen: Dieser Abschnitt erläutert die Grundidee des Ökologischen Fußabdrucks als ein Instrument zur Bilanzierung des Naturverbrauchs und die damit verbundenen Berechnungsgrundlagen. Er beschreibt detailliert die Verwendung des Globalen Hektar, Äquivalenzfaktoren, Ertragsfaktoren, die Bestimmung der Biokapazität, die Methode der Ökobilanzierung und die verschiedenen Flächenkategorien (Ackerland, Weideland, Wald, Fischgründe, bebautes Land, Energiefläche).
4. Kritische Betrachtungen: Dieses Kapitel analysiert kritisch die konzeptionellen und methodischen Schwächen des Ökologischen Fußabdrucks. Es werden Punkte wie die Behandlung geringproduktiver Flächen, der Verlust von Biokapazität und Biodiversität, das Problem des "Doublecounting", die Herausforderungen bei der Berücksichtigung von Kernenergie und CO2-Emissionen sowie Schwächen im Verfahren und in der Datenlage diskutiert. Die Grenzen des ÖFA als alleiniger Nachhaltigkeitsindikator werden aufgezeigt.
5. didaktisch methodische Potenziale in der gymnasialen Oberstufe: Der Kapitel beschreibt das didaktische Potenzial des Ökologischen Fußabdrucks für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe. Es werden verschiedene didaktische Ansätze zur Vermittlung des Themas (Problematisierung, Einsatz des Footprintrechners, konstruktive Weiterarbeit auf individueller und kollektiver Ebene) und mögliche Probleme bei der Arbeit mit dem Konzept (Komplexität, Abstraktheit, emotionale Herausforderungen) diskutiert. Verschiedene Unterrichtsmaterialien und Online-Ressourcen werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Ökologischer Fußabdruck, Biokapazität, Nachhaltigkeit, Overshoot, Ressourcenverbrauch, Umweltbildung, Nachhaltigkeitsindikator, Tragfähigkeit, Berechnungsmethoden, kritische Analyse, didaktische Potenziale, Umweltbewusstsein, globaler Wandel.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Ökologischer Fußabdruck im Unterricht
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Ökologischen Fußabdruck (ÖFA). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung des ÖFA und seinen didaktischen Möglichkeiten im gymnasialen Unterricht.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Wissenschaftshistorie, 3. Fachliche Grundlagen, 4. Kritische Betrachtungen und 5. Didaktisch-methodische Potenziale in der gymnasialen Oberstufe. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Welche fachlichen Grundlagen werden im Dokument behandelt?
Kapitel 3 erklärt die Grundidee des ÖFA, seine Berechnungsmethoden (Globaler Hektar, Äquivalenzfaktoren, Ertragsfaktoren), die Biokapazität, Ökobilanzierung und die verschiedenen Flächenkategorien (Ackerland, Weideland, Wald etc.).
Welche kritischen Aspekte des Ökologischen Fußabdrucks werden diskutiert?
Kapitel 4 beleuchtet kritische Punkte des ÖFA, wie die Behandlung geringproduktiver Flächen, den Verlust von Biokapazität und Biodiversität, "Doublecounting", die Berücksichtigung von Kernenergie und CO2-Emissionen, sowie Schwächen in den Daten und Berechnungsmethoden. Die Grenzen des ÖFA als alleiniger Nachhaltigkeitsindikator werden hervorgehoben.
Welche didaktischen Potenziale des Ökologischen Fußabdrucks im Unterricht werden beschrieben?
Kapitel 5 befasst sich mit den didaktischen Möglichkeiten des ÖFA im Unterricht. Es werden verschiedene didaktische Ansätze (Problematisierung, Einsatz von Footprintrechnern, individuelle und kollektive Weiterarbeit) und mögliche Probleme (Komplexität, Abstraktheit) diskutiert. Verschiedene Unterrichtsmaterialien und Online-Ressourcen werden erwähnt.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, das Konzept des Ökologischen Fußabdrucks verständlich zu machen, Missverständnisse zu vermeiden und seine Anwendung im Unterricht aufzuzeigen. Es soll zum Umweltbewusstsein und nachhaltigem Handeln beitragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Ökologischer Fußabdruck, Biokapazität, Nachhaltigkeit, Overshoot, Ressourcenverbrauch, Umweltbildung, Nachhaltigkeitsindikator, Tragfähigkeit, Berechnungsmethoden, kritische Analyse, didaktische Potenziale, Umweltbewusstsein, globaler Wandel.
Wo finde ich detaillierte Informationen zur Wissenschaftshistorie des Ökologischen Fußabdrucks?
Kapitel 2 des Dokuments befasst sich mit der ideengeschichtlichen Entwicklung des Ökologischen Fußabdrucks, beginnend mit frühen Überlegungen zur Nachhaltigkeit bis hin zur Entwicklung durch Rees und Wackernagel.
Wie wird der persönliche ökologische Fußabdruck im Unterricht behandelt?
Das Dokument schlägt verschiedene Ansätze vor, den persönlichen Ökologischen Fußabdruck im Unterricht zu thematisieren, einschließlich der Nutzung von Footprintrechnern und der Reflexion über individuelle und kollektive Handlungsmöglichkeiten.
Welche Probleme können bei der Arbeit mit dem Ökologischen Fußabdruck im Unterricht auftreten?
Das Dokument weist auf mögliche Probleme hin, wie die Komplexität des Konzepts, die Abstraktheit der Daten und die emotionalen Herausforderungen, die die Auseinandersetzung mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck mit sich bringen kann.
- Quote paper
- Johannes Schulz (Author), 2010, Der Ökologische Fußabdruck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154707