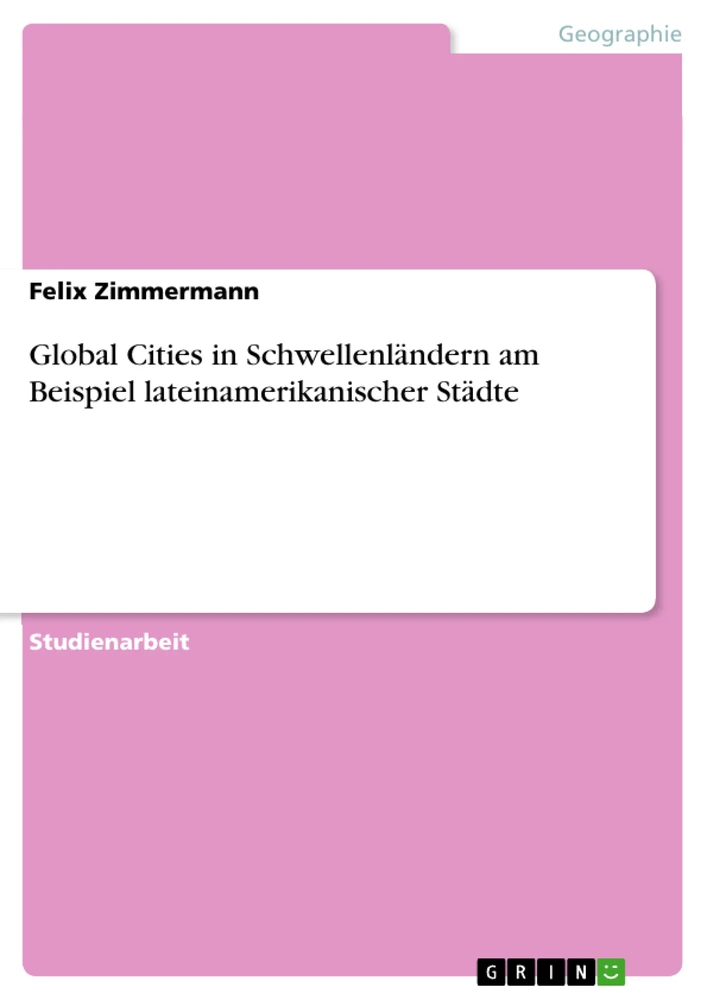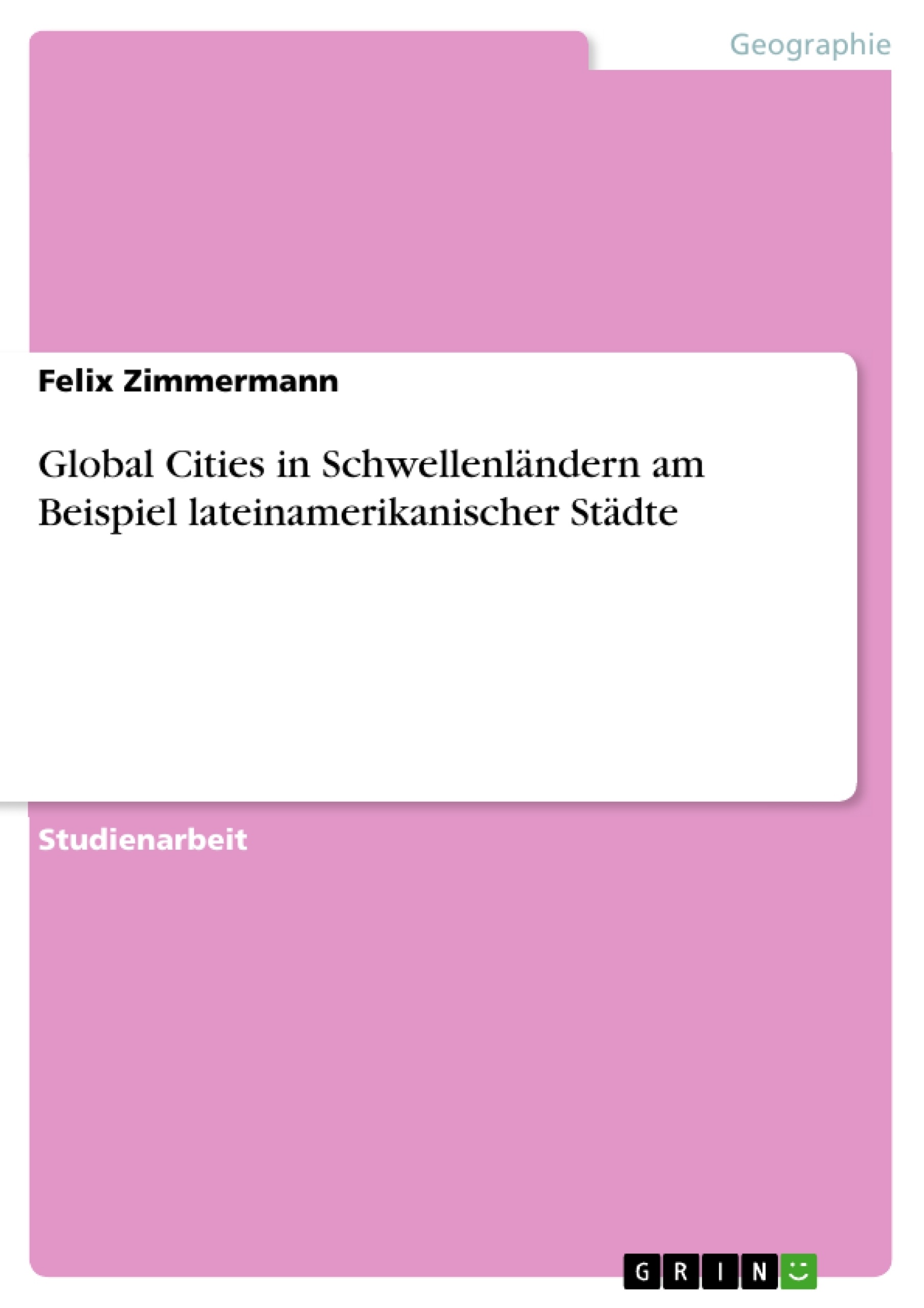Die zum Ende des 20. Jahrhunderts einsetzenden Prozesse „wirtschaftlicher Globalisierung“ verursachten überregionale Machtverschiebungen, aus denen sich im Laufe der Zeit die Städte als bedeutende wirtschaftliche Zentren herauskristallisierten. Auf der Basis einer umfassenden Technologisierung von Produktions- und Arbeitsverfahren auf internationaler Ebene entwickelten sich dabei Unternehmen zu internationalen Akteuren, deren Handeln je nach Zielsetzung von jenen Orten gesteuert wird, welcher dafür die geeigneten Voraussetzungen bieten. In Folge eines schrittweisen Rückzugs politischer Entscheidungsträger aus dem schnell wachsenden globalisierter Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, nahm der Machtbereich einiger weniger, den Weltmarkt dominierender Konzerne, unermessliche Ausmaße an. Durch die Liberalisierung des Welthandels wuchs auch die Rolle der Städte in einzelnen Sektoren der Wirtschaft. Mit fortschreitender Globalisierung und unter dem Einfluss politischer bzw. struktureller Transformationsprozesse, konnten sich nun auch die urbanen Zentren in „Schwellenländern“ innerhalb des Weltmarktgeschehens etablieren. Wenngleich keinerlei Zweifel über die grundlegende Dominanz der Industrienationen im Bereich der Globalwirtschaft besteht, wirft die „neue“ Machtkonzentration in den Städten die Frage auf, welche spezifische Rolle die Städte des „Südens“3 im weltumspannenden Verlauf von Informations- und Finanzströmen spielen; dies umso mehr, als dass sich Globalisierung determinatorisch auf die Lebensweise/-fähigkeit eines jeden Individuums auswirkt. In der vorliegenden Arbeit soll daher am Beispiel Lateinamerikas die Integration bzw. Nichtintegration von Städten der Schwellenländer in den Globalisierungsprozess erläutert werden. Ausgehend von der Annahme, dass diese Städte auf ganz spezielle Weise in den Globalisierungsprozess eingebunden sind und diesbezüglich gemeinsame Charakteristika aufweisen, wird die These vertreten wonach „die“ lateinamerikanische global city also solche existiert. Dabei gilt es zunächst, den Begriff der „global city“ zu erfassen, um anschließend auf eine eventuelle Erfüllung der Definitionskriterien anhand einer Städteauswahl zu überprüfen.
Grundlegend für diese Auswahl ist das Heranziehen eines global city–Rankings, bei dessen Erstellung die entsprechenden Kriterien im Vordergrund standen.
Im Anschluss an die Klärung der Frage, inwieweit die Städte Lateinamerikas global city – Funktionen erfüllen, konzentriert sich...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriff und Funktion der „global city“
- 3. Die Ausprägung von global city – Funktionen im Städtevergleich
- 3.1 Mexico City
- 3.2 São Paolo
- 3.3 Santiago de Chile
- 3.4 Die Bedeutung Miamis für zentralamerikanische Städte
- 4. Allgemeine Aspekte der Stadtentwicklung in Lateinamerika
- 4.1 Das Städtewachstum in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
- 4.2 Auswirkungen der Globalisierung auf die lateinamerikanische Stadt
- 4.2.1 Soziale Folgen der Globalisierung für Lateinamerika
- 4.2.2 „Gated communities“ als Ausdruck residenzieller Segregation
- 5. Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration lateinamerikanischer Städte in den Prozess der Globalisierung. Die Hauptthese ist, dass diese Städte spezifische gemeinsame Charakteristika aufweisen, die sie als „lateinamerikanische global city“ kennzeichnen. Die Arbeit analysiert zunächst den Begriff der „global city“ und prüft anhand ausgewählter Städte, ob diese die Definitionskriterien erfüllen. Im zweiten Teil werden die strukturellen Merkmale der lateinamerikanischen Stadt im Kontext der Globalisierung betrachtet.
- Definition und Charakteristika von „global cities“
- Analyse der Einbindung lateinamerikanischer Städte in globale Wirtschafts- und Finanzströme
- Untersuchung der räumlichen Auswirkungen der Globalisierung auf lateinamerikanische Städte
- Vergleich ausgewählter lateinamerikanischer Städte hinsichtlich ihrer Global City Funktionen
- Bedeutung des „Modells der Struktur und Entwicklung der lateinamerikanischen Stadt“ im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Einfluss der wirtschaftlichen Globalisierung auf die Herausbildung von Städten als bedeutende wirtschaftliche Zentren. Sie thematisiert den Machtzuwachs internationaler Konzerne und die zunehmende Rolle von Städten in Schwellenländern im Weltmarktgeschehen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Integration lateinamerikanischer Städte in den Globalisierungsprozess und stellt die These auf, dass diese Städte gemeinsame Charakteristika als „lateinamerikanische global city“ aufweisen. Die Methodik der Arbeit wird umrissen: Zunächst wird der Begriff „global city“ geklärt, dann wird anhand einer Städteauswahl überprüft, inwieweit diese die Kriterien erfüllen. Anschließend wird die spezifische Stadtentwicklung in Lateinamerika im Kontext der Globalisierung beleuchtet.
2. Begriff und Funktion der „global city“: Dieses Kapitel unterscheidet den Begriff „global city“ von „Metropole“ und „Megacity“. Während Megacity die quantitative Dimension (Bevölkerungszahl, räumliche Ausdehnung) betont, fokussiert sich der Begriff „global city“ auf ökonomische Handlungsfähigkeit, geistiges Kapital und Institutionen, welche die Wirtschaftsaktivität stärken. Es wird der „Global Cities Index“ herangezogen, um zu zeigen, dass nicht jede Megacity auch eine bedeutende global city ist. Mexico City wird als Beispiel genannt, welches im Index einen Platz belegt, der seine Bedeutung im globalen Kontext verdeutlicht.
3. Die Ausprägung von global city – Funktionen im Städtevergleich: Dieses Kapitel analysiert die Ausprägung von Global City Funktionen in verschiedenen lateinamerikanischen Städten (Mexico City, São Paolo, Santiago de Chile) und untersucht die Bedeutung Miamis für zentralamerikanische Städte. Durch den Vergleich wird die These der spezifischen Einbettung dieser Städte in den Globalisierungsprozess untersucht. Dieser Vergleich soll die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Städte im Kontext globaler Vernetzung aufzeigen und die These der spezifischen „lateinamerikanischen global city“ unterstützen oder widerlegen.
4. Allgemeine Aspekte der Stadtentwicklung in Lateinamerika: Kapitel 4 beleuchtet das Städtewachstum in Lateinamerika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und analysiert die Auswirkungen der Globalisierung auf die lateinamerikanische Stadt. Es werden sowohl die sozialen Folgen der Globalisierung als auch Phänomene wie „gated communities“ als Ausdruck residenzieller Segregation betrachtet. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von räumlichen Veränderungen und deren Zusammenhang mit der Globalisierung und der Formierung von Global Cities in Lateinamerika.
Schlüsselwörter
Global City, Globalisierung, Lateinamerika, Schwellenländer, Stadtentwicklung, Megacity, Metropole, soziale Folgen der Globalisierung, räumliche Segregation, „gated communities“, Mexico City, São Paolo, Santiago de Chile, Wirtschaftsaktivität, geistiges Kapital.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lateinamerikanische Global Cities
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Integration lateinamerikanischer Städte in den Prozess der Globalisierung und die These, dass diese Städte spezifische gemeinsame Charakteristika als „lateinamerikanische global city“ aufweisen. Sie analysiert den Begriff der „global city“, prüft anhand ausgewählter Städte deren Erfüllung der Definitionskriterien und betrachtet die strukturellen Merkmale der lateinamerikanischen Stadt im Kontext der Globalisierung.
Welche Städte werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert im Detail Mexico City, São Paolo und Santiago de Chile. Zusätzlich wird die Bedeutung Miamis für zentralamerikanische Städte untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika von „global cities“, die Einbindung lateinamerikanischer Städte in globale Wirtschafts- und Finanzströme, die räumlichen Auswirkungen der Globalisierung auf lateinamerikanische Städte, einen Vergleich ausgewählter lateinamerikanischer Städte hinsichtlich ihrer Global City Funktionen und die Bedeutung des „Modells der Struktur und Entwicklung der lateinamerikanischen Stadt“ im Kontext der Globalisierung. Sie beleuchtet auch das Städtewachstum in Lateinamerika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die sozialen Folgen der Globalisierung, inklusive des Phänomens der „gated communities“ als Ausdruck residenzieller Segregation.
Wie wird der Begriff „global city“ definiert?
Der Begriff „global city“ wird von „Metropole“ und „Megacity“ unterschieden. Während Megacity die quantitative Dimension (Bevölkerungszahl, räumliche Ausdehnung) betont, fokussiert sich der Begriff „global city“ auf ökonomische Handlungsfähigkeit, geistiges Kapital und Institutionen, welche die Wirtschaftsaktivität stärken. Der „Global Cities Index“ wird als Referenz herangezogen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit klärt zunächst den Begriff „global city“. Anschließend wird anhand einer Städteauswahl überprüft, inwieweit diese die Kriterien erfüllen. Die spezifische Stadtentwicklung in Lateinamerika wird im Kontext der Globalisierung beleuchtet, wobei ein Vergleich der ausgewählten Städte hinsichtlich ihrer Global City Funktionen durchgeführt wird.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die These der spezifischen Einbettung lateinamerikanischer Städte in den Globalisierungsprozess zu untersuchen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Städte im Kontext globaler Vernetzung aufzuzeigen, um die These der spezifischen „lateinamerikanischen global city“ zu unterstützen oder zu widerlegen. Die detaillierte Schlussfolgerung wird im Kapitel "Schlussgedanke" präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Global City, Globalisierung, Lateinamerika, Schwellenländer, Stadtentwicklung, Megacity, Metropole, soziale Folgen der Globalisierung, räumliche Segregation, „gated communities“, Mexico City, São Paolo, Santiago de Chile, Wirtschaftsaktivität, geistiges Kapital.
- Quote paper
- Felix Zimmermann (Author), 2010, Global Cities in Schwellenländern am Beispiel lateinamerikanischer Städte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154653