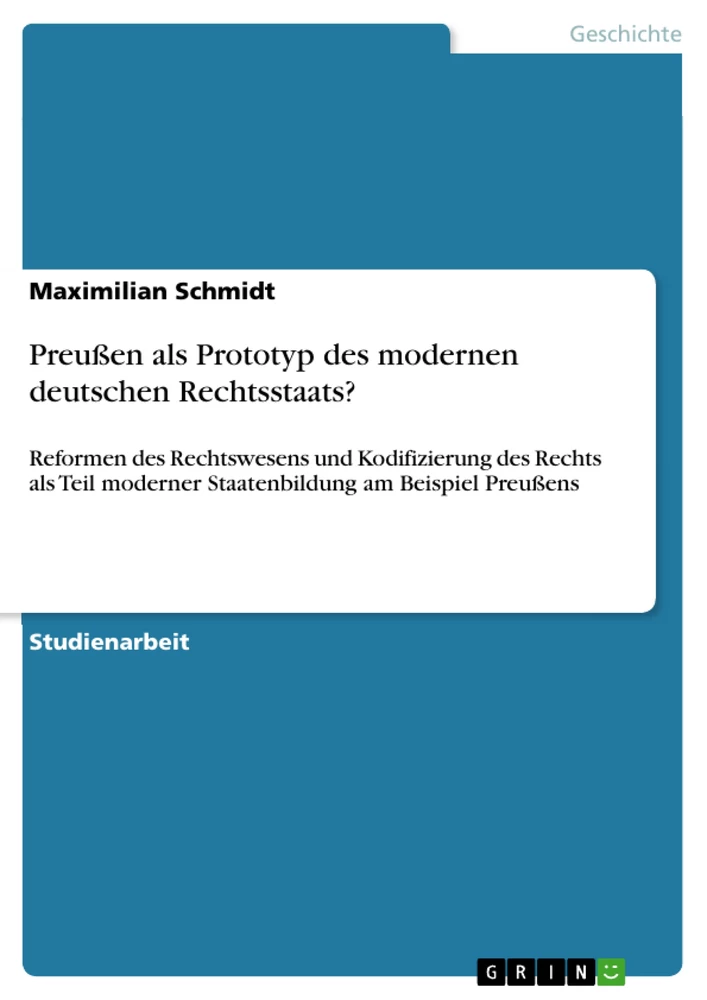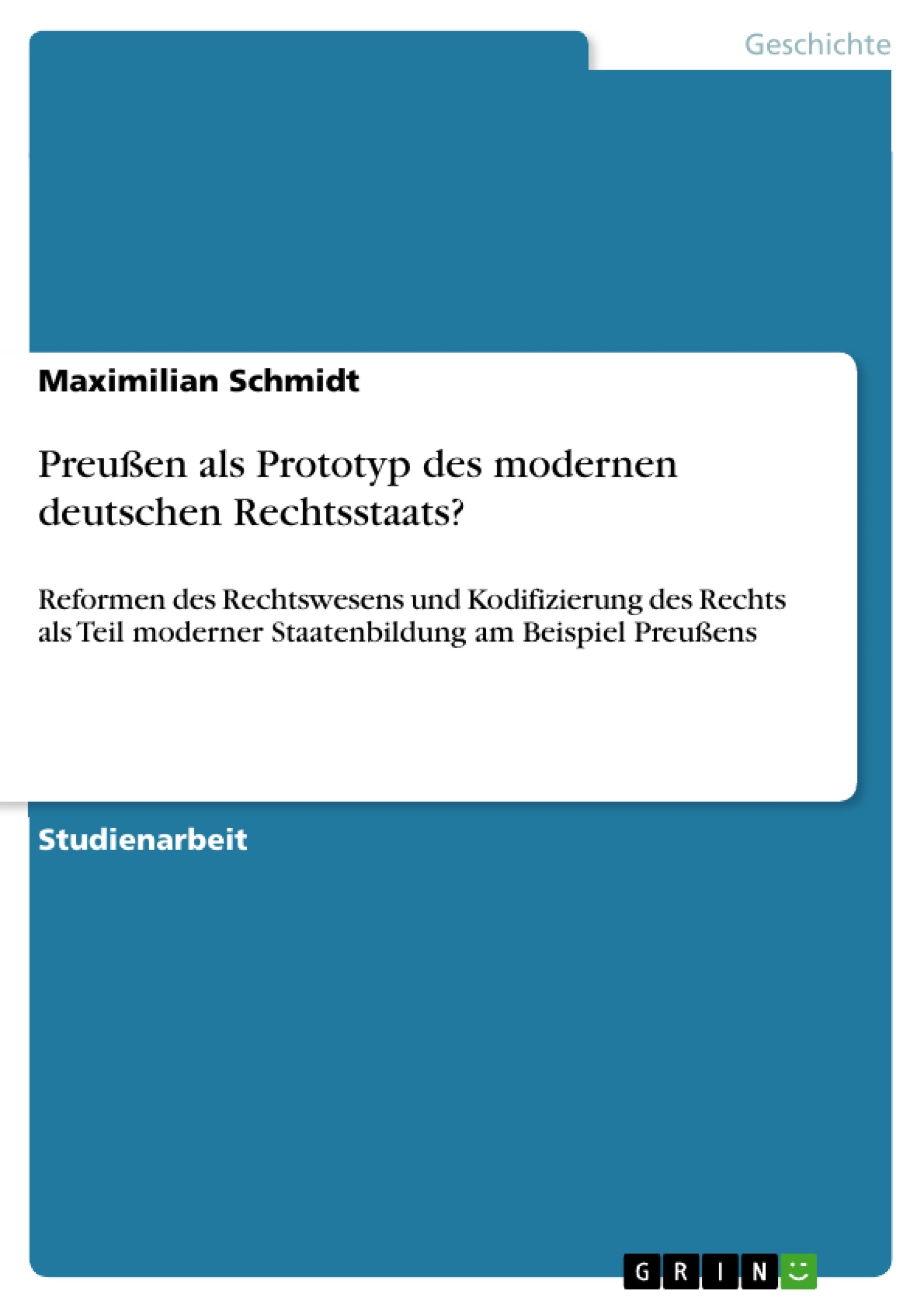Der Rechtsstaat hat in der deutschen Gesellschaft allen anderen Institutionen etwas voraus: Schenkt man aktuellen Umfragen Glauben, so genießt das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit höchstes Ansehen und tiefstes Vertrauen in unserer Gesellschaft – mehr noch als das Grundgesetz selbst, dass die verfassungsrechtliche Grundlage der Bundesrepublik bildet. Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer resümierte angesichts dieser empirischen Ermittlungen, dass „sich die Deutschen nach 60 Jahren auch gesamtdeutsch an das Grundgesetz so gewöhnt [haben (M.S.)], dass sie es nicht mehr missen möchten“ – „auch wenn es nach ganz überwiegender Meinung fortentwickelt werden sollte“, wie Vorländer ergänzt.
Das uns heute so vertraute – und zur Bewahrung eben auch anvertraute – Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist jedoch keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Nicht erst mit der Verkündung des Grundgesetzes vor nun über 60 Jahren oder mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 entstand die Institution des Rechtsstaats: Seine normative Kraft – und noch viel mehr die Idee der Rechtsstaatlichkeit – reichen viel weiter zurück.
Die vorliegende Arbeit hat eben die Entwicklung des preußischen Rechtsstaates zum Thema. Dazu folgt nach dieser Einleitung (I) eine Beschreibung des Rechtswesens zu Beginn des Königreichs Preußen, das sich vor allem durch die ländliche Patrimonialgerichtsbarkeit kennzeichnet (II). Im Anschluss wird ein Überblick über die wesentlichen Reformen des Rechts und der Rechtspflege in Preußen im 18. Jahrhundert gegeben (III). Dabei soll auch der „Fall Müller-Arnold“ als „Praxisbeispiel“ veränderter rechtsphilosophischer Auffassungen des Königs Friedrichs II. angeführt werden. Schließlich folgt eine Auseinandersetzung mit dem Allgemeinen Landrecht von 1794, dessen Entstehung, Inhalt und Rezeption beschrieben werden (IV). Die Arbeit schließt mit einer Diskussion zur Leitfrage: Kann Preußen als Prototyp des modernen deutschen Rechtsstaats gewertet werden? Dabei werden zuerst Begriff und Inhalt von Rechtsstaatlichkeit aus dem modernen Staatsrecht heraus definiert. Daraus sollen Indikatoren ermittelt werden, die einen Vergleich zum preußischen Rechtsstaat im 18. und 19. Jahrhundert ermöglichen sollen (V). Letztlich führt der Autor damit auf seine These hin, dass die Verfassungswirklichkeit der heutigen Bundesrepublik Deutschland aus den richtigen Gründen von den preußischen Rechtsreformen profitiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Reformen des Rechtswesens und Kodifizierung des Rechts als Teil moderner Staatenbildung ..
- II. Das Rechtswesen zu Beginn des Königreichs Preußen: Patrimonialgerichte und ständische Gesellschaft
- III. Justizreformen in Preußen: Samuel von Cocceji und die Einführung der unabhängigen Gerichtsbarkeit und des Instanzenzugs
- a) Der Fall Müller-Arnold als Wendepunkt in der Rechtsgeschichte und Praxisbeispiel für die veränderte Rechtsphilosophie in Preußen
- IV. Kodifizierung des Rechts: Entstehung und Wirkung des Allgemeinen Landrechts von 1794
- a) Entstehung.
- b) Inhalt
- c) Rezeption
- V. Fazit: Preußen als Prototyp des modernen deutschen Rechtsstaats?
- a) Zum Inhalt von Rechtsstaatlichkeit
- b) Indikatoren und Vergleich
- c) Schlussfolgerungen..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung des preußischen Rechtsstaates im 18. Jahrhundert und beleuchtet dabei die Reformen des Rechtswesens und die Kodifizierung des Rechts als Teil der modernen Staatsbildung.
- Das Rechtswesen zu Beginn des Königreichs Preußen, geprägt durch Patrimonialgerichte und ständische Gesellschaft.
- Die Justizreformen unter Samuel von Cocceji, insbesondere die Einführung der unabhängigen Gerichtsbarkeit und des Instanzenzugs.
- Die Entstehung, den Inhalt und die Rezeption des Allgemeinen Landrechts von 1794.
- Die Frage, ob Preußen als Prototyp des modernen deutschen Rechtsstaats betrachtet werden kann.
- Der Vergleich des preußischen Rechtsstaates mit modernen Rechtsstaatsprinzipien und die Analyse der Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland im Kontext preußischer Rechtsreformen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Rechtsstaats in der deutschen Gesellschaft dar und beleuchtet die historische Entwicklung des Rechtsstaatsprinzips. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung der französischen Revolution und der Aufklärung für den Wandel der Rechtsphilosophie hingewiesen.
- Kapitel II: Das Rechtswesen zu Beginn des Königreichs Preußen: Dieses Kapitel beschreibt die Situation des Rechtswesens in Preußen vor den großen Reformen des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der ländlichen Patrimonialgerichtsbarkeit und der ständischen Gesellschaft.
- Kapitel III: Justizreformen in Preußen: Hier werden die wichtigsten Justizreformen des 18. Jahrhunderts in Preußen vorgestellt, insbesondere die Arbeit von Samuel von Cocceji. Die Einführung der unabhängigen Gerichtsbarkeit und des Instanzenzugs sowie der Fall Müller-Arnold als Beispiel für die veränderte Rechtsphilosophie werden behandelt.
- Kapitel IV: Kodifizierung des Rechts: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung, den Inhalt und die Rezeption des Allgemeinen Landrechts von 1794. Es wird dargelegt, warum das ALR als deutscher "Verfassungsprototyp" gilt und welche historische Wirkung es bis heute hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen des Rechtsstaates in Preußen, wie Patrimonialgerichtsbarkeit, ständische Gesellschaft, Justizreformen, Kodifizierung, Allgemeines Landrecht, Rechtsphilosophie und dem Vergleich zum modernen deutschen Rechtsstaat.
- Quote paper
- Maximilian Schmidt (Author), 2009, Preußen als Prototyp des modernen deutschen Rechtsstaats?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154314